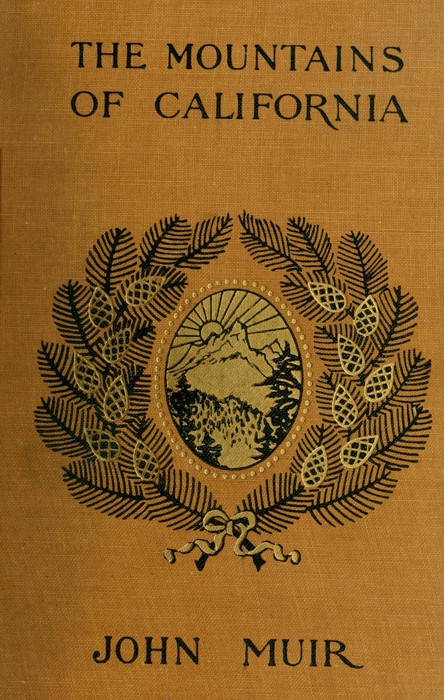
Die Berge Kaliforniens
von John Muir
Inhalt

ABBILDUNGSVERZEICHNIS
KAPITEL I
DIE SIERRA NEVADA
Wohin Sie innerhalb der Grenzen Kaliforniens auch gehen, immer sind Berge in Sicht, die jede Landschaft verzaubern und verschönern. Doch ist die Topographie des Staates im Allgemeinen so einfach und massiv, dass der zentrale Hauptteil nur ein Tal und zwei Gebirgsketten aufweist, deren Verlauf und Höhe fast perfekt regelmäßig erscheinen: die Küstenkette auf der Westseite, die Sierra Nevada im Osten. Diese beiden Gebirgsketten, die im Norden und Süden in Kurven zusammentreffen, umschließen ein herrliches Becken mit einer ebenen Sohle von über 400 Meilen Länge und 35 bis 60 Meilen Breite. Dies ist das großartige Central Valley von Kalifornien, dessen Wasser nur einen Abfluss zum Meer hat, nämlich das Golden Gate. Doch hinter dieser allgemeinen Einfachheit der Merkmale verbirgt sich eine große Komplexität verborgener Details. Die Küstenkette, die sich 2000 bis 8000 Fuß hoch wie eine großartige grüne Barriere gegen den Ozean erhebt, besteht aus zahllosen waldgekrönten Spornen, Kämmen und sanften Hügelwellen, die eine Vielzahl kleinerer Täler umschließen; Einige bieten einen weiten Ausblick auf das Meer, von einigen mit Wäldern gesäumt, und andere, mit nur wenigen Bäumen, auf das Central Valley. Wieder andere, noch kleinere, liegen eingebettet und verborgen in sanften Hügeln mit runden Hügelkuppen, und jedes davon weist sein eigenes Klima, seinen eigenen Boden und seine eigene Produktion auf.
Wenn Sie im klaren Frühling durch das Labyrinth der Küstenkette zu einem der inneren Gipfel oder Pässe gegenüber von San Francisco wandern, liegt die großartigste und eindrucksvollste Landschaft Kaliforniens vor Ihnen. Zu Ihren Füßen liegt das große Central Valley, das in der Sonne golden leuchtet und sich nach Norden und Süden weiter erstreckt, als das Auge reichen kann, ein einziges glattes, blumenreiches, seeähnliches Bett fruchtbaren Bodens. An seinem östlichen Rand erhebt sich die mächtige Sierra, meilenweit hoch, wie eine glatte, kumulierte Wolke im sonnigen Himmel und so herrlich gefärbt und so leuchtend, dass sie nicht von Licht umhüllt, sondern ganz aus Licht zu bestehen scheint, wie die Mauer einer himmlischen Stadt. Auf dem Gipfel und noch ein gutes Stück nach unten sehen Sie einen blassen, perlgrauen Schneegürtel; und darunter einen blauen und dunkelvioletten Gürtel, der die Ausdehnung der Wälder markiert; und am Fuß der Kette einen breiten rosavioletten und gelben Gürtel, wo die Goldfelder der Kleinen und die Gärten am Fuße der Hügel liegen. Alle diese farbigen Bänder vermischen sich fließend und bilden eine Wand aus Licht, unbeschreiblich fein und schön wie ein Regenbogen und doch fest wie Diamant.
Als ich an einem strahlenden Apriltag vom Gipfel des Pacheco Passes zum ersten Mal diese herrliche Aussicht genoss, war das noch kaum betretene oder gepflügte Central Valley eine einzige pelzige, üppige Schicht goldener Korbblütler, und die leuchtenden Wände der Berge strahlten in all ihrer Pracht. Damals schien es mir, die Sierra sollte nicht Nevada oder Snowy Range, sondern Range of Light heißen. Und nachdem ich zehn Jahre in ihrem Herzen verbracht habe, voller Freude und Staunen, in ihren herrlichen Lichtfluten badend, die Sonnenstrahlen des Morgens zwischen den eisigen Gipfeln, das Mittagslicht auf Bäumen, Felsen und Schnee, das Erröten des Alpenglühens und tausend rauschende Wasserfälle mit ihrer wunderbaren Fülle irisfarbener Gischt gesehen habe, scheint sie mir noch immer mehr als alle anderen die Range of Light zu sein, die herrlichste aller Bergketten, die ich je gesehen habe.
Die Sierra ist etwa 500 Meilen lang, 70 Meilen breit und zwischen 7000 und fast 15.000 Fuß hoch. Aus der Gesamtsicht sind keine menschlichen Spuren auf ihr zu sehen, noch irgendetwas, das auf den Reichtum des Lebens, das sie pflegt, oder die Tiefe und Erhabenheit ihrer Skulptur schließen lässt. Keiner ihrer prächtigen, von Wäldern gekrönten Bergrücken erhebt sich viel über das allgemeine Niveau, um seinen Reichtum zu offenbaren. Man sieht kein großes Tal oder See, keinen Fluss oder eine Gruppe gut markierter Merkmale jeglicher Art, die sich in klaren Bildern abheben. Sogar die Gipfel, die so klar und hoch in den Himmel ragen, scheinen vergleichsweise glatt und ohne Merkmale. Dennoch arbeiten im Schatten der Gipfel immer noch Gletscher, und Tausende von Seen und Wiesen glänzen und blühen unter ihnen, und die gesamte Bergkette ist von 2000 bis 5000 Fuß tiefen Schluchten durchzogen, in denen einst majestätische Gletscher flossen und in denen heute ein Band wunderschöner Flüsse fließt und singt.
Obwohl diese berühmten Cañons so unglaublich tief sind, sind sie keine rauen, düsteren, zerklüfteten Schluchten, wild und unzugänglich. Trotz ihrer rauhen Passagen hier und da bieten sie dem Bergsteiger immer noch herrliche Pfade, die von den fruchtbaren Niederungen zu den höchsten eisigen Quellen führen, wie eine Art Bergstraßen voller bezauberndem Leben und Licht, die von den alten Gletschern geebnet und geformt wurden und auf ihrem gesamten Verlauf eine reiche Vielfalt neuartiger und attraktiver Landschaften bieten, die attraktivsten, die bisher in den Gebirgsketten der Welt entdeckt wurden.
An vielen Stellen, besonders im mittleren Bereich der Westflanke der Bergkette, weiten sich die Hauptschluchten zu geräumigen Tälern oder Parks aus, die wie künstliche Landschaftsgärten abwechslungsreich gestaltet sind und reizende Haine und Wiesen sowie Dickichte blühender Büsche aufweisen, während die hohen, zurückgezogenen Wände, die in Form und Skulptur unendlich vielfältig sind, von Farnen, Blütenpflanzen vieler Arten, Eichen und immergrünen Pflanzen gesäumt sind, die auf tausenden schmalen Stufen und Bänken Ankerplatz finden. Das Ganze wird belebt und herrlich gemacht durch fröhliche Ströme, die tanzend und schäumend über die sonnigen Kanten der Klippen strömen, um sich dem glänzenden Fluss anzuschließen, der in ruhiger Schönheit in der Mitte jeder von ihnen fließt.
Die Wände dieser Parktäler vom Typ Yosemite bestehen aus Felsen in der Größe von Bergen, die teilweise durch enge Schluchten und Seitencañons voneinander getrennt sind. Vorne sind sie so steil und auf ebenem Boden so dicht aneinandergebaut, dass die Parks, die sie umschließen, insgesamt wie riesige, von oben beleuchtete Hallen oder Tempel aussehen. Jeder Felsen scheint vor Leben zu leuchten. Einige lehnen sich in majestätischer Ruhe zurück; andere, absolut steil oder fast steil, strecken ihre Stirnen in nachdenklicher Haltung über ihre Gefährten hinaus, heißen Stürme und Windstille gleichermaßen willkommen, scheinbar alles, was um sie herum geschieht, bewusst und doch achtlos, furchterregend in ihrer strengen Majestät, ein Sinnbild der Beständigkeit und doch verbunden mit der Schönheit der zerbrechlichsten und flüchtigsten Formen; ihre Füße stehen in Kiefernhainen und fröhlichen smaragdgrünen Wiesen, ihre Stirnen in den Himmel gehoben; in Licht getaucht, in Fluten singenden Wassers getaucht, während Schneewolken, Lawinen und Winde im Laufe der Jahre glitzern, wogen und um sie herumwirbeln, als hätte die Natur sich bemüht, in diesen Bergvillen ihre erlesensten Schätze zu sammeln, um ihre Liebhaber in eine enge und vertrauensvolle Verbindung mit ihr zu ziehen.
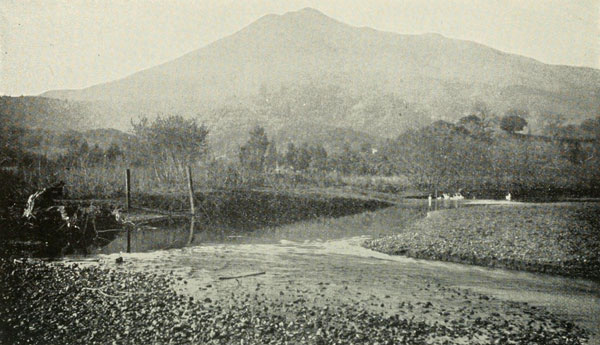
Auch hier, in der mittleren Region der tiefsten Schluchten, stehen die prächtigsten Waldbäume: der Sequoia, der König der Nadelbäume, die edlen Zucker- und Gelbkiefern, Douglasien, Libocedrus und die Weißtannen, jede ein Riese ihrer Art, vereint in ein und demselben Wald, der alle anderen Nadelwälder der Welt übertrifft, sowohl in der Anzahl seiner Arten als auch in der Größe und Schönheit seiner Bäume. Die Winde strömen melodisch durch ihre kolossalen Spitzen, und überall sind sie mit den Liedern der Vögel und des fließenden Wassers zu hören. Meilenlang blühen duftende Ceanothus- und Manzanita-Büsche unter ihnen, und Liliengärten und -wiesen sowie feuchte, farnige Täler in endloser Vielfalt von Düften und Farben ziehen die Bewunderung jedes Betrachters auf sich. Diese edlen Bäume erstrecken sich über Bergrücken und Täler und erstrecken sich in einem ununterbrochenen Gürtel von einem Ende des Gebirges zum anderen, nur leicht unterbrochen von steilen Schluchten im Abstand von etwa fünfzehn bis zwanzig Meilen. Hier streifen die großen, stämmigen Braunbären mit Freude umher und harmonieren mit den braunen Stämmen der Bäume, unter denen sie fressen. Auch Hirsche leben hier und finden Nahrung und Schutz in den Ceanothus-Dickichten, zusammen mit einer Vielzahl kleinerer Menschen. Oberhalb dieser Region der Riesen werden die Bäume kleiner, bis die äußerste Grenze der Waldgrenze an den stürmischen Berghängen in einer Höhe von 3.000 bis 4.500 Metern über dem Meer erreicht ist, wo die Zwergkiefer so niedrig und von Stürmen und schwerem Schneefall so hart getroffen ist, dass sie in flache Dickichte gepresst wird, über deren Spitzen wir leicht laufen können. Unterhalb des Hauptwaldgürtels werden die Bäume ebenfalls kleiner, da Frost und brennende Dürre sie gleichermaßen unterdrücken und zerstören.

Die rosa-violette Zone am Fuße der Bergkette umfasst fast das gesamte berühmte Goldgebiet Kaliforniens. Und hier versammelten sich Bergleute aus allen Ländern der Erde in einem wilden, reißenden Strom, um ihr Glück zu machen. An den Ufern aller Flüsse, Schluchten und Schluchten haben sie ihre Spuren hinterlassen. Jedes Kies- und Geröllbett wurde immer wieder verzweifelt durchwühlt. Aber in dieser Region sind Spitzhacke und Schaufel, die einst mit wilder Begeisterung geschwungen wurden, beiseite gelegt worden, und nur noch der Quarzabbau wird in nennenswertem Umfang betrieben. Die Zone besteht im Allgemeinen aus niedrigen, gelbbraunen, wogenden Vorgebirgen, die hier und da von Gestrüpp und Bäumen aufgeraut sind, und aus Schiefermassen, die von Flechten grau und rot gefärbt sind. Die kleineren Schiefermassen, die sich abrupt in schiefen Platten aus dem trockenen, grasbewachsenen Rasen erheben, sehen aus wie alte Grabsteine auf einem verlassenen Friedhof. Im frühen Frühling, etwa von Februar bis April, ist dieser ganze Gebirgsvorlandgürtel ein Paradies für Bienen und Blumen. Dann regnet es in Strömen, Vögel sind eifrig dabei, ihre Nester zu bauen, und der Sonnenschein ist mild und herrlich. Doch Ende Mai scheinen Erde, Pflanzen und Himmel wie im Ofen gebacken worden zu sein. Die meisten Pflanzen zerfallen unter den Füßen zu Staub, und der Boden ist voller Risse, während der durstige Reisende mit sehnsüchtiger Sehnsucht durch das gleißende Licht auf die schneebedeckten Gipfel blickt, die wie dunstige Wolken in der Ferne aufragen.
Die Bäume, meist Quercus Douglasii und Pinus Sabiniana , neun bis zwölf Meter hoch, mit dünnem, blassgrünem Laub, stehen weit auseinander und spenden nur wenig Schatten. Eidechsen gleiten auf den Felsen umher und erfreuen sich einer Konstitution, die keine Dürre austrocknen kann, und Ameisen in erstaunlicher Zahl, deren winzige Lebensfunken bei zunehmender Hitze umso heller zu brennen scheinen, ziehen emsig in langen Reihen auf der Suche nach Nahrung umher. Krähen, Raben, Elstern – Freunde in Not – versammeln sich auf dem Boden unter den besten Schattenbäumen, keuchen mit hängenden Flügeln und weit geöffneten Schnäbeln, und während der Mittagsstunden lässt sich von ihnen kaum eine Spur hören. Auch Wachteln suchen während der Tageshitze Schatten an lauwarmen Tümpeln in den Kanälen der größeren Bäche in der Flussmitte. Kaninchen huschen zwischen den Ceanothus-Büschen von Dickicht zu Dickicht, und gelegentlich sieht man einen Langohrhasen, der anmutig über die größeren Lichtungen galoppiert. Im Sommer sind die Nächte ruhig und taufrei, und tausend Stimmen verkünden die Fülle des Lebens, trotz der verheerenden Wirkung des trockenen Sonnenscheins auf Pflanzen und größere Tiere. Die Hylas machen nach Sonnenuntergang eine herrlich reine und ruhige Musik, und Kojoten, die kleinen, verachteten Hunde der Wildnis, tapfere, robuste Kerle, die wie verdorrte Heubüschel aussehen, bellen stundenlang im Chor. Bergbaustädte, die meisten davon tot, und einige lebendige mit leuchtenden Flecken von Kulturland, finden sich in großen Abständen entlang des Gürtels, und mit Kletterrosen bedeckte Hütten inmitten von Orangen- und Pfirsichplantagen und süß duftenden Heufeldern in fruchtbaren Ebenen, wo Wasser zur Bewässerung zu finden ist. Aber sie sind meist weit voneinander entfernt und fallen im Gesamtbild kaum auf.
Jeden Winter gibt es in der High Sierra und in der mittleren Waldregion herrlichen Schnee, und selbst die Vorgebirge sind manchmal weiß. Dann sieht die ganze Bergkette aus wie eine riesige, abgeschrägte Wand aus reinstem Marmor. Die rauen Stellen werden dann geglättet, der Tod und Verfall des Jahres werden sanft und freundlich bedeckt, und der Boden erscheint so rein wie der Himmel. Und obwohl er lautlos aus den Wolken fliegt und seinen Platz auf Felsen, Bäumen oder Graswiesen einnimmt, wie schnell findet der sanfte Schnee eine Stimme! Er rutscht von den Höhen, sammelt sich in Lawinen, dröhnt und brüllt wie Donner und bietet ein herrliches Schauspiel, wenn er in langen, seidenen Federn und wirbelnden, wirbelnden Filmen aus Kristallstaub den Berghang hinabfegt.
Die nördliche Hälfte der Gebirgskette ist größtenteils von Lavaströmen bedeckt und mit Vulkanen und Kratern übersät, von denen einige neu und perfekt geformt sind, andere sich in verschiedenen Stadien des Verfalls befinden. Die südliche Hälfte besteht fast vom Fuß bis zum Gipfel aus Granit, während eine beträchtliche Anzahl von Gipfeln in der Mitte der Gebirgskette mit metamorphen Schiefern bedeckt sind, darunter Mount Dana und Mount Gibbs östlich des Yosemite Valley. Mount Whitney, der höchste Punkt der Gebirgskette nahe ihrem südlichen Ende, erhebt seinen helmförmigen Kamm auf eine Höhe von fast 14.700 Fuß. Mount Shasta, ein kolossaler Vulkankegel, erhebt sich am nördlichen Ende auf eine Höhe von 14.440 Fuß und bildet ein edles Wahrzeichen für die gesamte umliegende Region im Umkreis von hundert Meilen. Restmassen vulkanischen Gesteins kommen auch im größten Teil des südlichen Granitteils vor, und an den Flanken gibt es eine beträchtliche Anzahl alter Vulkane, insbesondere entlang der östlichen Basis des Gebirges in der Nähe des Mono Lake und weiter südlich. Aber nur im Norden ist das gesamte Gebirge von der Basis bis zum Gipfel mit Lava bedeckt.
Vom Gipfel des Mount Whitney sieht man nur Granit. Unzählige Gipfel und Türme, die kaum niedriger sind als seine eigenen sturmgepeitschten Klippen, erheben sich in Gruppen wie Waldbäume, in voller Sicht, getrennt durch Schluchten von enormer Tiefe und Schroffheit. Auf Shasta zeugt fast jedes Merkmal in der weiten Aussicht von den alten Vulkanbränden. Weit im Norden, in Oregon, erheben sich die eisigen Vulkane Mount Pitt und Three Sisters über den dunklen immergrünen Wäldern. Im Süden sind unzählige kleinere Krater und Kegel entlang der Achse des Gebirges und an jeder Flanke verteilt. Von diesen ist Lassen’s Butte mit fast 11.000 Fuß über dem Meeresspiegel der höchste. Meilenlang an seinen Flanken stinken und sprudeln heiße Quellen, von denen viele so stürmisch und schwefelhaltig sind, dass sie kurz davor stehen, zu sprudelnden Geysiren wie denen des Yellowstone zu werden.
Der Cinder Cone in der Nähe markiert den jüngsten Vulkanausbruch in der Sierra. Es handelt sich um einen symmetrischen Kegelstumpf von etwa 700 Fuß Höhe, der mit grauer Schlacke und Asche bedeckt ist und auf seiner Spitze einen regelmäßigen unveränderten Krater hat, in dem einige kleine Zweiblättrige Kiefern wachsen. Diese zeigen, dass der Kegel nicht weniger als achtzig Jahre alt ist. Er steht zwischen zwei Seen, die vor kurzem noch einer waren. Bevor der Kegel gebaut wurde, ergoss sich eine Flut aus rauer, blasiger Lava in den See und teilte ihn in zwei Teile. Die feurige Flut trat über die Ufer und drang in die Kiefernwälder ein, wobei sie die Bäume auf ihrem Weg überwältigte. Die verkohlten Enden einiger Bäume sind noch heute unter der Spitze des Lavastroms hervorragen zu sehen, wo er zur Ruhe kam. Noch später kam es zu einem Ausbruch von Asche und loser Obsidianschlacke, vermutlich aus derselben Öffnung, der nicht nur den Schlackenkegel bildete, sondern auch einen heftigen Regenschauer über mehrere Kilometer hinweg in einer Tiefe von 15 bis 20 Zentimetern über die umliegenden Wälder verstreute.
Die Geschichte dieses letzten Ausbruchs in der Sierra Nevada ist auch in den Überlieferungen der Pitt River Indianer erhalten. Sie erzählen von einer furchtbaren Zeit der Dunkelheit, als der Himmel schwarz von Asche und Rauch war, der alles Lebende mit dem Tod bedrohte, und als die Sonne schließlich wieder erschien, war sie rot wie Blut.
Zahlreiche jüngere Krater rauhen die umliegende Region auf; einige von ihnen haben Seen in ihren Schluchten, andere sind mit Bäumen und Blumen bewachsen. Die Natur hat diesen alten Herden und Feuerstellen buchstäblich Schönheit statt Asche gegeben. Auf der Nordwestseite des Mount Shasta befindet sich etwa 3000 Fuß unterhalb des Gipfels ein untergeordneter Kegel, der nach dem Aufbrechen der Haupteiskappe, die den Berg einst bedeckte, aktiv war, wie sein vergleichsweise unberührter Krater und die von ihm ausgehenden Ströme unvergletscherter Lava zeigen. Der Hauptgipfel hat einen Durchmesser von etwa anderthalb Meilen und ist von kleinen, zerbröckelnden Gipfeln und Graten begrenzt, zwischen denen wir vergeblich nach den Umrissen des alten Kraters suchen.
Diese verfallenen Massen und die tiefen Gletscherrillen, die die Seiten des Berges durchziehen, zeigen, dass er durch das Eis beträchtlich abgesenkt und verschlissen wurde; wie sehr, wissen wir nicht genau. Direkt unter dem äußersten Gipfel dringen heiße, schwefelhaltige Gase und Dämpfe aus unregelmäßigen Spalten, vermischt mit Gischt von schmelzendem Schnee, dem letzten schwachen Ausdruck der gewaltigen Kraft, die den Berg erbaut hat. Shasta wurde nicht in einer einzigen großen Erschütterung geboren. Die Felsklippen des Gipfels und die von den Gletschern an den Seiten freigelegten Abschnitte zeigen genug von seiner inneren Struktur, um zu beweisen, dass zwischen vielen einzelnen Ausbrüchen verhältnismäßig lange Ruheperioden lagen, während derer die abkühlende Lave aufhörte zu fließen und dauerhaft zur Masse des wachsenden Berges hinzukam. Mit abwechselnder Eile und Überlegtheit folgte Ausbruch auf Ausbruch, bis der alte Vulkan sogar seine gegenwärtige erhabene Höhe übertraf.

Wenn wir auf dem eisigen Gipfel dieses imposantesten aller Feuerberge der Sierra stehen, können wir kaum anders als seinem nächsten Ausbruch entgegensehen. Gärten, Weinberge und Häuser wurden vertrauensvoll an den Flanken von Vulkanen angelegt, die, nachdem sie jahrhundertelang standhaft geblieben waren, plötzlich in heftige Aktivität ausbrachen und überwältigende Feuerfluten ausstießen. Es ist bekannt, dass zwischen den heftigen Ausbrüchen mehr als tausend Jahre kühler Stille lagen. Wie gigantische Geysire, die geschmolzenes Gestein statt Wasser ausspucken, arbeiten und ruhen Vulkane, und wir haben keine sichere Möglichkeit zu wissen, ob sie tot sind, wenn sie stillstehen, oder nur schlafen.
Entlang der westlichen Basis des Gebirges werden derzeit eine Reihe aufschlussreicher Sedimentgesteine untersucht, die die frühe Geschichte der Sierra enthalten. Wenn wir diese ersten Kapitel für den Moment beiseite lassen, sehen wir, dass erst vor sehr kurzer geologischer Zeit, kurz vor dem Beginn des Winters der Winter, der Eiszeit genannt wird, eine gewaltige Flut geschmolzenen Gesteins aus vielen Schluchten und Kratern an den Flanken und Gipfeln des Gebirges floss, Seebecken und Flussbetten füllte und fast jede vorhandene Struktur im nördlichen Teil auslöschte. Schließlich hörten diese alles zerstörenden Fluten auf zu fließen. Aber während die großen Vulkankegel, die sich entlang der Achse aufbauten, noch brannten und rauchten, geriet die gesamte Sierra in die Herrschaft von Eis und Schnee. Dann begannen Gletscher über die kahlen, gestaltlosen, vom Feuer geschwärzten Berge zu kriechen und sie von den Gipfeln bis zum Meer mit einem Mantel aus Eis zu bedecken; und dann ging mit unendlicher Bedachtsamkeit die Arbeit weiter, das Gebirge neu zu formen. Diese gewaltigen Erosionskräfte haben über zahllose Jahrhunderte hinweg nie Halt gemacht und die kieselartigen Lava- und Granitschichten unter ihren Kristallfalten zertrümmert und zermahlen. Sie haben das Gestein verwüstet und wieder aufgebaut, bis im Lauf der Zeit die Sierra wiedergeboren und fast so ans Licht gebracht wurde, wie wir sie heute sehen, mit Gletschern und schneebedeckten Kiefern auf der Spitze des Gebirges sowie Weizenfeldern und Orangenhainen am Fuße des Gebirges.
Dieser Wandel von eisiger Dunkelheit und Tod zu Leben und Schönheit verlief langsam, wie wir die Zeit zählen, und er findet noch immer statt, im Norden und Süden, überall auf der Welt, wo Gletscher existieren, sei es in Form einzelner Flüsse, wie in der Schweiz, Norwegen, den Bergen Asiens und der Pazifikküste, oder in Form kontinuierlicher Falten, wie in Teilen Alaskas, Grönlands, Franz-Josef-Lands, Nova Zembla, Spitzbergen und den Ländern um den Südpol. Aber in keinem Land, soviel ich weiß, können diese majestätischen Veränderungen besser erforscht werden als in den Ebenen und Bergen Kaliforniens.
Gegen Ende der Eiszeit, als die Schneewolken weniger fruchtbar und die schmelzende Sonneneinstrahlung stärker wurde, wurden die unteren Falten der Eisdecke Kaliforniens, die ganze Eisberge ins Meer warf, flacher und wichen aus dem Tiefland zurück, um sich dann langsam den Flanken der Sierra hinaufzubewegen, was den Klimaveränderungen entsprach. Der große weiße Mantel auf den Bergen zerbrach in eine Reihe mehr oder weniger deutlich erkennbarer und flussartiger Gletscher mit vielen Zuflüssen, die wiederum schmolzen und sich in noch kleinere Gletscher aufteilten, bis heute nur noch einige der kleinsten verbliebenen obersten Zweige des großen Systems an den kühlen Hängen der Gipfel existieren.
Pflanzen und Tiere warteten auf den richtigen Moment und folgten dicht hinter dem schmelzenden Eis, wodurch die neugeborenen Landschaften rasch und freudig belebt wurden. Kiefern zogen in langen, hoffnungsvollen Reihen die sonnengewärmten Moränen empor, nahmen den Boden ein und etablierten sich, sobald er für sie bereit war. Braunstachelige Seggen säumten die Ufer der neugeborenen Seen. Junge Flüsse rauschten in den verlassenen Gletscherkanälen. Blumen blühten am Fuße der großen polierten Kuppeln, während mit rascher Fruchtbarkeit weiche Erdschichten sich setzten und erwärmten und Nahrung für Scharen von wartenden Kindern der Natur boten, großen und kleinen, Tieren wie Pflanzen. Mäuse, Eichhörnchen, Murmeltiere, Hirsche, Bären, Elefanten usw. Der Boden begann mit zauberhafter Geschwindigkeit zu blühen und aus den jungen Wäldern erklang Vogelgesang: Das Leben in jeder Form wurde wärmer, süßer und reicher, während die Jahre über der mächtigen Sierra vergingen, die noch vor kurzem nur an Tod und völlige Verwüstung erinnerte.
Ohne langes und liebevolles Studium ist es schwer, sich das Ausmaß der Arbeit vorzustellen, die die Gletscher während der letzten Eiszeit an diesen Bergen geleistet haben, obwohl sie nichts weiter als Ströme dicht zusammengepresster Schneekristalle sind. Eine sorgfältige Untersuchung der dargestellten Phänomene zeigt, dass der voreiszeitliche Zustand der Bergkette vergleichsweise einfach war: eine riesige Welle aus Gestein, in der tausend Berge, Kuppeln, Schluchten, Grate usw. verborgen lagen. Und bei der Entwicklung dieser wählte die Natur als Werkzeug nicht das Erdbeben oder den Blitz, um sie zu zerreißen und zu spalten, nicht den stürmischen Sturzbach oder den erodierenden Regen, sondern die zarten Schneeblumen, die zahllose Jahrhunderte lang lautlos fielen, die Nachkommen von Sonne und Meer. In harmonischer Arbeit mit vereinten Kräften zerschmetterten und zermahlten sie auf ihrem Weg die Felsen und schufen riesige Erdbetten. Gleichzeitig entwickelten und formten sie die Landschaften zu der reizvollen Vielfalt von Hügeln und Tälern und stattlichen Bergen, die Sterbliche Schönheit nennen. Die durchschnittliche Tiefe der Bergkette beträgt während der letzten Eiszeit vielleicht mehr als eine Meile – eine Menge mechanischer Arbeit, die fast unvorstellbar groß ist. Und unsere Bewunderung muss immer wieder geweckt werden, wenn wir uns abmühen und studieren und lernen, dass diese gewaltige Arbeit der Felsbearbeitung, die so weitreichende Auswirkungen hat, von so zerbrechlichen und kleinen Kräften geleistet wurde wie diese Blumen der Bergwolken. Nur durch die Kraft der Zahl stark, rissen sie ganze Berge weg, Teilchen für Teilchen, Block für Block, und warfen sie ins Meer; sie formten, gestalteten und modellierten die gesamte Bergkette und entwickelten ihre vorherbestimmte Schönheit. All diese neuen Sierra-Landschaften waren offensichtlich vorherbestimmt, denn die physische Struktur der Felsen, von der die Merkmale der Landschaft abhängen, wurde erworben, als sie mindestens eine Meile tief unter der voreiszeitlichen Oberfläche lagen. Und während diese Merkmale in den Tiefen des Gebirges Gestalt annahmen und die Gesteinskörner im Dunkeln an ihre vorgesehenen Plätze marschierten, um die kommende Schönheit zu sehen, versammelten sich die eisigen Dampfpartikel am Himmel, die zur gleichen Musik marschierten, um sie ans Licht zu bringen. Dann, nachdem ihre große Aufgabe erfüllt war, schmolzen diese Bänder aus Schneeblumen, diese mächtigen Gletscher, und wurden entfernt, als wären sie nicht wichtiger als Tau, der nur eine Stunde überdauern soll. Nur wenige Naturgewalten haben jedoch so edle und dauerhafte Monumente hinterlassen wie sie. Die großen, eine Meile hohen Granitkuppeln, die ebenso tiefen Canyons, die edlen Gipfel, die Yosemite-Täler, diese und tatsächlich fast alle anderen Merkmale der Sierra-Landschaft sind Gletschermonumente.
Wenn man die Werke dieser Blumen des Himmels betrachtet, kann man sich leicht vorstellen, dass sie mit Leben erfüllt sind: Boten, die im Auftrag göttlicher Liebe zur Arbeit in die Bergminen geschickt werden. Lautlos, wirbelnd und glitzernd durch die dunkle Luft fliegen sie zu ihren bestimmten Plätzen und scheinen sich miteinander beraten zu haben: „Kommt, wir sind schwach; lasst uns einander helfen. Wir sind viele, und gemeinsam werden wir stark sein. Marschieren wir in engen, tiefen Reihen, rollen wir die Steine von diesen Berggräbern weg und befreien die Landschaft. Legen wir diese sich drängenden Kuppeln frei. Hier lasst uns ein Seebecken ausheben, dort ein Yosemite-Tal, hier einen Kanal für einen Fluss mit geriffelten Stufen und Furchen, in die singende Wasserfälle stürzen. Dort lasst uns breite Erdschichten ausbreiten, damit Mensch und Tier ernährt werden; und hier lasst uns Reihen von Felsbrocken aufstapeln für Kiefern und Riesenmammutbäume. Hier lasst uns Boden bereiten für eine Wiese; dort, für einen Garten und einen Hain, den ich glatt und schön mache für kleine Gänseblümchen und Veilchen und Beete mit Heidekraut, und den ich gut mit Kristallen, Granatfeldspat und Zirkon würzte.“ So und so weiter kam es mir oft vor, als sangen und planten und arbeiteten die mutigen Schneeblumenkreuzfahrer; und nichts, was ich schreiben kann, kann die Erhabenheit und Schönheit ihrer Arbeit übertreiben. Wie Morgennebel sind sie im Sonnenschein verschwunden, alle außer den wenigen kleinen Gruppen, die noch an den kühlsten Berghängen verweilen und als Restgletscher noch fleißig daran arbeiten, die letzten Seebecken, die letzten Erdbetten und die Skulptur einiger der höchsten Gipfel fertigzustellen.

KAPITEL II
DIE GLETSCHER
Von den im vorhergehenden Kapitel erwähnten kleinen Restgletschern habe ich 65 in dem Teil der Gebirgskette zwischen 36° 30’ und 39° Breite gefunden. Sie kommen einzeln oder in kleinen Gruppen an den Nordseiten der Gipfel der High Sierra vor, geschützt unter breiten, frostigen Schatten, in von ihnen selbst geschaffenen Amphitheatern, wo der Schnee, der in Lawinen von den umgebenden Höhen herabstürzt, am reichlichsten ist. Über zwei Drittel der Gesamtzahl liegen zwischen 37° und 38° Breite und bilden die höchsten Quellen der Flüsse San Joaquin, Merced, Tuolumne und Owen.
Die Gletscher der Schweiz sind wie die der Sierra bloße verfallende Überbleibsel gewaltiger Eisfluten, die einst die großen Täler füllten und ins Meer flossen. Dasselbe gilt für die Gletscher Norwegens, Asiens und Südamerikas. Sogar die großen, zusammenhängenden Eisschichten, die noch immer Grönland, Spitzbergen, Nova Zembla, Franz-Josef-Land, Teile Alaskas und die Südpolarregion bedecken, werden flacher und schrumpfen. Jeder Gletscher der Welt ist kleiner als er einmal war. Die ganze Welt wird wärmer oder die Ernte der Schneeblumen nimmt ab. Aber wenn wir den Zustand der Gletscher der Welt betrachten, müssen wir, während wir versuchen, die Veränderungen zu erklären, im Auge behalten, dass derselbe Sonnenschein, der sie vernichtet, sie auch aufbaut. Jeder Gletscher verbraucht eine enorme Menge Sonnenwärme, um den Dampf für den Schnee, aus dem er besteht, vom Meer in die Berge zu befördern, wie Tyndall eindrucksvoll zeigt.
Die Zahl der Gletscher in den Alpen beträgt nach Angaben der Schlagintweit-Brüder 1100, von denen 100 als Primärgletscher gelten. Die Gesamtfläche aus Eis, Schnee und Firn wird auf 1177 Quadratmeilen geschätzt, was im Durchschnitt für jeden Gletscher etwas mehr als eine Quadratmeile entspricht. Nach derselben Quelle beträgt die durchschnittliche Höhe über dem Meeresspiegel, in der sie schmelzen, etwa 7414 Fuß. Der Grindelwaldgletscher reicht bis auf weniger als 4000 Fuß herab, und einer der Mont-Blanc-Gletscher erreicht fast ebenso tief. Einer der größten Himalaya-Gletscher an den Quellgewässern des Ganges reicht nach Angaben von Captain Hodgson nicht tiefer als 12.914 Fuß herab. Der größte der Sierra-Gletscher auf dem Mount Shasta reicht bis auf 9500 Fuß über dem Meeresspiegel herab, was, soweit ich beobachtet habe, der niedrigste Punkt ist, den ein Gletscher innerhalb der Grenzen Kaliforniens erreicht, wobei die durchschnittliche Höhe aller Gletscher nicht weit von 11.000 Fuß entfernt liegt.
Die Veränderungen, die seit der Zeit der größten Ausdehnung in den Gletscherbedingungen der Sierra stattgefunden haben, werden durch die Reihe von Gletschern jeder Größe und Form, die sich entlang der Berge der Küste bis nach Alaska erstrecken, gut veranschaulicht. Eine allgemeine Erkundung dieser lehrreichen Region zeigt, dass nördlich von Kalifornien, durch Oregon und Washington, auf allen hohen Vulkankegeln der Kaskadenkette noch Gruppen aktiver Gletscher vorhanden sind – Mount Pitt, die Three Sisters, Mount Jefferson, Hood, St. Helens, Adams, Rainier, Baker und andere –, von denen einige beträchtliche Größe haben, obwohl keiner von ihnen bis ans Meer reicht. Von diesen Bergen ist der Rainier in Washington der höchste und eisigste. Sein kuppelartiger Gipfel, zwischen 14.000 und 15.000 Fuß hoch, ist mit Eis bedeckt, und acht Gletscher, sieben bis zwölf Meilen lang, gehen von ihm als Zentrum aus und bilden die Quellen der Hauptflüsse des Staates. Der niedrigste Teil dieser schönen Gruppe fließt durch wunderschöne Wälder bis auf 3500 Fuß über dem Meeresspiegel und entlässt einen Fluss, der mit Gletscherschlamm und Sand beladen ist. Weiter durch British Columbia und Südostalaska ist die breite, dichte Bergkette, die sich entlang der Küste erstreckt, im Allgemeinen gletscherhaltig. Die oberen Zweige fast aller großen Canyons und Fjorde sind von Gletschern bedeckt, die allmählich größer werden und tiefer abfallen, bis die Hochregion zwischen Mount Fairweather und Mount St. Elias erreicht ist, wo eine beträchtliche Anzahl ins Meer mündet. Dies ist vor allem das Eisland Alaskas und der gesamten Pazifikküste.
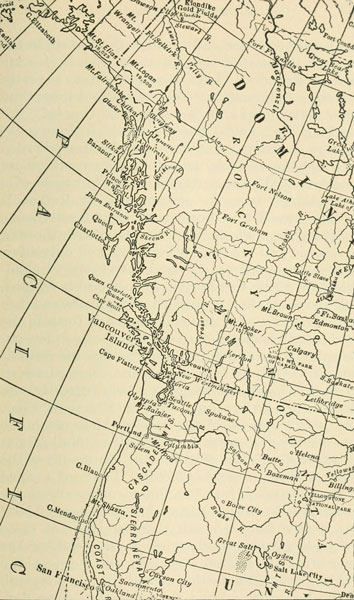
Von hier aus nehmen die Gletscher nach Norden allmählich an Größe und Dicke ab und schmelzen in höheren Lagen. Im Prince William Sound und Cook’s Inlet sind viele schöne Gletscher zu sehen, die aus den umliegenden Bergen fließen; nördlich des 62. Breitengrads sind jedoch nur wenige oder gar keine Gletscher mehr vorhanden, da der Boden meist niedrig und der Schneefall gering ist. Zwischen dem 56. und 60. Breitengrad gibt es wahrscheinlich mehr als 5000 Gletscher, die kleinsten nicht mitgerechnet. Hunderte der größten Gletscher steigen durch die Wälder bis auf Meereshöhe oder in Meeresnähe ab, obwohl nach meinen eigenen Beobachtungen nach einer ziemlich gründlichen Untersuchung der Region nicht mehr als 25 Eisberge ins Meer abfließen. Alle langen, hochwandigen Fjorde, in die diese großen Gletscher erster Klasse münden, sind natürlich voll mit Eisbergen jeder erdenklichen Form, die sich mit donnerndem Lärm im Abstand von wenigen Minuten von einer imposanten Eiswand lösen, die ins tiefe Wasser vorgeschoben wird. Aber diese Eisberge der Pazifikküste sind klein im Vergleich zu denen Grönlands und der Antarktis, und nur wenige entkommen dem komplizierten System von Kanälen, von denen dieser Küstenabschnitt gesäumt ist, und gelangen ins offene Meer. Fast alle werden von Wind und Flut in den Fjorden hin und her getrieben, bis sie schließlich vom Meerwasser, dem Sonnenschein, den warmen Winden und den reichlichen Regenfällen des Sommers schmelzen. Nur ein Gletscher an der Küste, der von Prof. Russell beobachtet wurde, entlädt seine Eisberge direkt ins offene Meer, und zwar am Icy Cape, gegenüber dem Mount St. Elias. Der südlichste der Gletscher, die das Meer erreichen, befindet sich in einem schmalen, malerischen Fjord etwa dreißig Kilometer nordwestlich der Mündung des Stikeen River auf 56° 50’ Breite. Der Fjord wird von den Einheimischen „Hutli“ oder Thunder Bay genannt, nach dem Geräusch, das der Abwurf der Eisberge verursacht. Etwa einen Grad weiter nördlich gibt es vier dieser vollständigen Gletscher, die an den Enden der langen Arme der Holkam Bay entladen sind. An der Spitze der Tahkoo Inlet, noch weiter nördlich, gibt es einen; und an der Spitze und an den Seiten der Glacier Bay, die in nördlicher Richtung von Cross Sound auf 58° bis 59° Breite verlaufen, gibt es sieben dieser vollständigen Gletscher, die Eisberge in die Bucht und ihre Seitenarme schütten und dabei ein ewiges Donnern aufrechterhalten. Der größte dieser Gruppe, der Muir, hat über 200 Zuflüsse und ist unterhalb des Zusammenflusses der Hauptzuflüsse etwa 25 Meilen breit. Zwischen der Westseite dieser eisigen Bucht und dem Ozean ist der gesamte Boden, hoch und niedrig, mit Ausnahme der Gipfel der Fairweather Range, mit einer 1000 bis wahrscheinlich 3000 Fuß dicken Eisschicht bedeckt, die aus vielen deutlich erkennbaren Mündungen entlädt.

Diese fragmentarische Eisdecke und die riesigen Gletscher um den Mount St. Elias sowie die Vielzahl einzelner flussähnlicher Gletscher, die die Hänge der Küstenberge bedecken, bildeten einst offensichtlich einen Teil einer ununterbrochenen Eisdecke, die sich über die gesamte Region hier erstreckte und sich erst vor relativ kurzer Zeit bis zur Mündung der Juan-de-Fuca-Straße im Süden erstreckte, wahrscheinlich sogar noch weiter. Alle Inseln des Alexander-Archipels sowie die Landzungen und Vorgebirge des Festlands weisen deutliche Spuren dieser großen Decke auf, die noch frisch und unverkennbar sind. Sie alle haben die Form der stärksten Eisdecke im Hinblick auf die Wirkung eines gewaltigen, starren Drucks aus überfließendem Eis aus dem Norden und Nordwesten, und ihre Oberflächen haben ein glattes, abgerundetes, überriebenes Aussehen, im Allgemeinen frei von Ecken. Das komplizierte Labyrinth aus Kanälen, Fahrwassern, Meerengen, Durchgängen, Sunden, Engstellen usw. zwischen den Inseln und bis zum Festland hin, zeigt natürlich in seiner Form, seinen Neigungen und allgemeinen Merkmalen dieselbe Unterordnung unter die zermürbende Wirkung der allgemeinen Vereisung wie in seiner Entstehung und unterscheidet sich von den Inseln und Ufern der Fjorde nur dadurch, dass es sich um Teile des voreiszeitlichen Kontinentalrandes handelt, die stärker erodiert und daher von den Meereswassern bedeckt sind, die in sie hineinflossen, als das Eis aus ihnen schmolz. Die Bildung und Ausdehnung von Fjorden auf diese Weise findet noch immer statt und kann an vielen Orten in der Gletscherbucht, der Yakutat-Bucht und angrenzenden Regionen beobachtet werden. Dass sich das Gebiet des Meeres durch die Abtragung seiner Küsten über das Land ausdehnt, ist wohlbekannt, aber in diesen eisigen Regionen Alaskas und sogar bis nach Vancouver Island im Süden waren die Küstenfelsen nur so kurz der Wellenwirkung ausgesetzt, dass sie bisher kaum verschwendet wurden. In diesen Regionen ist die Ausdehnung des Meeres, die es in der nacheiszeitlichen Zeit durch seine eigene Einwirkung bewirkt hat, im Vergleich zu der Ausdehnung, die durch die Einwirkung des Eises zustande kam, kaum wahrnehmbar.
Spuren der verschwundenen Gletscher, die während der Periode der größten Ausdehnung entstanden, sind in der Sierra bis zum 36. Breitengrad im Süden in Hülle und Fülle vorhanden. Sogar die polierten Felsoberflächen, die flüchtigsten Gletscheraufzeichnungen, sind in der oberen Hälfte des mittleren Teils der Bergkette noch in einem wunderbar perfekten Erhaltungszustand zu finden und stellen das auffälligste aller Gletscherphänomene dar. Sie treten in großen, unregelmäßigen Flecken auf den Gipfel- und Mittelregionen auf, und obwohl sie seit Tausenden von Jahren der Einwirkung des Wetters mit seinen zerstörerischen Stürmen ausgesetzt sind, ist ihre mechanische Vollkommenheit so, dass sie die Sonnenstrahlen noch immer wie Glas reflektieren und die Aufmerksamkeit jedes Beobachters auf sich ziehen. Die Aufmerksamkeit des Bergsteigers wird selten von Moränen gefesselt, wie regelmäßig und hoch sie auch sein mögen, oder von Schluchten, wie tief sie auch sein mögen, oder von Felsen, wie edel sie auch in Form und Skulptur sein mögen; aber er bückt sich und reibt bewundernd seine Hände an den glänzenden Oberflächen und versucht, ihre geheimnisvolle Glätte zu erklären. Er hat gesehen, wie der Schnee in Lawinen herabstürzte, kommt aber zu dem Schluss, dass dies nicht das Werk des Schnees sein kann, da er ihn dort findet, wo es keine Lawinen gibt. Auch kann Wasser es nicht getan haben, denn er sieht diese Glätte an den Seiten und Spitzen der höchsten Kuppeln glühen. Nur die Winde aller ihm bekannten Kräfte scheinen in der Lage zu sein, in die durch die Kerben angezeigten Richtungen zu strömen. Indianer, die sich normalerweise so wenig für geologische Phänomene interessieren, sind gelegentlich zu mir gekommen und haben mich gefragt: „Was macht den Boden am Tenaya-See so glatt?“ Sogar Pferde und Hunde bestaunen die seltsame Helligkeit des Bodens, riechen die glatten Flächen und setzen ihre Füße vorsichtig darauf, wenn sie zum ersten Mal darauf stoßen, als hätten sie Angst einzusinken. Die perfektesten der polierten Pflaster und Wände liegen in einer Höhe von 7000 bis 9000 Fuß über dem Meeresspiegel, wo der Fels aus kompaktem Kieselgranit besteht. Kleine, dunkle Flecken finden sich in einer Tiefe von nur 3000 Fuß auf den trockensten und dauerhaftesten Teilen steiler Wände mit Südausrichtung und auf kompakten, geschwungenen Vorsprüngen, die teilweise durch eine Schicht aus großen Felsbrocken vor Regen geschützt sind. Auf der Nordhälfte des Gebirges sind die gestreiften und polierten Oberflächen weniger verbreitet, nicht nur, weil dieser Teil der Kette niedriger liegt, sondern weil die Oberflächengesteine hauptsächlich aus poröser Lave bestehen, die vergleichsweise schnell abgetragen wird. Auch die alten Moränen sind, obwohl sie auf dem größten Teil der Südhälfte des Gebirges gut erhalten sind, im Norden fast verschwunden, aber dort findet man verstreutes und zerfallenes Material.
Ein ähnlich verschwommener Zustand der oberflächlichen Aufzeichnungen der Gletscheraktivität ist in den meisten Teilen von Oregon, Washington, British Columbia und Alaska zu beobachten, was größtenteils auf die Einwirkung übermäßiger Feuchtigkeit zurückzuführen ist. Sogar im Südosten Alaskas, wo sich die ausgedehntesten Gletscher des Kontinents befinden, sind die flüchtigeren Spuren ihrer früheren größeren Ausdehnung, obwohl sie vergleichsweise jung sind, undeutlicher als die der alten Gletscher Kaliforniens, wo das Klima trockener und die Felsen widerstandsfähiger sind.
Diese allgemeinen Ansichten der Gletscher der Pazifikküste ermöglichen meinen Lesern einen Eindruck von den Veränderungen, die in Kalifornien stattgefunden haben, und werfen Licht auf die Restgletscher der High Sierra.
Vor dem Herbst 1871 waren die Gletscher der Sierra unbekannt. Im Oktober desselben Jahres entdeckte ich den Black Mountain-Gletscher in einem schattigen Amphitheater zwischen den Black und Rod Mountains, zwei der Gipfel der Merced-Gruppe. Diese Gruppe ist der höchste Teil eines Ausläufers, der sich von der Hauptachse der Bergkette in Richtung Yosemite Valley erstreckt. Zum Zeitpunkt dieser interessanten Entdeckung erkundete ich die Firn- Amphitheater der Gruppe und verfolgte den Verlauf der alten Gletscher, die einst aus ihren großen Quellen durch das Illilouette-Becken und das Yosemite-Tal flossen, und erwartete nicht, so weit südlich im Land des Sonnenscheins aktive Gletscher zu finden.
Ich begann am nordwestlichen Ende der Gruppe und erkundete nacheinander die wichtigsten Nebenflussbecken, ihre Moränen, Roches Moutonnées und herrlichen Gletscherplatten, wobei ich sie in regelmäßiger Folge durchlief, ohne Rücksicht auf die Zeit, die ich für ihr Studium aufwenden musste. Die Monumente des Nebenflusses, der sein Eis zwischen den Red und Black Mountains hervorströmen ließ, fand ich am interessantesten von allen; und als ich seine herrlichen Moränen sah, die sich in majestätischen Kurven aus dem geräumigen Amphitheater zwischen den Bergen erstreckten, war ich begeistert von der Arbeit, die vor mir lag. Es war einer der goldenen Tage des Sierra Indian Summer, wenn der strahlende Sonnenschein jede Landschaft verherrlicht, wie felsig und kalt sie auch sein mag, und alles andere als Gletscher vermuten lässt. Der Weg des verschwundenen Gletschers war jetzt warm und glänzte an vielen Stellen, als wäre er mit Silber überzogen. Die hohen Kiefern, die auf den Moränen wuchsen, standen verklärt im glühenden Licht, die Pappelhaine auf den Ebenen des Beckens waren in Massen orangegelb und die spät blühenden Goldruten fügten Gold dem Gold hinzu. Ich fuhr weiter auf meiner rosigen Gletscherstraße und kam an einem See nach dem anderen vorbei, die in festen Granitbecken liegen, und an vielen Dickichten und Wiesen, die von einem Bach bewässert werden, der aus dem Amphitheater entspringt und die Seen miteinander verbindet. Mal watete ich durch plüschige Sümpfe, die knietief mit gelbem und violettem Torfmoos bedeckt waren, mal über nackten Fels. Die wichtigsten Seitenmoränen, die die Aussicht zu beiden Seiten begrenzten, sind 30 bis 60 Meter hoch und ungefähr so regelmäßig wie künstliche Dämme und mit einem prächtigen Bestand an Weißtannen und Kiefern bedeckt. Doch diese Üppigkeit von Garten und Wald ließ ich schnell hinter mir. Als ich hinaufstieg, wirkten die Bäume winzig; Flecken von alpinem Bryanthus und Cassiope begannen zu erscheinen, und arktische Weiden wurden vom Winterschnee zu flachen Teppichen gepresst. Die kleinen Seen, die ein paar Meilen weiter unten im Tal so reich mit Blumenwiesen bestickt waren, hatten hier, auf einer Höhe von 10.000 Fuß, nur kleine braune Matten aus Seggen, sodass an mehr als der Hälfte ihrer Ufer kahle Felsen lagen. Doch inmitten dieser alpinen Unterdrückung warf die Bergkiefer tapfer ihre sturmgepeitschten Zweige auf die Felsvorsprünge und Strebepfeiler des Red Mountain, wobei einige Exemplare über 100 Fuß hoch und 24 Fuß im Umfang waren und scheinbar so frisch und kräftig wie die Riesen der tieferen Zonen waren.
Der Abend brach an, als ich gerade das Portal des Hauptamphitheaters erreichte. Es ist etwa eine Meile breit und etwas weniger als zwei Meilen lang. Die bröckelnden Ausläufer und Zinnen des Red Mountain begrenzen es im Norden, die düsteren, grob geformten Abgründe des Black Mountain im Süden und ein zerklüfteter, splitteriger Pass , der sich von Berg zu Berg windet, schließt es im Osten ein.
Ich wählte einen Campingplatz am Rande eines der Seen, wo mich ein Dickicht aus Hemlocktannen vor dem Nachtwind schützte. Nachdem ich mir eine Blechtasse Tee gemacht hatte, setzte ich mich an mein Lagerfeuer und dachte über die Erhabenheit und Bedeutung der Gletscheraufzeichnungen nach, die ich gesehen hatte. Mit fortschreitender Nacht schienen die mächtigen Felswände meiner Berghütte näher zu kommen, während sich der sternenbedeckte Himmel in herrlicher Helligkeit wie eine Decke von Wand zu Wand erstreckte und sich eng an alle spitzen Unregelmäßigkeiten der Gipfel anschmiegte. Nach einer langen Rast am Feuer und einem Blick in mein Notizbuch schnitt ich ein paar belaubte Zweige als Bett ab und fiel in den klaren, todesähnlichen Schlaf des müden Bergsteigers.
Früh am nächsten Morgen machte ich mich auf, den großen alten Gletscher, der so viel zur Schönheit der Yosemite-Region beigetragen hat, bis zu seinen entferntesten Quellen zu verfolgen, und genoss den Zauber, den jeder Entdecker in der unberührten Wildnis der Natur empfindet. Die Stimmen der Berge schliefen noch. Der Wind bewegte kaum die Kiefernnadeln. Die Sonne war aufgegangen, aber es war noch zu kalt für die Vögel und die wenigen grabenden Tiere, die hier leben. Nur der Bach, der von Tümpel zu Tümpel stürzte, schien ganz wach zu sein. Doch der Geist des ersten Tages rief zum Handeln. Die Sonnenstrahlen strömten herrlich durch die zerklüfteten Öffnungen des Sattels , fielen auf die polierten Bürgersteige und beleuchteten die silbrigen Seen, während jeder sonnenberührte Felsen an seinen Rändern weiß brannte wie geschmolzenes Eisen in einem Ofen. Ich umrundete das Nordufer meines Lagersees und folgte dem zentralen Bach an vielen Kaskaden vorbei von einem kleinen See zum nächsten. Die Landschaft wurde strenger und arktischer, die Zwergkiefern und Hemlocktannen verschwanden und der Bach war von Eiszapfen gesäumt. Als die Sonne höher stieg, lösten sich an zerklüfteten Teilen der Klippen Felsen und stürzten in rasselnden Lawinen herab, die wild von Fels zu Fels widerhallten.
Die wichtigsten Seitenmoränen, die sich vom Rand des Amphitheaters bis in das Illilouette-Becken erstrecken, setzen sich in verstreuten Massen entlang der Wände des Amphitheaters fort, während einzelne Felsbrocken, Hunderte Tonnen schwer, hier und da in der Mitte des Kanals zurückgeblieben sind. Auch hier bemerkte ich eine Reihe kleiner Endmoränen, die entlang der Südwand des Amphitheaters angeordnet waren und in Größe und Form mit den Schatten übereinstimmten, die die höchsten Teile warfen. Die Bedeutung dieser Übereinstimmung zwischen Moränen und Schatten wurde später klar. Als ich den Fluss bis zum letzten seiner Kette von kleinen Seen zurückverfolgte, bemerkte ich eine Ablagerung von feinem grauen Schlamm auf dem Boden, außer dort, wo die Kraft der eintretenden Strömung das Absetzen verhindert hatte. Es sah aus wie der von einem Schleifstein abgeschliffene Schlamm, und ich vermutete sofort seinen Gletscherursprung, denn der Fluss, der ihn trug, kam gurgelnd aus der Basis einer rohen Moräne, die im Entstehen zu sein schien. Auf ihrer rauen, unebenen Oberfläche war kein Pflanzen- oder Wetterfleck zu sehen. Er ist zwischen 60 und über 100 Fuß hoch und stürzt in einem Winkel von 38° nach vorne. Vorsichtig bahnte ich mir meinen Weg, erreichte die Spitze der Moräne und war erfreut, einen kleinen, aber gut charakterisierten Gletscher zu sehen, der in einer fein abgestuften Kurve von den düsteren Abgründen des Black Mountain zu der Moräne hinabstürzte, auf der ich stand. Das kompakte Eis war auf allen unteren Teilen des Gletschers zu sehen, obwohl es grau war, weil Schmutz und Steine darin eingebettet waren. Weiter oben verschwand das Eis unter grobkörnigem Schnee. Die Oberfläche des Gletschers war außerdem durch Schmutzbänder und die hervortretenden Ränder der blauen Adern gekennzeichnet, die die laminierte Struktur des Eises zeigten. Die oberste Gletscherspalte oder „Bergschrund“, wo der Firnwar mit dem Berg verbunden, 12 bis 14 Fuß breit und an einigen Stellen von den Überresten von Schneelawinen überbrückt. Ich kroch am Rand der Gletscherspalte entlang und hielt mich mit tauben Fingern fest. Ich entdeckte klare Abschnitte, wo die Schichtstruktur wunderschön sichtbar war. Der Oberflächenschnee war, obwohl mit von den Klippen heruntergeschossenen Steinen bestreut, an einigen Stellen fast rein, wurde allmählich kristallin und verwandelte sich in weißliches, poröses Eis in verschiedenen Farbtönen, und dieses verwandelte sich in einer Tiefe von 20 oder 30 Fuß wieder in blaues Eis, dessen bandartige Bänder teilweise fast rein waren und sich auf die allmählichste und zarteste Weise, die man sich vorstellen kann, mit den helleren Bändern vermischten. Eine Reihe von schroffen Zickzacklinien ermöglichte es mir, in die unheimliche Unterwelt der Gletscherspalte hinabzusteigen. Ihre gekammerten Hohlräume waren mit einer Vielzahl von Eiszapfen behangen, zwischen denen blasses, gedämpftes Licht pulsierte und mit unbeschreiblicher Schönheit schimmerte. Wasser tropfte und plätscherte über mir, und von weit unten drang ein seltsames, feierliches Murmeln von Strömungen herüber, die sich im Dunkeln ihren Weg durch Adern und Spalten bahnten. Die Kammern eines Gletschers sind absolut bezaubernd, auch wenn man sich in ihrer frostigen Schönheit fehl am Platz fühlt. Bald war mir in Hemdsärmeln kalt, und die schiefe Wand drohte, mich zu verschlingen; dennoch fiel es mir schwer, die köstliche Musik des Wassers und das liebliche Licht hinter mir zu lassen. Als ich wieder an die Oberfläche kam, bemerkte ich Felsbrocken jeder Größe auf ihrer Reise zur Endmoräne – Reisen von mehr als hundert Jahren, ohne einen einzigen Halt, bei Tag oder Nacht, im Winter oder Sommer.
Die Sonne ließ ein Netzwerk süß rauschender Bäche entstehen, die anmutig den Gletscher hinabflossen, sich in ihren glänzenden Kanälen kräuselten und wirbelten und klare Abschnitte durch das poröse Oberflächeneis in das tiefe Blau schnitten, wo die Struktur des Gletschers wunderschön hervorgehoben wurde.
Die Reihe kleiner Endmoränen, die ich am Morgen entlang der Südwand des Amphitheaters beobachtet hatte, stimmte in jeder Hinsicht mit der Moräne dieses Gletschers überein, und ihre Verteilung in Bezug auf den Schatten war nun klar. Als die Klimaveränderungen eintraten, die das Schmelzen und den Rückzug des Hauptgletschers verursachten, der das Amphitheater ausfüllte, blieben eine Reihe von Restgletschern im Schatten der Klippen zurück, unter deren Schutz sie verweilten, bis sie die Moränen bildeten, die wir untersuchen. Dann, als der Schnee noch seltener wurde, verschwanden sie alle nacheinander, mit Ausnahme des gerade beschriebenen; und der Grund für seine längere Lebensdauer ist in dem größeren Gebiet des Schneebeckens, das er entwässert, und seinem vollständigeren Schutz vor Sonneneinstrahlung hinreichend offensichtlich. Wie lange dieser kleine Gletscher noch bestehen wird, hängt natürlich von der Schneemenge ab, die er von Jahr zu Jahr im Vergleich zu schmelzendem Abfall erhält.
Nach dieser Entdeckung unternahm ich Exkursionen durch die gesamte High Sierra, erweiterte meine Erkundungen Sommer für Sommer und entdeckte, dass das, was in der Ferne auf den ersten Blick wie ausgedehnte Schneefelder aussah, größtenteils aus Gletschern bestand, die eifrig damit beschäftigt waren, die Skulptur der Gipfel zu vollenden, die so majestätisch von ihren riesigen Vorgängern geformt worden war.
Am 21. August setzte ich eine Reihe von Pfählen in den Maclure-Gletscher in der Nähe des Mount Lyell und stellte fest, dass seine Bewegungsgeschwindigkeit in der Mitte kaum mehr als einen Zoll pro Tag betrug, was einen großen Kontrast zum Muir-Gletscher in Alaska darstellt, der in der Nähe der Front mit einer Geschwindigkeit von fünf bis zehn Fuß in vierundzwanzig Stunden fließt. Mount Shasta hat drei Gletscher, aber Mount Whitney, obwohl er der höchste Berg der Gebirgskette ist, hat derzeit keinen einzigen Gletscher. An seinen Nordhängen gibt es kleine Flecken von anhaltendem Schnee und Eis, aber sie sind flach und weisen keine deutlichen Anzeichen von Gletscherbewegungen auf. Seine Seiten sind jedoch an vielen Stellen durch die Wirkung seiner alten Gletscher zerklüftet und poliert, die nach Osten und Westen als Nebenflüsse der großen Gletscher flossen, die einst die Täler der Flüsse Kern und Owen füllten.
KAPITEL III
DER SCHNEE
Der erste Schnee, der die Sierra weiß macht, fällt normalerweise Ende Oktober oder Anfang November und hat eine Höhe von einigen Zoll, nach Monaten des herrlichsten Indian Summer-Wetters, das man sich vorstellen kann. Aber in wenigen Tagen schmilzt diese dünne Schneedecke größtenteils von den der Sonne ausgesetzten Hängen und bereitet den Bergsteigern, die sich zu dieser Zeit auf den hohen Gipfeln aufhalten, nur wenig Besorgnis. Der erste allgemeine Wintersturm, der Schnee bringt, der einen dauerhaften Teil der Saisonversorgung ausmachen soll, bricht selten vor Ende November über die Berge. Dann eilen die Bergsteiger, vom Himmel gewarnt, zusammen mit den wilden Schafen, Rehen und den meisten Vögeln und Bären ins Tiefland oder in die Vorgebirge; und Murmeltiere, Bergbiber, Waldratten und dergleichen gehen in ihre Winterquartiere, von denen einige das Tageslicht erst wieder sehen, wenn im Juni oder Juli der Frühling wieder erwacht und aufersteht. Der erste schwere Schneefall ist normalerweise etwa zwei bis vier Fuß hoch. Dann folgt, mit Unterbrechungen strahlenden Sonnenscheins, ein Sturm auf den anderen und häuft Schnee auf Schnee, bis neun bis fünfzehn Meter gefallen sind. Aber aufgrund des Absetzens und Verdichtens des Schnees und des fast ständigen Abfalls durch Schmelzen und Verdunsten beträgt die tatsächliche Durchschnittstiefe zu keiner Zeit mehr als drei Meter in der Waldregion oder fünfzehn Meter an den Hängen der Gipfel.
Selbst bei kältestem Wetter hört die Verdunstung nie ganz auf, und der Sonnenschein, der zwischen den Stürmen reichlich vorhanden ist, ist stark genug, um die Oberfläche während der gesamten Wintermonate mehr oder weniger zu schmelzen. Schmelzwasser gelangt auch bis zu einem gewissen Grad auf den Boden, da die Wärme in den Felsen gespeichert und langsam an den Schnee abgegeben wird, der mit ihnen in Berührung kommt, wie das Ansteigen der Flüsse in allen höheren Regionen nach dem ersten Schneefall und ihr stetiges Fließen den ganzen Winter über zeigen.
Der Großteil des Schnees, der sich um die hohen Gipfel der Bergkette herum ablagert, fällt in kleinen, knackigen Flocken und zerbrochenen Kristallen, oder, wenn starke Winde und niedrige Temperaturen herrschen, werden die Kristalle, anstatt sich beim Fallen zu büscheligen Flocken zusammenzuschließen, geschlagen und zu Mehl und feinem Staub zerbrochen. Aber unten in der Waldregion fällt der Großteil sanft, leicht und federleicht zu Boden, wobei einige der Flocken bei mildem Wetter fast einen Zoll im Durchmesser sind, und er wird gleichmäßig verteilt und durch den Schutz der großen Bäume daran gehindert, in großem Umfang abzudriften. Während der leichten Stürme ist jeder Baum in der kältesten und dunkelsten Jahreszeit voller märchenhafter Blüten, die die Zweige biegen und jede singende Nadel verstummen lassen. Aber sobald der Sturm vorüber ist und die Sonne scheint, beginnt der Schnee sofort zu rutschen und sich zu setzen und in winzigen Lawinen von den Zweigen zu fallen, und der weiße Wald wird bald wieder grün. Der Schnee auf dem Boden setzt sich ebenfalls und taut an jedem hellen Tag und gefriert nachts, bis er grobkörnig wird und jede Spur seiner strahlenförmigen Kristallstruktur verliert, und dann kann ein Mann fest über seine gefrorene Oberfläche laufen, als ob er auf Eis wäre. Die Waldregion bis zu einer Höhe von 7000 Fuß ist im Juni normalerweise größtenteils schneefrei, aber zu dieser Zeit sind die höheren Regionen noch schwer beladen und werden vor Mitte oder Ende Juli nicht in nennenswertem Umfang vom Frühlingswetter berührt.
Eine der auffälligsten Auswirkungen des Schnees auf den Bergen ist die Verschüttung von Flüssen und kleinen Seen.
Wie der Schnee im Fluss Einen Moment weiß ist, dann für immer verloren,
sang Burns, um die Flüchtigkeit menschlicher Freude zu illustrieren. Die ersten Schneeflocken, die in die Flüsse der Sierra fallen, verschwinden so plötzlich; aber bei großen Stürmen, wenn die Temperaturen niedrig sind, kühlt die Schneemenge das Wasser schließlich fast bis zum Gefrierpunkt ab, und dann hört es natürlich auf, so plötzlich zu schmelzen und den Schnee zu verzehren. Die fallenden Flocken und Kristalle bilden wolkenartige Massen aus blauem Schlamm, die von der Strömung vorwärtsgetrieben und in viele Meilen entfernte wärmere Klimazonen getragen werden, während einige an Baumstämmen und Felsen und vorspringenden Uferspitzen haften bleiben und tagelang hoch über dem Wasserspiegel liegen bleiben und wieder weiß erscheinen, anstatt sofort „für immer verloren“ zu sein, während die Flüsse selbst während der Schneeperiode schließlich monatelang verloren sind. Der Schnee wird zunächst in steilen, sich überrollenden Verwehungen von den Ufern abgelagert, verdichtet und zementiert, bis die Ströme überspannt sind. Sie fließen dann im Dunkeln unter einer durchgehenden Schneedecke über die etwa dreißig Meilen breite Schneezone. Alle Flüsse der Sierra und ihre Nebenflüsse in diesen Hochregionen gehen jeden Winter verloren, als ob eine neue Eiszeit begonnen hätte. Außer an einigen Stellen, an denen große Wasserfälle auftreten, ist kein Tropfen fließenden Wassers zu sehen, obwohl das Rauschen und Grollen der stärkeren Strömungen noch zu hören ist. Gegen Frühling, wenn das Wetter tagsüber warm und nachts frostig ist, machen wiederholtes Tauen und Gefrieren und neue Schneeschichten die Brückenmassen dicht und fest, sodass man sicher über die Ströme gehen oder sogar ein Pferd darüber führen kann, ohne Gefahr zu laufen, durchzufallen. Im Juni beginnen die dünnsten Teile der Winterdecke und diejenigen, die am meisten der Sonne ausgesetzt sind, nachzugeben und bilden dunkle, schroffe, grubenartige Senken, an deren Grund das rauschende Wasser zu sehen ist. Ende Juni kann der Bergsteiger nur hier und da eine sichere Schneebrücke finden. Die langlebigsten Winterbrücken, die aufgrund der warmen Luftströme, die durch die Tunnel strömen, sowohl von unten als auch von oben auftauen, sind auffallend gewölbt und geformt; und durch das gelegentliche Gefrieren des sickernden, tropfenden Wassers von der Decke werden sie hell und malerisch eisig. In einigen Bereichen, wo ein freier Rand vorhanden ist, können wir durch sie hindurchgehen. Diese Tunnel sind nicht sehr dunkel, da hier und da kleine Oberlichter erscheinen. Der tosende Fluss erfüllt den gesamten gewölbten Weg mit beeindruckend lauter, widerhallender Musik, die manchmal durch die Amsel versüßt wird, einen Vogel, der keine Angst hat, überall hinzugehen, wo ein Bach hinfließt, und überall zu singen, wo ein Bach singt.
Alle kleinen alpinen Tümpel und Seen verschwinden auf ähnliche Weise aus der Winterlandschaft, entweder weil sie zuerst zufrieren und dann von Schnee bedeckt werden oder weil sie von Lawinen aufgefüllt werden. Die erste Lawine der Saison, die in ein Seebecken geschossen wird, findet die Oberfläche möglicherweise gefroren vor. Dann ist ein gewaltiges Krachen von brechendem Eis und ein Aufschlagen der Wellen zu hören, vermischt mit dem tiefen, dröhnenden Geräusch der Lawine. Losgelöste Massen des eindringenden Schnees, vermischt mit Eisfragmenten, treiben in schlammigen, inselartigen Haufen umher, während der Hauptteil einen Schutthaufen bildet, dessen Basis ganz oder teilweise auf dem Boden des Beckens ruht, je nach Tiefe und Größe der Lawine. Die nächste Lawine dringt natürlich noch weiter vor und so weiter, bis das gesamte Becken gefüllt und sein Wasser aufgesaugt oder verdrängt sein kann. Diese riesige Schlammmasse, mehr oder weniger mit Sand, Steinen und vielleicht Holz vermischt, ist bis zu einer beträchtlichen Tiefe gefroren, und es bedarf viel Sonnenwärme, um sie aufzutauen. Einige dieser unglücklichen kleinen Seen sind erst gegen Ende des Sommers von Eis und Schnee befreit. Andere sind nie ganz frei und öffnen sich nur auf der Seite gegenüber dem Eingang der Lawinen. Einige zeigen nur eine schmale Wassersichel zwischen dem Ufer und steilen Steilhängen aus eisigem, verdichtetem Schnee, von denen Massen, die abbrechen, wie Eisberge in einem Miniatur-Arktischen Ozean vor ihnen schwimmen, während die Lawinenhaufen, die sich an die Berge lehnen, wie kleine Gletscher aussehen. Die vorderen Klippen sind in einigen Fällen recht malerisch, und mit den von den Bergen übersäten Gewässern davor, die von der Sonne erhellt werden, sind sie außerordentlich schön. Es kommt oft vor, dass eine Seite eines Seebeckens hoffnungslos unter Schnee begraben und gefroren ist, während die andere, die den Sonnenschein genießt, mit wunderschönen Blumengärten geschmückt ist. Einige der kleineren Seen werden augenblicklich von einer schweren Lawine aus Steinen oder Schnee ausgelöscht. Die rollende, rutschende, schwere Masse, die auf einer Seite eindringt, fegt über den Boden und die gegenüberliegende Seite hinauf, verdrängt das Wasser und kratzt sogar das Becken sauber, schiebt die angesammelten Steine und Sedimente das gegenüberliegende Ufer hinauf und nimmt es vollständig in Besitz. Das verdrängte Wasser wird zum Teil absorbiert, aber der größte Teil wird um die Vorderseite der Lawine herum und den Abflusskanal hinunter geschickt, tosend und eilend, als ob es Angst hätte und froh wäre, entkommen zu sein.
SCHNEE-BANNER
Das großartigste Sturmphänomen, das ich je gesehen habe und das an Pracht die imposantesten Effekte von Wolken, Fluten oder Lawinen übertraf, waren die mit Schneefahnen geschmückten Gipfel der High Sierra hinter dem Yosemite Valley. Viele der sternenförmigen Schneeblumen, aus denen diese Fahnen gemacht sind, fallen, bevor sie reif sind, während die meisten derjenigen, die ihre perfekte Entwicklung als sechsstrahlige Kristalle erreichen, beim Fallen durch die frostige Luft glitzern und aneinander reiben und in Fragmente zerbrechen. Dieser trockene, fragmentarische Schnee wird durch die Einwirkung des Windes noch weiter für die Bildung von Fahnen vorbereitet. Denn anstatt sofort zur Ruhe zu kommen, wie der Schnee, der in die ruhigen Tiefen der Wälder fällt, wird er immer wieder gerollt, gegen Felsgrate geschlagen und in Gruben und Mulden gewirbelt, wie Felsbrocken, Kieselsteine und Sand in den Schlaglöchern eines Flusses, bis schließlich die feinen Kanten der Kristalle abgenutzt sind und die ganze Masse zu Staub zerfällt. Und wenn Sturmwinde diesen präparierten Schneestaub in lockerem Zustand auf exponierten Hängen finden, wo er frei nach Lee aufsteigen kann, wird er zurück in den Himmel geschleudert und in Form von Fahnen oder wolkigen Wehen von Gipfel zu Gipfel getragen, je nach Windgeschwindigkeit und Beschaffenheit der Hänge, die er hinauf- oder umrundet. Während er so durch die Luft fliegt, entkommt ein kleiner Teil und bleibt als Dampf am Himmel. Aber der weitaus größere Teil bleibt, nachdem er immer wieder in den Himmel getrieben wurde, schließlich in dichten Wehen oder im Schoß von Gletschern stecken, und ein Teil bleibt jahrhundertelang still und starr, bevor er schließlich schmilzt und singend die Berghänge hinunter zum Meer geschickt wird.
Doch trotz der Fülle an Schneestaub im Winter in den Bergen, der Häufigkeit starker Winde und der langen Zeit, in der der Staub lose und der Einwirkung der Winde ausgesetzt bleibt, ist das Auftreten wohlgeformter Banner aus Gründen, die wir später noch erläutern werden, verhältnismäßig selten. Ich habe nur ein einziges Schauspiel dieser Art gesehen, das in jeder Hinsicht perfekt schien. Das war im Winter 1873, als ein wilder Nordwind über die schneebedeckten Gipfel fegte. Zufällig überwinterte ich zu dieser Zeit im Yosemite Valley, jenem erhabenen Tempel der Sierra, wo man jeden Tag die großartigsten Sehenswürdigkeiten sehen kann. Doch selbst hier schien der wilde Festtag des Nordwindes überaus herrlich. Ich wurde morgens vom Schaukeln meiner Hütte und dem Schlagen von Kiefernholz auf dem Dach geweckt. Abgelöste Sturzbäche und Lawinen der Hauptsturmflut stürzten mit lautem, widerhallendem Getöse die schmalen Seitenschluchten hinab und über die steilen Wände, weckten die Kiefern zu enthusiastischer Aktivität und ließen das ganze Tal vibrieren, als würde man auf einem Instrument spielen.
Doch in der Ferne, auf den hohen, exponierten Gipfeln der Bergkette, die so hoch in den Himmel ragen, zeigte der Sturm noch prachtvollere Züge, die ich bald in ihrer ganzen Pracht sehen sollte. Ich hatte schon lange den Wunsch gehabt, einige Punkte in der Struktur des Eiskegels zu studieren, der sich jeden Winter am Fuße des oberen Yosemite-Wasserfalls bildet, doch die blendende Gischt, von der er umgeben ist, hatte mich bisher daran gehindert, nahe genug heranzukommen. Heute Morgen wurde der gesamte Wasserfall in dünne Fetzen gerissen und horizontal entlang der Felswand geweht, so dass der Kegel trocken blieb. Und während ich mich auf den Weg zur Spitze eines Felsvorsprungs machte, um eine so günstige Gelegenheit zu nutzen, das Innere des Kegels zu untersuchen, kamen über der Schulter des South Dome die Gipfel der Merced-Gruppe in Sicht, von denen jeder ein strahlendes Banner gegen den blauen Himmel schwenkte, so regelmäßig in der Form und so fest in der Textur, als ob es aus feiner Seide gewebt wäre. Ein so seltenes und prächtiges Phänomen überwog natürlich alle anderen Überlegungen, und ich ließ den Eiskegel sofort los und kämpfte mich aus dem Tal hinaus zu einer Kuppel oder einem Grat, der hoch genug war, um einen Überblick über die Hauptgipfel zu bieten, in der Gewissheit, diese noch herrlicher geschmückt vorzufinden; und ich wurde nicht im Geringsten enttäuscht. Der Indian Cañon, durch den ich kletterte, war mit Schnee bedeckt, der in Lawinen von den hohen Klippen zu beiden Seiten heruntergestürzt war, was den Aufstieg schwierig machte; aber angespornt durch den tosenden Sturm brachte das mühsame Wälzen keine Ermüdung, und nach vier Stunden erreichte ich die Spitze eines 8000 Fuß hohen Grats über dem Tal. Und dort bot sich in deutlichem Relief, wie ein klares Gemälde, eine äußerst imposante Szene. Unzählige Gipfel, schwarz und spitz, erhoben sich erhaben in den dunkelblauen Himmel, ihre Basen in pures Weiß gehüllt, ihre Flanken mit Schnee gestreift und bespritzt, wie Meeresfelsen mit Schaum; und von jedem Gipfel wehte frei und unverfälscht ein wunderschönes, seidenartiges, silbriges Banner, eine halbe bis eine Meile lang, schmal an der Befestigungsstelle, dann allmählich breiter werdend, je weiter es sich vom Gipfel aus erstreckte, bis es, soweit ich es schätzen konnte, ungefähr 1000 oder 1500 Fuß breit war. Die Gipfelgruppe, die „Krone der Sierra“ genannt wird und an der Quelle der Flüsse Merced und Tuolumne liegt – die Mounts Dana, Gibbs, Conness, Lyell, Maclure, Ritter und ihre namenlosen Artgenossen – hatten jeweils ihr eigenes strahlendes Banner, das mit deutlich sichtbarer Bewegung im Sonnenlicht wehte, und nicht eine einzige Wolke am Himmel konnte ihre schlichte Erhabenheit trüben. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf diesem Yosemite-Kamm und blicken nach Osten. Sie bemerken ein seltsam grelles Glitzern in der Luft. Der Sturm fegt wild mit wildem, stürmischem Brüllen über uns hinweg, aber seine Gewalt ist nicht zu spüren, denn Sie blicken durch eine geschützte Öffnung im Wald wie durch ein Fenster. Dort, im unmittelbaren Vordergrund Ihres Bildes,erhebt sich ein majestätischer Wald aus Weißtannen, die in ewiger Frische blühen, das Laub ist gelbgrün und der Schnee unter den Bäumen ist mit ihren wunderschönen, vom Wind abgerissenen Federn übersät. Dahinter und sich über die gesamte Mittelebene erstreckend, liegen düstere Kiefernwälder, unterbrochen von riesigen, geschwungenen Bergrücken und Kuppeln; und gleich hinter dem dunklen Wald sehen Sie die Monarchen der High Sierra, die ihre prächtigen Banner schwenken. Sie sind dreißig Kilometer entfernt, aber Sie würden sie nicht näher haben wollen, denn jedes Merkmal ist deutlich erkennbar und das ganze herrliche Schauspiel ist in seinen richtigen Proportionen zu sehen. Beachten Sie nach diesem Gesamtanblick, wie scharf die dunklen, schneefreien Rippen, Strebepfeiler und Gipfel der Berge abgegrenzt sind, mit Ausnahme der von den Bannern verhüllten Teile, und wie zart ihre Seiten mit Schnee bestrichen sind, wo er in schmalen Rillen und Schluchten zur Ruhe gekommen ist. Beachten Sie auch, wie majestätisch die Banner wehen, wenn der Wind gegen ihre Seiten bläst, und wie sauber jedes an der äußersten Spitze seines Gipfels befestigt ist, wie ein Wimpel an einem Masttopp; wie glatt und seidig ihre Beschaffenheit ist und wie fein sich ihre verblassenden Fransen in den azurblauen Himmel zeichnen. Sehen Sie, wie dicht und undurchsichtig sie an der Befestigungsstelle sind und wie hauchdünn und durchscheinend sie zum Ende hin sind, sodass die Gipfel dahinter nur undeutlich zu sehen sind, als blickten Sie durch Mattglas. Beachten Sie ferner, wie einige der längsten, zu den erhabensten Gipfeln gehörenden, vollkommen frei über dazwischenliegende Einschnitte und Pässe von Gipfel zu Gipfel wehen, während andere sich überlappen und teilweise verbergen. Und bedenken Sie, wie scharf jedes Teilchen dieser wundersamen Schneedecke Lichtstrahlen aussendet. Dies sind die Hauptmerkmale des schönen und furchterregenden Bildes, wie es vom Waldfenster aus zu sehen ist; und es wäre immer noch überaus herrlich, wenn Vorder- und Mittelgrund vollständig ausgelöscht würden und nur die schwarzen Gipfel, die weißen Banner und der blaue Himmel übrig blieben.und wie zierlich jeder von ihnen an der Spitze seines Gipfels befestigt ist, wie ein Wimpel an einer Mastspitze; wie glatt und seidig ihre Textur ist und wie fein ihre verblassenden Fransen in den azurblauen Himmel gezeichnet sind. Sehen Sie, wie dicht und undurchsichtig sie an der Befestigungsstelle sind und wie hauchdünn und durchscheinend sie gegen Ende hin sind, so dass die Gipfel dahinter nur undeutlich zu sehen sind, als ob Sie durch Milchglas blicken würden. Beachten Sie auch, wie einige der längsten, die zu den erhabensten Gipfeln gehören, vollkommen frei über dazwischenliegende Kerben und Pässe von Gipfel zu Gipfel strömen, während andere sich überlappen und teilweise gegenseitig verbergen. Und bedenken Sie, wie scharf jedes Teilchen dieser wundersamen Schneedecke Lichtstrahlen aussendet. Dies sind die Hauptmerkmale des schönen und schrecklichen Bildes, wie es vom Waldfenster aus gesehen wird; und es wäre immer noch überragend herrlich, wenn der Vorder- und Mittelgrund vollständig ausgelöscht wäre und nur die schwarzen Gipfel, die weißen Banner und der blaue Himmel übrig blieben.und wie zierlich jeder von ihnen an der Spitze seines Gipfels befestigt ist, wie ein Wimpel an einer Mastspitze; wie glatt und seidig ihre Textur ist und wie fein ihre verblassenden Fransen in den azurblauen Himmel gezeichnet sind. Sehen Sie, wie dicht und undurchsichtig sie an der Befestigungsstelle sind und wie hauchdünn und durchscheinend sie gegen Ende hin sind, so dass die Gipfel dahinter nur undeutlich zu sehen sind, als ob Sie durch Milchglas blicken würden. Beachten Sie auch, wie einige der längsten, die zu den erhabensten Gipfeln gehören, vollkommen frei über dazwischenliegende Kerben und Pässe von Gipfel zu Gipfel strömen, während andere sich überlappen und teilweise gegenseitig verbergen. Und bedenken Sie, wie scharf jedes Teilchen dieser wundersamen Schneedecke Lichtstrahlen aussendet. Dies sind die Hauptmerkmale des schönen und schrecklichen Bildes, wie es vom Waldfenster aus gesehen wird; und es wäre immer noch überragend herrlich, wenn der Vorder- und Mittelgrund vollständig ausgelöscht wäre und nur die schwarzen Gipfel, die weißen Banner und der blaue Himmel übrig blieben.
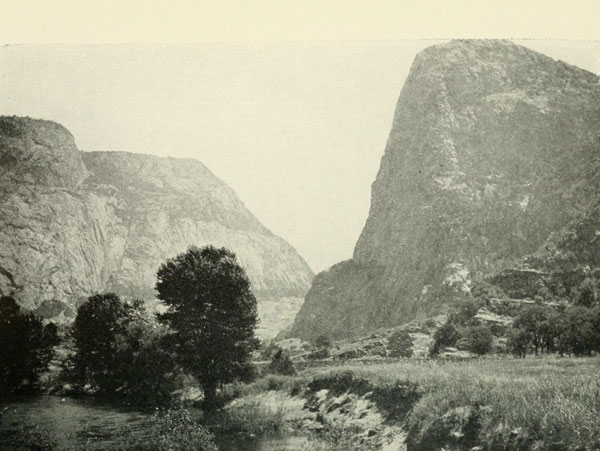
Wenn wir uns nun allgemein die Bildung von Schneefahnen ansehen, stellen wir fest, dass die Hauptursachen für die wunderbare Schönheit und Vollkommenheit der von uns betrachteten Fahnen die günstige Richtung und große Kraft des Windes, die Fülle an Schneestaub und die besondere Form der Berghänge waren. Es ist nicht nur wichtig, dass der Wind mit großer Geschwindigkeit und Beständigkeit weht, um einen ausreichend großen und kontinuierlichen Strom von Schneestaub zu erzeugen, sondern dass er auch aus dem Norden kommt. Ein Südwind kann nie eine perfekte Fahne über den Gipfeln der Sierra aufhängen. Hätte der Sturm an diesem Tag aus dem Süden geweht und wären die anderen Bedingungen unverändert geblieben, wäre nur eine trübe, verworrene, nebelartige Strömung entstanden; denn der Schnee wäre, anstatt in konzentrierten Strömen über die Gipfelspitzen geblasen und in Streifen ausgetragen zu werden, an den Seiten abgefallen und in den Gletscherschößen aufgehäuft worden. Die Ursache für die konzentrierte Wirkung des Nordwindes liegt in der besonderen Form der Nordseiten der Gipfel, wo sich die Amphitheater der Restgletscher befinden. Im Allgemeinen sind die Südseiten konvex und unregelmäßig, während die Nordseiten sowohl in ihren vertikalen als auch horizontalen Abschnitten konkav sind. Der Wind, der diese Kurven hinaufsteigt, konvergiert in Richtung der Gipfel und trägt den Schnee in konzentrierten Strömungen mit sich, schießt ihn fast senkrecht in die Luft über den Gipfeln, von wo er dann in horizontaler Richtung weggetragen wird.
Dieser Formunterschied zwischen der Nord- und der Südseite der Gipfel ist fast ausschließlich auf die unterschiedliche Art und Menge der Vereisung zurückzuführen, der sie ausgesetzt waren. Die Nordseiten wurden von Resten von Schattengletschern ausgehöhlt, die eine Form hatten, die auf den sonnenbeschienenen Seiten nie existierte.
Es scheint daher, dass Schatten nicht nur die Formen hoher, eisiger Berge maßgeblich bestimmen, sondern auch die der Schneefahnen, die der wilde Wind über sie hängt.
KAPITEL IV
EIN ANBLICK AUF DIE HIGH SIERRA AUS DER NÄHE
Früh an einem hellen Morgen mitten im Altweibersommer, als die Gletscherwiesen noch von den Frostkristallen bedeckt waren, brach ich vom Fuße des Mount Lyell auf, um hinunter ins Yosemite-Tal zu gehen, um meinen erschöpften Vorrat an Brot und Tee aufzufüllen. Den vergangenen Sommer hatte ich wie viele zuvor damit verbracht, die Gletscher an den Quellgewässern der Flüsse San Joaquin, Tuolumne, Merced und Owen zu erforschen. Ich hatte ihre Bewegungen, Neigungen, Spalten, Moränen usw. gemessen und studiert und die Rolle, die sie während ihrer größten Ausdehnung bei der Entstehung und Entwicklung der Landschaften dieses alpinen Wunderlandes gespielt hatten. Die Zeit für diese Art von Arbeit war für dieses Jahr fast vorbei und ich begann mich voller Entzücken auf den nahenden Winter mit seinen wundersamen Stürmen zu freuen, wenn ich warm, eingeschneit, mit viel Brot und Büchern in meiner Hütte im Yosemite-Tal sitzen würde; Doch ein Anflug von Bedauern überkam mich, als ich daran dachte, dass ich diese geliebte Region möglicherweise bis zum nächsten Sommer nicht wiedersehen würde, abgesehen von den Fernblicken von den Höhen über den Yosemite-Wänden.
Für Künstler sind strenggenommen nur wenige Teile der High Sierra malerisch. Die gesamte massive Erhebung der Bergkette ist ein einziges großes Bild, das nicht klar in kleinere unterteilbar ist; in dieser Hinsicht unterscheidet sie sich stark von den älteren und, wie man sagen könnte, reiferen Bergen der Coast Range. Alle Landschaften der Sierra wurden, wie wir gesehen haben, von Grund auf neu geboren und von den sich entwickelnden Eisfluten des letzten Eiswinters von der Basis bis zum Gipfel umgestaltet. Aber all diese neuen Landschaften entstanden nicht gleichzeitig; einige der höchsten, wo das Eis am längsten verweilte, sind zig Jahrhunderte jünger als die der wärmeren Regionen darunter. Generell gilt: Je jünger die Berglandschaften sind – jünger meine ich im Hinblick auf die Zeit ihres Auftauchens aus dem Eis der Eiszeit –, desto weniger lassen sie sich in künstlerische Teile zerlegen, aus denen warme, sympathische, liebenswerte Bilder mit spürbarer Menschlichkeit gemacht werden können.
Hier jedoch, an den Quellgewässern des Tuolumne, befindet sich eine Gruppe wilder Gipfel, von denen der Geologe sagen könnte, dass die Sonne gerade erst zu scheinen begonnen hat, die jedoch in hohem Maße malerisch sind und in ihren Grundzügen so regelmäßig und ausgewogen, dass sie beinahe konventionell erscheinen – eine düstere Ansammlung schneebedeckter Gipfel mit grauen, von Kiefern gesäumten Granitbossen, die sich um ihre Basis flechten, das Ganze erhebt sich frei in den Himmel vom Kopf eines herrlichen Tals, dessen hohe Wände auf beiden Seiten abgeschrägt sind, um es ganz zu umfassen, ohne etwas aufzunehmen, das nicht unbedingt dazugehört. Der Vordergrund strahlte jetzt in herbstlichen Farben, Braun und Purpur und Gold, reif im milden Sonnenschein; ein heller Kontrast zum tiefen Kobaltblau des Himmels und dem Schwarz und Grau und dem reinen, spirituellen Weiß der Felsen und Gletscher. Unten, in der Mitte, sah man den jungen Tuolumne aus seinen kristallklaren Fontänen strömen, mal in glasklaren Becken ruhen, als würde er sich wieder in Eis verwandeln, mal in weißen Kaskaden herabstürzen, als würde er sich in Schnee verwandeln; mal rechts und links zwischen Granitfelsen hindurchglitt, mal über die glatten, mit Wiesen bedeckten Ebenen des Tals dahinfegte, mal nachdenklich von einer Seite auf die andere schwankte, mit ruhigen, würdevollen Gesten an Weiden und Seggen vorbei und um Haine aus pfeilförmigen Kiefern herum; und während seines ganzen ereignisreichen Laufs, ob er nun schnell oder langsam floss, laut oder leise sang, erfüllte er die Landschaft stets mit spiritueller Belebung und offenbarte in jeder Bewegung und jedem Ton die Erhabenheit seiner Quellen.
Während ich meinen einsamen Weg durch das Tal fortsetzte, drehte ich mich immer wieder um, um das herrliche Bild zu betrachten, und streckte die Arme hoch, um es wie in einen Rahmen einzuschließen. Nach langen Zeitaltern des Wachstums in der Dunkelheit unter den Gletschern, bei Sonnenschein und Stürmen, schien es nun bereit zu sein und auf den auserwählten Künstler zu warten, wie gelber Weizen auf den Schnitter; und ich konnte den Wunsch nicht unterdrücken, dass ich auf meinen Reisen Farben und Pinsel mitnehmen und malen lernen könnte. In der Zwischenzeit musste ich mich mit Fotos in meinem Kopf und Skizzen in meinen Notizbüchern begnügen. Schließlich, nachdem ich eine steile Landzunge umrundet hatte, die sich von der Westwand des Tals aus erstreckt, verschwand jeder Gipfel aus meinem Blickfeld, und ich marschierte schnell über die gefrorenen Wiesen, über die Wasserscheide zwischen den Flüssen Merced und Tuolumne und hinunter durch die Wälder, die die Hänge von Cloud’s Rest bedecken, und kam rechtzeitig in Yosemite an - was bei mir jederzeit sein kann . Und seltsamerweise waren unter den ersten Leuten, die ich hier traf, zwei Künstler, die mit Empfehlungsschreiben auf meine Rückkehr warteten. Sie fragten, ob ich im Laufe meiner Erkundungen in den umliegenden Bergen jemals eine Landschaft entdeckt hätte, die sich für ein großes Gemälde eignete. Daraufhin begann ich mit der Beschreibung der Landschaft, die soeben meine Bewunderung erregt hatte. Als ich dann immer weiter in die Einzelheiten ging, begannen ihre Gesichter zu glühen, und ich bot ihnen an, sie dorthin zu führen, während sie erklärten, dass sie mir gerne folgen würden, egal ob nah oder fern, wohin auch immer ich Zeit erübrigen könnte, sie zu führen.
Da jederzeit ein Sturm das schöne Wetter durchbrechen und die Farben unter Schnee begraben sowie den Künstlern den Rückzugsort abschneiden könnte, riet ich dazu, sich sofort vorzubereiten.
Ich führte sie aus dem Tal an den Vernal und Nevada Falls vorbei, von dort über den Haupttrennungskamm zu den Big Tuolumne Meadows, auf dem alten Mono Trail und von dort am oberen Tuolumne River entlang bis zu seiner Quelle. Dies war der erste Ausflug meiner Gefährten in die High Sierra, und da ich beim Bergsteigen fast immer allein war, war die Art, wie sich die frische Schönheit in ihren Gesichtern widerspiegelte, für mich ein neuartiges und interessantes Studienobjekt. Natürlich waren sie am meisten von den Farben beeindruckt – dem intensiven Azurblau des Himmels, dem purpurnen Grau des Granits, dem Rot und Braun der trockenen Wiesen und dem durchscheinenden Purpur und Purpurrot der Heidelbeermoore, dem leuchtenden Gelb der Espenhaine, dem silbrigen Glitzern der Bäche und dem hellen Grün und Blau der Gletscherseen. Aber der Gesamteindruck der Landschaft – felsig und wild – schien traurig enttäuschend; und während sie den Wald von Bergrücken zu Bergrücken durchquerten und die Landschaften, die sich ihnen präsentierten, eifrig absuchten, sagten sie: „Das alles ist riesig und erhaben, aber wir sehen noch nichts, was für wirkungsvolle Bilder geeignet wäre. Kunst ist lang und Kunst ist begrenzt, wissen Sie; und hier gibt es Vordergründe, Mittelgründe, Hintergründe, alles gleich; kahle Felswellen, Wälder, Haine, winzige Wiesenflecken und Streifen glitzernden Wassers.“ „Macht nichts“, antwortete ich, „warten Sie nur ein bisschen, und ich werde Ihnen etwas zeigen, das Ihnen gefallen wird.“
Gegen Ende des zweiten Tages kam schließlich die Sierra Crown in Sicht, und als wir die vorgenannte vorspringende Landzunge umrundet hatten, offenbarte sich das ganze Bild im Glanz des Alpenglühens. Ihre Begeisterung war grenzenlos, und der Impulsivere der beiden, ein junger Schotte, stürmte vorwärts, rief und gestikulierte und warf seine Arme wie ein Verrückter in die Luft. Hier war endlich eine typische Alpenlandschaft.
Nachdem ich eine Weile die Aussicht genossen hatte, schlug ich mein Lager in einem geschützten Wäldchen etwas abseits der Wiese auf, wo man Kiefernzweige als Betten finden konnte und es reichlich trockenes Holz für Feuer gab, während die Künstler hier und da entlang der Flussbiegungen und an den Seiten des Canyons herumliefen und Vordergründe für ihre Skizzen aussuchten. Nach Einbruch der Dunkelheit, als unser Tee fertig war und ein stimmungsvolles Feuer entfacht worden war, begannen wir mit der Planung. Sie beschlossen, mindestens mehrere Tage zu bleiben, während ich beschloss, in der Zwischenzeit einen Ausflug zum unberührten Gipfel des Ritter zu machen.
Es war jetzt etwa Mitte Oktober, die Zeit der Schneeblumen. Die ersten Winterwolken waren bereits aufgegangen und die Gipfel waren mit frischen Kristallen übersät, ohne dass dies das Klettern jedoch in gefährlichem Ausmaß beeinträchtigt hätte. Und da das Wetter noch immer vollkommen ruhig war und die Entfernung zum Fuß des Berges nur etwas mehr als eine Tagesetappe betrug, hatte ich das Gefühl, dass ich nicht allzu sehr in Gefahr war, in einen Sturm zu geraten.
Mount Ritter ist der König der Berge im mittleren Teil der High Sierra, ebenso wie Shasta im Norden und Whitney im Süden. Außerdem wurde er meines Wissens noch nie bestiegen. Ich habe die angrenzende Wildnis Sommer für Sommer erkundet, aber meine bisherigen Studien hatten mich nie auf den Gipfel geführt. Er liegt etwa 13.300 Fuß über dem Meeresspiegel und ist von steilen Gletschern und Schluchten von enormer Tiefe und Schroffheit umgeben, die ihn fast unzugänglich machen. Aber Schwierigkeiten dieser Art begeistern den Bergsteiger nur.
Am nächsten Morgen machten sich die Künstler voller Tatendrang an ihre Arbeit und ich an meine. Aus früheren Erfahrungen wusste man, dass in dem ruhigen Sonnengold heftige Stürme brüten könnten, die noch unsichtbar waren. Deshalb warnte ich die Künstler vor meinem Abschied, nicht beunruhigt zu sein, falls ich nicht innerhalb einer Woche oder zehn Tagen erscheinen sollte. Ich riet ihnen, im Falle eines Schneesturms große Feuer zu unterhalten und sich so gut wie möglich zu schützen und auf keinen Fall Angst zu bekommen und zu versuchen, allein durch die Schneewehen den Weg zurück nach Yosemite zu suchen.
Mein grober Plan war einfach dieser: Ich wollte die Schlucht und die Mauer erklimmen, zur Ostflanke der Bergkette hinübergehen und mich dann unter Berücksichtigung der dazwischenliegenden Topographie nach Süden zu den nördlichen Ausläufern des Mount Ritter durchschlagen. Denn vom Lager aus direkt nach Süden durch die unzähligen Gipfel und Zinnen, die diesen Teil der Achse der Bergkette schmücken, würde, so interessant das auch wäre, zu viel Zeit in Anspruch nehmen und wäre außerdem zu dieser Jahreszeit äußerst schwierig und gefährlich.
Mein erster Tag war reines Vergnügen; ich überquerte die trockenen Pfade der alten Gletscher, folgte fröhlichen Bächen und lernte die Gewohnheiten der Vögel und Murmeltiere in den Wäldern und Felsen kennen. Noch bevor ich eine Meile vom Lager entfernt war, kam ich an den Fuß eines weißen Wasserfalls, der sich aus einer Höhe von etwa 270 Metern seinen Weg durch eine zerklüftete Schlucht in der Canyonwand bahnt und sein pulsierendes Wasser in den Tuolumne gießt. Ich kannte seine Quellen, die glücklicherweise auf meinem Weg lagen. Was für ein toller Reisegefährte er war, was für Lieder er sang und wie leidenschaftlich er von der Freude des Berges erzählte! Gerne kletterte ich an seinem stürmischen Ufer entlang, sog seine göttliche Musik in mich auf und badete von Zeit zu Zeit in den wehenden irisierenden Gischtwolken. Je höher ich stieg, desto mehr Schönheit erhellte den Blick: bunte Wiesen, spät blühende Gärten, Gipfel mit seltener Architektur, hier und da silbrig glänzende Seen und flüchtige Blicke auf die bewaldete Mittelregion und die gelben Tiefebenen weit im Westen. Jenseits der Bergkette sah ich die sogenannte Monowüste, die verträumt still in dichtem violettem Licht lag – eine Wüste mit grellem Sonnenlicht, die man von einer Wüste aus eispoliertem Granit aus erblickte. Hier teilen sich die Wasser, schreien in herrlicher Begeisterung und stürzen nach Osten, um im vulkanischen Sand und dem trockenen Himmel des Großen Beckens zu verschwinden, oder nach Westen ins Große Tal von Kalifornien und von dort durch die Bucht von San Francisco und das Golden Gate zum Meer.
Ich ging ein Stück den Gipfel hinunter, bis ich eine Höhe von etwa 10.000 Fuß erreicht hatte, und marschierte weiter nach Süden in Richtung einer Gruppe wilder Gipfel, die Ritter im Norden und Westen bewachen. Ich tastete mich vor und meisterte jedes Hindernis instinktiv, das sich mir bot. Hier kreuzte eine riesige Schlucht meinen Weg, an deren schwindelerregendem Rand ich entlangkletterte, bis ich einen weniger steilen Punkt entdeckte, an dem ich mich sicher nach unten wagen und dann, indem ich einen geeigneten Teil der gegenüberliegenden Wand auswählte, mit der gleichen langsamen Vorsicht wieder aufsteigen konnte. Massive, flache Ausläufer wechseln sich mit den Schluchten ab, stürzen abrupt von den Schultern der schneebedeckten Gipfel ab und graben sich in die warme Wüste ein. Sie waren überall mit den charakteristischen Skulpturen der urzeitlichen Gletscher versehen und geschmückt, die wie ein gewaltiger Eiswind über die gesamte Region hinwegfegten. Die durch die gewaltige Flut entstandenen polierten Oberflächen sind noch immer so perfekt erhalten, dass das von ihnen reflektierte Sonnenlicht vielerorts für die Augen ungefähr so anstrengend ist wie Schneeflächen.
Gottes Gletschermühlen mahlen langsam, aber sie sind in Kalifornien lange genug in Bewegung geblieben, um genügend Erde für eine herrliche Fülle an Leben zu mahlen, obwohl das meiste davon ins Tiefland verfrachtet wurde, wodurch diese Hochebenen verhältnismäßig mager und kahl geblieben sind; während die postglazialen Erosionskräfte auf der Gesamtoberfläche noch nicht genügend Nahrung für mehr als ein paar Büschel der widerstandsfähigsten Pflanzen geliefert haben, hauptsächlich Karisen und Eriogonen. Und es ist in diesem Zusammenhang interessant zu erfahren, dass die Spärlichkeit und Unterdrückung der Vegetation in dieser Höhe eher durch Bodenmangel als durch das raue Klima verursacht wird; denn hier und da finden wir in geschützten Mulden (unter der Oberfläche versenkt), in die einige Stangen gut gemahlener Moränensplitter geschüttet wurden, Fichten- und Kiefernhaine von dreißig bis vierzig Fuß Höhe, an den Rändern mit Weiden- und Heidelbeerbüschen und oft noch weiter von einem äußeren Ring aus hohen Gräsern gesäumt, in denen Lupinen, Rittersporne und prächtige Akelei blühen, was auf ein keineswegs erdrückend strenges Klima schließen lässt. Auch alle Bäche und Teiche in dieser Höhe sind mit kleinen Gärten ausgestattet, wo immer Erde liegen kann, die, obwohl sie aus der Ferne kaum sichtbar sind, für den aufmerksamen Beobachter reizende Überraschungen darstellen. In diesen kargen Stellen finden einige Vögel ein angenehmes Zuhause. Da sie den Menschen nicht kennen, fürchten sie nichts Böses und schwärmen neugierig um den Fremden herum, lassen sich fast auf die Hand nehmen. Ich verbrachte meinen ersten Tag in einer so wilden und wunderschönen Gegend. Jeder Anblick und jedes Geräusch war inspirierend, ließ einen weit aus sich herauskommen und nährte und stärkte zugleich die eigene Individualität.
Nun kam der feierliche, stille Abend. Lange, blaue, spitze Schatten krochen über die Schneefelder, während ein rosiges Glühen, das zunächst kaum wahrnehmbar war, allmählich tiefer wurde und jeden Berggipfel durchdrang und die Gletscher und die schroffen Felsen darüber erglühen ließ. Das war das Alpenglühen, für mich eine der eindrucksvollsten aller irdischen Manifestationen Gottes. Bei der Berührung mit diesem göttlichen Licht schienen die Berge ein verzücktes, religiöses Bewusstsein zu entwickeln und standen still und wartend wie fromme Anbeter. Kurz bevor das Alpenglühen zu verblassen begann, strömten zwei purpurrote Wolken wie Flammenflügel über den Gipfel und machten die erhabene Szene noch eindrucksvoller; dann kamen Dunkelheit und die Sterne.
Icy Ritter war noch meilenweit entfernt, aber ich konnte in dieser Nacht nicht weiter. Ich fand einen guten Lagerplatz am Rand eines Gletscherbeckens, etwa 3.300 Meter über dem Meeresspiegel. Auf dem Grund des Beckens liegt ein kleiner See, aus dem ich Wasser für meinen Tee holte, und ein sturmgepeitschtes Dickicht in der Nähe lieferte reichlich harziges Brennholz. Düstere, zerhackte und zersplitterte Gipfel kreisten halb um den Horizont und boten in der Dämmerung ein wildes Aussehen, und ein Wasserfall sang feierlich über den See, als er vom Fuß eines Gletschers herabstürzte. Der Wasserfall, der See und der Gletscher waren fast gleichermaßen kahl; während die dürren Kiefern, die in den Felsspalten verankert waren, so klein und von Sturmwinden so abgeschabt waren, dass man über ihre Wipfel hätte laufen können. In Ton und Aussehen war die Szene eine der trostlosesten, die ich je gesehen habe. Doch die dunkelsten Schriften der Berge sind mit hellen Passagen der Liebe erleuchtet, die sich immer dann bemerkbar machen, wenn man allein ist.
Ich machte mein Bett in einer Ecke des Kieferndickichts, wo die Zweige wie ein Dach über mir zusammengedrückt und gekräuselt waren und sich an den Seiten nach unten bogen. Dies sind die besten Schlafgemächer, die die hohen Berge bieten – gemütlich wie Eichhörnchennester, gut belüftet, voller würziger Gerüche und mit vielen vom Wind bewegten Nadeln, die einen in den Schlaf singen. Ich erwartete nicht viel Gesellschaft, aber als ich durch eine niedrige Seitentür hineinschlich, fand ich fünf oder sechs Vögel, die zwischen den Quasten nisteten. Der Nachtwind begann bald nach Einbruch der Dunkelheit zu wehen; zuerst nur ein sanftes Atmen, aber gegen Mitternacht wurde er zu einem rauen Sturm, der in unregelmäßigen Wellen wie eine Kaskade auf mein Blätterdach fiel und wilde Geräusche von den Felsen über mir herübertrug. Der Wasserfall sang im Chor, erfüllte den alten Eisbrunnen mit seinem feierlichen Brüllen und schien mit fortschreitender Nacht an Kraft zuzunehmen – eine passende Stimme für eine solche Landschaft. Ich musste nachts oft zum Feuer hinauskriechen, denn es war bitterkalt und ich hatte keine Decken. Freudig begrüßte ich den Morgenstern.
Der Morgen in der trockenen, flackernden Wüstenluft war herrlich. Alles ermutigte mich zu meinem Vorhaben und deutete auf Erfolg hin. Es war keine Wolke am Himmel, kein Sturmwind lag in der Luft. Das Frühstück mit Brot und Tee war bald fertig. Ich befestigte eine harte, haltbare Brotkruste an meinem Gürtel als Proviant für den Fall, dass ich gezwungen sein sollte, eine Nacht auf dem Berggipfel zu verbringen. Dann sicherte ich den Rest meines kleinen Vorrats vor Wölfen und Waldratten und machte mich frei und voller Hoffnung auf den Weg.
Welch herrlichen Gruß die Sonne den Bergen! Allein dies zu sehen, ist die Mühen jeder Wanderung tausendfach wert. Die höchsten Gipfel glühten wie Inseln in einem Meer aus flüssigem Schatten. Dann fingen die niedrigeren Gipfel und Türme das Glühen ein, und lange Lichtstrahlen, die durch viele Einschnitte und Pässe strömten, fielen dicht auf die gefrorenen Wiesen. Die majestätische Gestalt von Ritter war in voller Sicht, und ich marschierte rasch über abgerundete Felsvorsprünge und Gehwege, wobei meine eisenbeschlagenen Schuhe ein klirrendes Geräusch machten und plötzlich hin und wieder von Teppichen aus Bryanthus und von Moos weichen, mit Riedgras bedeckten Seeufern verstummen. Auch hier, in diesem sogenannten „Land der Trostlosigkeit“, begegnete ich Cassiope, die in Fransen zwischen den zerschmetterten Felsen wuchs. Ihre Blüten waren vor langer Zeit verblüht, aber sie klammerten sich noch mit glücklichen Erinnerungen an die immergrünen Zweige und waren noch immer so schön, dass sie jede Faser eines Menschen erschauern ließen. Winter wie Sommer kann man ihre Stimme hören, die leise, süße Melodie ihrer purpurnen Glocken. Kein anderes Berggewächs verkündet die Liebe der Natur deutlicher als die Kassiope. Wo sie lebt, ist die Erlösung aus der kältesten Einsamkeit vollkommen. Selbst Felsen und Gletscher scheinen ihre Gegenwart zu spüren und werden von der Süße ihrer Quelle durchdrungen. Alles erwärmte sich und erwachte. Gefrorene Bäche begannen zu fließen, die Murmeltiere kamen aus ihren Nestern in Felshaufen und kletterten auf sonnige Felsen, um sich zu sonnen, und die grauköpfigen Spatzen schwirrten umher und suchten nach ihrem Frühstück. Die Seen, die man von jedem Bergrücken aus sehen konnte, waren leuchtend gekräuselt und glitzernd und schimmerten wie das Dickicht der niedrigen Zwergkiefern. Auch die Felsen schienen auf die Lebenswärme zu reagieren – Bergkristalle und Schneekristalle waren gleichermaßen aufregend. Ich schritt beschwingt weiter, als würde ich nie wieder eine Müdigkeit verspüren. Meine Glieder bewegten sich wie von selbst, alle Sinne entfalteten sich wie auftauende Blumen, um an der Harmonie des neuen Tages teilzuhaben.
Auf meinem gesamten Weg bis hierher, außer in den Schluchten, war die Landschaft größtenteils offen und weitläufig, zumindest auf einer Seite. Links waren die violetten Ebenen von Mono, die verträumt und warm ruhten; rechts die nahen Gipfel, die mit immer eindrucksvollerer Erhabenheit scharf in den dünnen Himmel ragten. Aber diese weiteren Ausblicke gingen schließlich verloren. Schroffe Sporen und Moränen und riesige, vorspringende Strebepfeiler begannen mich einzuschließen. Jedes Merkmal wurde strenger alpin, ohne jedoch eine abschreckende Wirkung zu erzeugen; denn in die Berge zu gehen ist wie nach Hause zu kommen. Wir stellen immer fest, dass uns die seltsamsten Objekte in diesen Quellwildnissen in gewissem Maße vertraut sind, und wir betrachten sie mit dem vagen Gefühl, sie schon einmal gesehen zu haben.

Am südlichen Ufer eines zugefrorenen Sees stieß ich auf ein ausgedehntes Feld aus hartem, körnigem Schnee, das ich in aller Ruhe hinaufkletterte, um ihm bis zum Gipfel zu folgen und den Felsvorsprung zu überqueren, an den er sich anlehnt, in der Hoffnung, so direkt an den Fuß des Hauptgipfels von Ritter zu gelangen. Die Oberfläche war mit ovalen Vertiefungen übersät, die von Steinen und herumtreibenden Kiefernnadeln gebildet wurden, die durch die Strahlung der absorbierten Sonnenwärme in die Masse eingeschmolzen waren. Diese boten guten Halt, aber die Oberfläche krümmte sich am Gipfel immer steiler, und die Vertiefungen wurden flacher und seltener, bis ich Gefahr lief, wie eine Lawine abgeworfen zu werden. Ich kroch jedoch beharrlich auf allen Vieren voran und rutschte die glattesten Stellen auf meinem Rücken hinauf, wie ich es oft auf poliertem Granit getan hatte, bis ich, nachdem ich mehrere Male ausgerutscht war, gezwungen war, meinen Weg wieder auf den Grund zu gehen und um das Westende des Sees herumzugehen und von dort bis zur Spitze der Wasserscheide zwischen den Quellgewässern des Rush Creek und den nördlichsten Nebenflüssen des San Joaquin.
Als ich den Gipfel dieses Trennkamms erreichte, offenbarte sich mir eines der aufregendsten Stücke reiner Wildnis, das ich während meiner gesamten Bergsteigerkarriere je entdeckt habe. Dort, direkt vor mir, ragte die majestätische Masse des Mount Ritter auf, mit einem Gletscher, der sich an seiner Flanke fast bis zu meinen Füßen hinabsenkte, dann nach Westen abknickte und seine gefrorene Flut in einen dunkelblauen See ergoss, dessen Ufer von Abgründen aus kristallinem Schnee gesäumt waren; während eine tiefe Schlucht zwischen der Wasserscheide und dem Gletscher das gewaltige Bild von allem anderen trennte. Ich konnte nur den einen erhabenen Berg, den einen Gletscher, den einen See sehen; das Ganze war von einem einzigen blauen Schatten umhüllt – Fels, Eis und Wasser dicht beieinander, ohne ein einziges Blatt oder Lebenszeichen. Nachdem ich gebannt gestarrt hatte, begann ich instinktiv, jede Kerbe und Schlucht und jeden verwitterten Stützpfeiler des Berges zu untersuchen, um den Aufstieg zu planen. Die gesamte Front über dem Gletscher erschien wie ein gewaltiger Abgrund, der sich an der Spitze leicht zurückzog und mit Spitzen und Zinnen gespickt war, die in furchterregender Anordnung übereinander lagen. Massive, flechtenbefleckte Zinnen ragten hier und da hervor, an der Spitze mit eckigen Kerben versehen und durch frostige Schluchten und Nischen getrennt, die seit ihrer Entstehung im Schatten gehüllt waren; während sich rechts und links, soweit ich sehen konnte, riesige, zerbröckelnde Strebepfeiler befanden, die dem Kletterer keine Hoffnung boten. Der Kopf des Gletschers schickt ein paar fingerartige Äste durch enge Rinnen empor ; aber diese schienen zu steil und zu kurz, um nutzbar zu sein, besonders da ich keine Axt hatte, mit der ich Stufen schlagen konnte, und die zahlreichen schmalen Schluchten, in die Steine und Schnee rutschen, schienen hoffnungslos steil, außerdem von senkrechten Klippen unterbrochen; während die gesamte Front durch den kalten Schatten und die düstere Schwärze der Felsen noch schrecklicher wirkte.
Zögernd stieg ich die Wasserscheide hinab, bahnte mir meinen Weg über den gähnenden Abgrund am Fuße des Gletschers und kletterte hinaus auf den Gletscher. Es gab keine Wiesen mehr, die mit ihren kräftigen Farben aufheiterten, noch konnte ich die grauköpfigen Spatzen hören, deren fröhliche Rufe so oft die Stille unserer höchsten Berge unterbrechen. Die einzigen Geräusche waren das Gurgeln kleiner Rinnen in den Adern und Spalten des Gletschers und ab und zu das klappernde Geräusch fallender Steine, deren Echos in die frische Luft hinausschallten.
Ich konnte nicht wirklich hoffen, den Gipfel von dieser Seite aus zu erreichen, aber ich bewegte mich weiter über den Gletscher, als ob ich vom Schicksal getrieben wäre. Ich kämpfte mit mir selbst, die Saison sei zu weit fortgeschritten, sagte ich, und selbst wenn ich Erfolg hätte, könnte ich auf dem Berg von einem Sturm gefangen gehalten werden; und wie könnte ich in der Wolkenfinsternis, mit den schneebedeckten Klippen und Gletscherspalten entkommen? Nein, ich musste bis zum nächsten Sommer warten. Ich wollte mich jetzt nur dem Berg nähern und ihn inspizieren, an seinen Flanken entlangschleichen, so viel wie möglich über seine Geschichte erfahren und mich bereithalten, bei der Annäherung der ersten Sturmwolke zu fliehen. Aber wir wissen kaum, wie viel Unkontrollierbares in uns steckt, wenn wir uns über Gletscher und Sturzbäche und in gefährliche Höhen drängen, so sehr uns das Urteil auch verbieten mag, bis wir es ausprobiert haben.
Es gelang mir, den Fuß der Klippe am östlichen Ende des Gletschers zu erreichen, und dort entdeckte ich die Mündung einer schmalen Lawinenrinne, durch die ich zu klettern begann, mit der Absicht, ihr so weit wie möglich zu folgen und zumindest einige schöne wilde Aussichten für meine Mühen zu erhalten. Ihr allgemeiner Verlauf ist schräg zur Ebene der Bergwand, und die metamorphen Schiefer, aus denen der Berg besteht, sind durch Spaltflächen so geschnitten, dass sie in eckigen Blöcken abwittern, wodurch unregelmäßige Stufen entstehen, die das Klettern an den steilen Stellen erheblich erleichtern. So gelangte ich in eine Wildnis aus zerbröckelnden Türmen und Zinnen, die in verwirrenden Kombinationen aneinandergebaut und an vielen Stellen mit einer dünnen Eisschicht überzogen waren, die ich mit Steinen abschlagen musste. Die Situation wurde allmählich gefährlicher; aber nachdem ich mehrere gefährliche Stellen passiert hatte, wagte ich nicht, an einen Abstieg zu denken; denn der gesamte Aufstieg war so steil, dass man bei einem einzigen Fehltritt unweigerlich auf den Gletscher fallen würde. Da ich also die Gefahr unter mir kannte, machte ich mir umso mehr Sorgen um die Entwicklung, die sich oben abspielte, und begann mir einer vagen Vorahnung dessen bewusst zu werden, was tatsächlich geschehen würde; nicht, dass ich Angst hatte, sondern eher, weil meine normalerweise so sicheren und wahren Instinkte irgendwie verdorben schienen und mich in die Irre führten. Schließlich, nachdem ich eine Höhe von etwa 12.800 Fuß erreicht hatte, befand ich mich am Fuße eines steilen Abgrunds im Bett des Lawinenkanals, dem ich folgte, der mir ein weiteres Vorankommen absolut zu verwehren schien. Er war nur etwa 45 oder 50 Fuß hoch und etwas rau durch Spalten und Vorsprünge; aber diese schienen als Tritthilfe so schwach und unsicher, dass ich mich bemühte, den Abgrund ganz zu vermeiden, indem ich die Wand des Kanals auf beiden Seiten erklomm. Aber obwohl weniger steil, waren die Wände glatter als der hinderliche Fels, und wiederholte Versuche zeigten nur, dass ich entweder geradeaus weitermachen oder umkehren musste. Die Gefahren unter mir schienen noch größer als die der Klippe vor mir. Nachdem ich die Wand immer wieder abgesucht hatte, begann ich, sie zu erklimmen, wobei ich meine Griffe mit äußerster Vorsicht auswählte. Als ich etwa auf halber Höhe des Gipfels einen Punkt erreicht hatte, blieb ich plötzlich stehen. Mit ausgebreiteten Armen klammerte ich mich dicht an die Felswand und konnte weder Hände noch Füße nach oben oder unten bewegen. Mein Schicksal schien besiegelt. Ich musste fallen. Es würde einen Moment der Verwirrung geben, und dann ein lebloses Rumpeln den einzigen großen Abgrund hinunter zum Gletscher darunter.
Als mir diese letzte Gefahr bewusst wurde, war ich zum ersten Mal, seit ich die Berge betreten hatte, völlig durchgeschüttelt, und mein Geist schien sich mit erstickendem Rauch zu füllen. Doch diese schreckliche Finsternis dauerte nur einen Augenblick, dann flammte das Leben mit übernatürlicher Klarheit wieder auf. Ich schien plötzlich ein neues Gefühl zu haben. Das andere Ich, vergangene Erfahrungen, Instinkt oder Schutzengel – nennen Sie es, wie Sie wollen – traten hervor und übernahmen die Kontrolle. Dann wurden meine zitternden Muskeln wieder fest, jeder Riss und jeder Riss im Fels war wie durch ein Mikroskop zu sehen, und meine Glieder bewegten sich mit einer Bestimmtheit und Präzision, mit der ich scheinbar überhaupt nichts zu tun hatte. Wäre ich auf Flügeln in die Höhe getragen worden, hätte meine Rettung nicht vollkommener sein können.
Oberhalb dieser denkwürdigen Stelle ist die Bergwand noch wilder zerhackt und zerrissen. Sie ist ein Labyrinth aus gähnenden Abgründen und Schluchten, in deren Winkeln sich steile Klippen und Haufen losgelöster Felsbrocken erheben, die anscheinend darauf vorbereitet wurden, in die Tiefe geworfen zu werden. Doch der seltsame Kraftzufluss, den ich erhalten hatte, schien unerschöpflich. Ich fand mühelos einen Weg und stand bald im gesegneten Licht auf der obersten Klippe.
Wie herrlich war doch die Landschaft, die diesen edlen Gipfel umgab! Riesige Berge, unzählige Täler, Gletscher und Wiesen, Flüsse und Seen, über die sich der weite blaue Himmel sanft neigte. Doch in meiner ersten Stunde der Freiheit von diesem schrecklichen Schatten schien mir das Sonnenlicht, in dem ich schlief, alles in allem.
Wenn man entlang der Bergkette nach Süden blickt, fällt der Blick zunächst auf eine Reihe äußerst scharfkantiger und schlanker Spitzen, die sich offen bis zu einer Höhe von etwa 300 Metern über eine Reihe kurzer, verbliebener Gletscher erheben, die sich gegen ihre Basen lehnen. Ihre fantastische Skulptur und die ungebrochene Schärfe, mit der sie aus dem Eis hervorragen, machen sie besonders wild und eindrucksvoll. Dies sind die „Minarette“. Dahinter erblickt man eine erhabene Wildnis aus Bergen, deren schneebedeckte Gipfel sich in dichter Fülle dicht an dicht erheben, Gipfel an Gipfel, immer höher ragend, je weiter sie sich nach Süden erstrecken, bis der Höhepunkt der Bergkette am Mount Whitney erreicht ist, nahe der Quelle des Kern River, auf einer Höhe von fast 4.500 Metern über dem Meeresspiegel.
Im Westen sieht man, wie die Flanke der Bergkette in sanften Wellen von den scharfen Gipfeln abfällt; ein Meer aus riesigen grauen Granitwellen, übersät mit Seen und Wiesen und durchzogen von gewaltigen Schluchten, die in der Ferne immer tiefer werden. Unterhalb dieser grauen Region liegt die dunkle Waldzone, die hier und da von aufragenden Bergrücken und Kuppeln unterbrochen wird; und dahinter liegt ein gelber, dunstiger Gürtel, der die weite Ebene des San Joaquin markiert, die auf der anderen Seite von den blauen Bergen der Küste begrenzt wird.
Wenn wir uns nun nach Norden wenden, sehen wir im unmittelbaren Vordergrund die prächtige Sierra Crown mit dem Cathedral Peak, einem Tempel von wunderbarer Architektur, wenige Grad links davon. Rechts davon ragt die graue, massive Form des Mammoth Mountain empor, während die Mounts Ord, Gibbs, Dana, Conness, Tower Peak, Castle Peak, Silver Mountain und eine Vielzahl edler Begleiter, die noch keinen Namen haben, entlang der Achse der Bergkette einen erhabenen Anblick bieten.
Im Osten erscheint die ganze Region wie ein Land der Trostlosigkeit, das von herrlichem Licht überzogen ist. Das glühend heiße vulkanische Becken von Mono mit seinem einzigen, 23 Kilometer langen, kahlen See, das Owen Valley und die breite, mit Kratern übersäte Lava-Hochebene an seiner Spitze und die massive Inyo-Bergkette, die an Höhe sogar mit der Sierra mithalten kann, liegen wie eine Landkarte unter Ihnen ausgebreitet, und dahinter erstrecken sich zahllose Gebirgsketten, die aneinander vorbeiziehen, sich überlappen und am glühenden Horizont verschwinden.
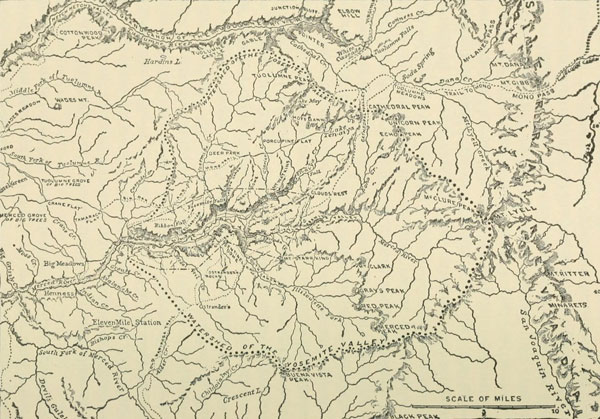
In einer Entfernung von weniger als 3000 Fuß unterhalb des Gipfels des Mount Ritter finden Sie Nebenflüsse des San Joaquin River und des Owen River, die aus dem Eis und Schnee der Gletscher hervorbrechen, die seine Flanken bedecken; während sich etwas nördlich davon die höchsten Zuflüsse des Tuolumne River und des Merced River befinden. Somit liegen die Quellen von vier der wichtigsten Flüsse Kaliforniens in einem Umkreis von vier bis fünf Meilen.
Man sieht Seen an allen möglichen Stellen schimmern – rund, oval oder quadratisch wie Spiegel; andere sind schmal und gewunden, dicht um die Gipfel gezogen wie Silberzonen, wobei die höchsten nur Felsen, Schnee und den Himmel widerspiegeln. Aber weder diese noch die Gletscher noch die hier und da vorkommenden Stücke brauner Wiesen und Moorland sind groß genug, um einen deutlichen Eindruck auf die mächtige Wildnis der Berge zu machen. Das Auge, das sich seiner Freiheit erfreut, schweift über die weite Fläche, kehrt aber immer wieder zu den Quellengipfeln zurück. Vielleicht erregt jemand aus der Menge besondere Aufmerksamkeit, ein gigantisches Schloss mit Türmchen und Zinnen oder eine gotische Kathedrale mit turmreicheren Türmen als die von Mailand. Aber im Allgemeinen ist der unerfahrene Beobachter, wenn er das erste Mal von einem allumfassenden Standpunkt wie diesem aus schaut, bedrückt von der unbegreiflichen Erhabenheit, Vielfalt und Fülle der Berge, die sich Schulter an Schulter außerhalb der Reichweite des Blicks erheben; und erst wenn man sie lange und liebevoll einzeln studiert hat, werden ihre weitreichenden Harmonien deutlich. Wenn man dann in die Wildnis vordringt, wo man kann, erkennt man schnell die wichtigsten, bezeichnenden Merkmale, denen die gesamte umgebende Topographie untergeordnet ist, und die kompliziertesten Gipfelgruppen offenbaren sich harmonisch korreliert und wie Kunstwerke geformt – beredte Monumente der alten Eisflüsse, die sie aus der Gesamtmasse des Gebirges hervortreten ließen. Auch die Canyons, von denen einige eine Meile tief sind und sich wild durch die mächtige Bergschar schlängeln, so gesetzlos und unkontrollierbar sie auf den ersten Blick auch erscheinen mögen, werden schließlich als notwendige Wirkungen von Ursachen erkannt, die in harmonischer Abfolge aufeinander folgten – in Steintafeln gehauene Gedichte der Natur – die einfachsten und nachdrücklichsten ihrer Gletscherkompositionen.
Wären wir während der Eiszeit hier gewesen, um dies zu beobachten, hätten wir einen ebenso faltigen Ozean aus Eis übersehen, wie er heute die Landschaften Grönlands bedeckt. Er füllt jedes Tal und jede Schlucht, und nur die Spitzen der Quellberge ragen dunkel über die felsbedeckten Eiswellen wie kleine Inseln in einem stürmischen Meer – diese Inseln sind die einzigen Hinweise auf die herrlichen Landschaften, die jetzt in der Sonne lächeln. Wenn man hier in der tiefen, brütenden Stille steht, scheint die ganze Wildnis bewegungslos, als wäre die Schöpfungsarbeit getan. Aber inmitten dieser äußeren Standhaftigkeit wissen wir, dass es unaufhörliche Bewegung und Veränderung gibt. Immer wieder fallen Lawinen von jenen Gipfeln. Diese von Klippen umschlossenen Gletscher, scheinbar verkeilt und unbeweglich, fließen wie Wasser und zermahlen die Felsen unter ihnen. Die Seen umspülen ihre Granitufer und tragen sie ab, und jeder dieser Bäche und jungen Flüsse vermischt die Luft mit Musik und trägt die Berge in die Ebenen. Hier liegen die Wurzeln allen Lebens in den Tälern, und hier zeigt sich der ewige Fluss der Natur einfacher als anderswo. Eis verwandelt sich in Wasser, Seen in Wiesen und Berge in Ebenen. Und während wir so über die Methoden der Natur zur Landschaftserschaffung nachdenken und die Aufzeichnungen lesen, die sie in die Felsen geritzt hat, und die Landschaften der Vergangenheit rekonstruieren, wenn auch unvollkommen, lernen wir auch, dass die Landschaften, die wir jetzt sehen, auf die der voreiszeitlichen Zeit folgten, und dass sie ihrerseits verwelken und verschwinden, um von anderen, noch ungeborenen, abgelöst zu werden.
Doch inmitten dieser schönen Lektionen und Landschaften musste ich daran denken, dass die Sonne weit im Westen stand und ich einen neuen Weg den Berg hinab zu einem Punkt an der Waldgrenze finden musste, wo ich ein Feuer machen konnte; denn ich hatte nicht einmal einen Mantel dabei. Zuerst suchte ich die westlichen Ausläufer ab, in der Hoffnung, dass sich ein Weg ergeben würde, über den ich den nördlichen Gletscher erreichen und seine Zunge überqueren oder den See, in den er mündet, umgehen und so meine Morgenspur finden könnte. Diese Route war bald so weit ausgearbeitet, dass sie, wenn überhaupt machbar, so viel Zeit in Anspruch nehmen würde, dass es unmöglich wäre, das Lager in dieser Nacht zu erreichen. Ich kletterte also zurück nach Osten und stieg dabei schräg die Südhänge hinab. Hier schienen die Klippen weniger gewaltig, und der Kopf eines Gletschers, der nach Nordosten fließt, kam in Sicht, dem ich so weit wie möglich folgen wollte, in der Hoffnung, so zum Fuß des Gipfels auf der Ostseite zu gelangen und von dort über die dazwischenliegenden Schluchten und Bergrücken zum Lager zu gelangen.
Die Neigung des Gletschers ist am oberen Ende recht moderat, und da die Sonne den Firn aufgeweicht hatte , kam ich sicher und schnell voran, rennend und rutschend, und immer nach Gletscherspalten Ausschau haltend. Etwa eine halbe Meile vom oberen Ende entfernt gibt es eine Eiskaskade, wo der Gletscher über einen steilen Abhang stürzt und in massive Blöcke zersplittert ist, die durch tiefe, blaue Spalten voneinander getrennt sind. Es schien unmöglich, mir meinen Weg durch das rutschige Labyrinth dieses Gletscherspaltenabschnitts zu bahnen, und ich versuchte, es zu vermeiden, indem ich auf den Bergrücken kletterte. Aber die Hänge wurden rasch steiler und fielen schließlich in steilen Abgründen ab, so dass ich wieder auf das Eis zurückkehren musste. Glücklicherweise war der Tag warm genug, um die Eiskristalle zu lockern, sodass sich in den morschen Teilen der Blöcke Hohlräume graben konnten, sodass ich meinen Weg mit weit weniger Schwierigkeiten finden konnte, als ich erwartet hatte. Der weitere Abstieg über die Bergzunge und entlang der linken Seitenmoräne erforderte nur einen gemütlichen Spaziergang und zeigte, dass der Aufstieg auf den Berg über diesen Gletscher leicht ist, vorausgesetzt, man ist mit einer Axt bewaffnet, um hier und da Stufen zu schlagen.
Das untere Ende des Gletschers war wunderschön gewellt und von den hervorstehenden Rändern der Eisschichten abgegrenzt. Diese repräsentieren die jährlichen Schneefälle und in gewissem Maße die strukturellen Unregelmäßigkeiten, die durch die Verwitterung der Gletscherspaltenwände und durch einzelne Schneefälle, auf die Regen, Hagel, Tauen und Gefrieren usw. folgten, verursacht wurden. Kleine Rinnen glitten und wirbelten in Kanälen aus reinem Eis über die schmelzende Oberfläche mit einem glatten, öligen Aussehen. Ihre schnellen, nachgiebigen Bewegungen bildeten den eindrucksvollsten Kontrast zu dem starren, unsichtbaren Fließen des Gletschers selbst, auf dessen Rücken sie alle ritten.
Bevor ich den östlichen Fuß des Berges erreichte, brach die Nacht herein, und mein Lager lag viele schroffe Meilen weiter nördlich; doch der endgültige Erfolg war gesichert. Jetzt war es nur noch eine Frage der Ausdauer und der üblichen Bergfertigkeit. Der Sonnenuntergang war, wenn möglich, noch schöner als der des Vortages. Die Landschaft des Mono schien von warmem, violettem Licht durchflutet zu sein. Die Gipfel, die sich entlang des Gipfels auftürmten, lagen im Schatten, doch durch jede Kerbe und jeden Pass strömte leuchtendes Sonnenfeuer, das ihre rauen, schwarzen Winkel besänftigte und bestrahlte, während Scharen kleiner, leuchtender Wolken wie wahre Lichtengel über ihnen schwebten.
Die Dunkelheit brach herein, aber ich fand meinen Weg an den Schluchten und den Gipfeln entlang, die sich gegen den Himmel abzeichneten. Alle Aufregung verging mit dem Licht, und dann war ich müde. Doch schließlich hörte ich das fröhliche Geräusch des Wasserfalls auf der anderen Seite des Sees, und bald sah ich die Sterne, die sich im See selbst spiegelten. Ich orientierte mich daran, entdeckte das kleine Kieferndickicht, in dem mein Nest war, und machte dann eine Pause, wie sie nur ein müder Bergsteiger genießen kann. Nachdem ich eine Weile ziellos und verloren dagelegen hatte, machte ich ein Sonnenaufgangsfeuer, ging zum See hinunter, spritzte mir Wasser über den Kopf und tauchte eine Tasse Tee hinein. Die Erfrischung durch Brot und Tee war ebenso vollständig wie die Erschöpfung durch übermäßigen Genuss und Mühe. Dann kroch ich unter den Kiefernquasten ins Bett. Der Wind war frostig und das Feuer brannte schwach, aber mein Schlaf war nichtsdestotrotz fest, und die abendlichen Sternbilder waren weit nach Westen gefegt, bevor ich aufwachte.
Nachdem ich aufgetaut war und mich in der Morgensonne ausgeruht hatte, schlenderte ich nach Hause, das heißt zurück zum Tuolumne-Lager, und hielt in Richtung einer Gruppe von Gipfeln, die den Quellschnee eines der nördlichen Nebenflüsse des Rush Creek enthalten. Hier entdeckte ich eine Gruppe wunderschöner Gletscherseen, die in einem großen Amphitheater aneinandergereiht waren. Gegen Abend überquerte ich die Wasserscheide, die die Gewässer des Mono von denen des Tuolumne trennt, und betrat das Gletscherbecken, das jetzt den Quellschnee des Bachs enthält, der die oberen Tuolumne-Kaskaden bildet. Diesem Bach folgte ich durch seine vielen Täler und Schluchten, Wiesen und Sümpfe und erreichte in der Abenddämmerung den Rand des Hauptflusses des Tuolumne.
Ein lautes Jubeln nach den Künstlern wurde immer wieder beantwortet. Ihr Lagerfeuer kam in Sicht und eine halbe Stunde später war ich bei ihnen. Sie schienen übermäßig froh, mich zu sehen. Ich war nur drei Tage weg gewesen; trotzdem hatten sie, obwohl das Wetter schön war, bereits abgewogen, ob ich jemals zurückkehren würde, und versucht, zu entscheiden, ob sie noch länger warten oder sich auf den Weg zurück ins Tiefland machen sollten. Nun waren ihre seltsamen Probleme vorbei. Sie packten ihre wertvollen Skizzen ein und am nächsten Morgen machten wir uns auf den Heimweg und erreichten in zwei Tagen das Yosemite Valley von Norden her über den Indian Cañon.
KAPITEL V
DIE PASSE
Die anhaltende Erhabenheit der High Sierra wird eindrucksvoll durch die enorme Höhe der Pässe veranschaulicht. Zwischen 36° 20’ und 38° Breite liegt der niedrigste Pass, die niedrigste Lücke, Schlucht oder Kerbe jeglicher Art, die die Achse der Bergkette durchschneidet, soweit ich herausgefunden habe, über 9000 Fuß über dem Meeresspiegel; während die Durchschnittshöhe aller von Indianern oder Weißen genutzten Pässe vielleicht nicht weniger als 11.000 Fuß beträgt und keiner davon ein Kutschenpass ist.
Weiter nördlich wurde eine Kutschenstraße über den sogenannten Sonora-Pass an den Quellgewässern der Flüsse Stanislaus und Walker gebaut, deren Gipfel etwa 10.000 Fuß über dem Meeresspiegel liegt. Auch über die Pässe Carson und Johnson nahe der Quelle des Lake Tahoe wurden bedeutende Wagenstraßen gebaut, über die vor dem Bau der Central Pacific Railroad riesige Mengen Fracht von Kalifornien in die Bergbauregionen Nevadas transportiert wurden.
Noch weiter nördlich gibt es eine beträchtliche Anzahl vergleichsweise niedriger Pässe, von denen einige mit Rädern befahrbar sind. Durch diese schroffen Engpässe mühten sich während der aufregenden Jahre der Goldzeit lange Auswandererzüge mit fußkrankem Vieh mühsam. Nachdem die von der Arbeit erschöpften Abenteurer tausenden Gefahren entgangen waren und Tausende von Meilen über die Ebenen gekrochen waren, tauchte endlich die schneebedeckte Sierra auf, die östliche Mauer des Landes des Goldes. Und als sie mit beschatteten Augen durch den zitternden Dunst der Wüste blickten, mit welcher Freude müssen sie den Pass erblickt haben, durch den sie das bessere Land ihrer Hoffnungen und Träume betreten sollten!
Zwischen dem Sonorapass und dem südlichen Ende der High Sierra, eine Entfernung von fast 160 Meilen, gibt es nur fünf Pässe, über die Pfade von einer Seite der Bergkette zur anderen führen. Diese sind für Tiere kaum passierbar; ein Pass ist in diesen Regionen einfach jede Kerbe oder Schlucht, durch die man mit grenzenloser Geduld ein Maultier oder einen trittsicheren Mustang führen kann; Tiere, die ebenso gut rutschen oder springen wie laufen können. Nur drei der fünf Pässe werden als begehbar bezeichnet, nämlich der Kearsarge, der Mono und der Virginia Creek; die Pfade, die durch die anderen führen, sind nur undeutliche Indianerpfade, die überhaupt nicht geebnet und für Weiße kaum nachvollziehbar sind; denn ein Großteil des Weges führt über massives Gestein und Erdbebenlawinenschutt, wo die unbeschlagenen Ponys der Indianer keine nennenswerten Spuren hinterlassen. Nur erfahrene Bergsteiger sind in der Lage, die Markierungen zu erkennen, die den Indianern als Orientierung dienen, wie leichte Abschürfungen des lockeren Gesteins, hier und da verschobene Steine und gebogene Büsche und Unkraut. Eine allgemeine Kenntnis der Topographie ist also der wichtigste Wegweiser, um zu bestimmen, wohin die Spur führen sollte – oder muss . Einer dieser Indianerpfade überquert die Bergkette auf einem namenlosen Pass zwischen den Quellgewässern des südlichen und mittleren Arms des San Joaquin, der andere zwischen dem nördlichen und mittleren Arm des gleichen Flusses, gleich südlich der „Minarette“. Letzterer ist mit etwa 9000 Fuß Höhe der niedrigste der fünf. Der Kearsarge ist der höchste und überquert den Gipfel nahe der Quelle des südlichen Arms des King’s River, etwa acht Meilen nördlich des Mount Tyndall, inmitten einer erstaunlichen Felslandschaft. Die Spitze dieses Passes liegt über 12.000 Fuß über dem Meeresspiegel. Dennoch ist er einer der sichersten der fünf und wird jeden Sommer von Juli bis Oktober oder November von Jägern, Goldsuchern und Viehbesitzern und in gewissem Maße auch von unternehmungslustigen Vergnügungssuchenden genutzt. Denn neben der überragenden Pracht der Landschaft rund um den Gipfel führt der Weg, der die Westflanke der Bergkette hinaufführt, durch einen Hain aus Riesenmammutbäumen und durch das herrliche Yosemite-Tal am südlichen Arm des King’s River. Dies ist vielleicht der höchstgelegene befahrene Pass auf dem nordamerikanischen Kontinent.
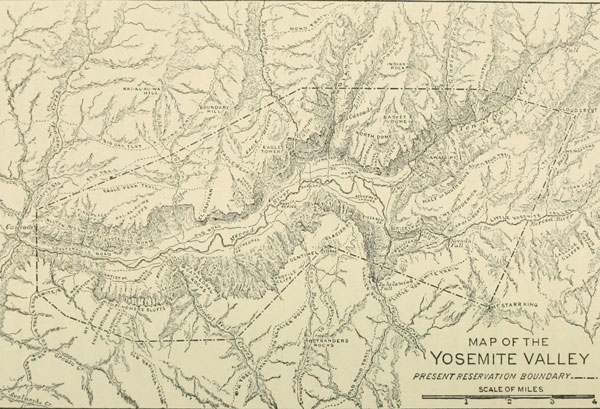
Der Monopass liegt östlich des Yosemite Valley, an der Spitze eines der Nebenflüsse des südlichen Arms des Tuolumne. Er ist der bekannteste und am meisten begangene Pass in der High Sierra. Etwa zur Zeit des Mono-Goldrauschs im Jahr 1858 wurde von abenteuerlustigen Bergleuten und Prospektoren ein Pfad durch ihn angelegt – Männer, die auf dem Weg zum Gold einen Pfad durch die Schlucht des dunkelsten Erebus bauten. Obwohl er mehr als 300 Meter niedriger liegt als der Kearsarge, ist seine Felslandschaft kaum weniger erhaben, während er ihn an schneebedecktem, herabstürzendem Wasser bei weitem übertrifft. Da er so günstig für den Yosemite-Reisestrom liegt, überqueren die abenteuerlustigeren Touristen ihn durch dieses herrliche Tor zur Vulkanregion um den Mono Lake. Er hat sich daher einen Namen und Ruhm mehr erworben als jeder andere Pass in der Bergkette. Nach den wenigen barometrischen Messungen, die auf ihm durchgeführt wurden, liegt sein höchster Punkt 3260 Meter über dem Meeresspiegel. Der andere der fünf Pässe, die wir betrachtet haben, liegt etwas tiefer und kreuzt die Achse der Bergkette ein paar Meilen nördlich des Monopasses, an der Quelle des südlichsten Nebenflusses des Walker River. Er wird hauptsächlich von wandernden Gruppen der Pah-Ute-Indianer und „Schafzüchtern“ benutzt.
Aber wenn man Räder und Tiere außer Acht lässt, kann der freie Bergsteiger mit einem Sack Brot auf den Schultern und einer Axt, um Stufen in Eis und gefrorenen Schnee zu schlagen, die Bergkette fast überall und zu jeder Jahreszeit überqueren, wenn das Wetter ruhig ist. Für ihn ist fast jede Kerbe zwischen den Gipfeln ein Pass, obwohl manchmal viel geduldiges Stufenschlagen auf und ab steil abfallenden Gletschern erforderlich ist und vorsichtiges Klettern über Abgründe, die auf den ersten Blick hoffnungslos unzugänglich erscheinen.
Im Rahmen meiner Studien bin ich im Abstand von einigen Meilen die Bergkette von einer Seite zur anderen entlang des höchsten Teils der Kette gewandert, wobei ich weit weniger Gefahren ausgesetzt war, als man normalerweise erwarten würde. Und welche wunderbare Wildnis sich mir dabei offenbarte – Stürme und Lawinen, Seen und Wasserfälle, Gärten und Wiesen und interessante Tiere – werden nur diejenigen jemals erfahren, die den freiesten und aufregendsten Teil ihres Lebens dem Klettern und dem eigenen Sehen widmen.
Für den schüchternen Reisenden, der gerade aus den Sedimentschichten des Tieflandes gekommen ist, erscheinen diese Straßen, so malerisch und großartig sie auch sein mögen, furchtbar abschreckend – kalte, tote, düstere Einschnitte in den Knochen der Berge und von allen Wegen der Natur die, die man am vorsichtigsten meiden sollte. Doch sie sind voll von den schönsten und eindrucksvollsten Beispielen der Liebe der Natur; und obwohl sie schwer zu bereisen sind, ist keiner sicherer. Denn sie führen durch Regionen, die weit über den üblichen Schlupfwinkeln des Teufels und der Pest liegen, die im Dunkeln wandelt. Es stimmt, es gibt unzählige Orte, an denen der unvorsichtige Schritt der letzte Schritt sein wird; und ein von den Klippen fallender Stein kann ohne Vorwarnung wie ein Blitz vom Himmel einschlagen; aber was dann? Unfälle sind in den Bergen seltener als in den Niederungen, und diese Bergvillen sind anständige, entzückende, ja sogar göttliche Orte zum Sterben, verglichen mit den traurigen Kammern der Zivilisation. Nur wenige Orte auf dieser Welt sind gefährlicher als die Heimat. Scheuen Sie sich daher nicht, die Bergpässe auszuprobieren. Sie werden die Sorgen beseitigen, Sie aus tödlicher Apathie befreien und jede Fähigkeit zu energischer, enthusiastischer Tätigkeit anregen. Sogar Kranke sollten diese sogenannten gefährlichen Wege ausprobieren, denn für jeden Unglücklichen, den sie töten, heilen sie tausend.
Alle Pässe haben ihre steilsten Anstiege an der Ostflanke. Auf dieser Seite beträgt der durchschnittliche Anstieg nicht weit von 300 m pro Meile, während er im Westen etwa 60 m beträgt. Ein weiterer deutlicher Unterschied zwischen den östlichen und westlichen Teilen der Pässe besteht darin, dass erstere am Fuße der Bergkette beginnen, während letztere kaum tiefer als auf einer Höhe von 2.000 bis 3.000 m beginnen. Nähert sich der Reisende der Bergkette von den grauen Ebenen von Mono und Owen’s Valley im Osten, sieht er die steilen, kurzen Pässe in voller Sicht vor sich, eingezäunt von schroffen Ausläufern, die von den Schultern der Gipfel auf beiden Seiten herabstürzen, wobei die direkteren Pässe von oben bis unten ohne Unterbrechung sichtbar sind. Aber von Westen aus sieht man nichts von dem Weg, den man vielleicht sucht, bis man sich dem Gipfel nähert, nachdem man Tage damit verbracht hat, durch die Wälder zu streifen, die auf den Haupttrennungskämmen zwischen den Flussschluchten wachsen.
Es ist interessant zu beobachten, wie sicher die die Alpen überquerenden Tiere aller Art auf denselben Pfaden landen. Je schroffer und unzugänglicher die Topographie einer bestimmten Region im Allgemeinen ist, desto wahrscheinlicher werden die Pfade der Weißen, Indianer, Bären, Wildschafe usw. in den besten Pässen zusammenlaufen. Die Indianer der Westhänge wagen sich bei ruhigem Wetter vorsichtig über die Pässe, um an Tänzen teilzunehmen und Unmengen von Pinienkernen und den Larven einer kleinen Fliege zu erbeuten, die in den Seen Mono und Owen brütet und getrocknet ein wichtiges Nahrungsmittel darstellt; während die Pah-Utes von Osten herüberkommen, um Hirsche zu jagen und sich mit Eicheln zu versorgen; und es ist wirklich erstaunlich zu sehen, welche ungeheuren Lasten die abgezehrten alten Squaws barfuß durch diese rauen Pässe tragen, oft über eine Entfernung von sechzig oder siebzig Meilen. Begleitet werden sie stets von den Männern, die unbelastet und aufrecht ein wenig voraus schreiten und sich an schwierigen Stellen gütig bücken, um für ihre geduldigen Lasttierfrauen Trittsteine aufzuschichten, so wie sie für ihre Ponys den Weg bereiten würden.
Bären beweisen als Bergsteiger große Scharfsinnigkeit, aber obwohl sie unermüdliche und unternehmungslustige Reisende sind, überqueren sie die Bergkette selten. Ich habe sie mehrmals durch den Monopass verfolgt, aber erst in den letzten Jahren, nachdem Rinder und Schafe diesen Weg gegangen waren, als sie ihnen zweifellos folgten, um die Nachzügler und diejenigen zu fressen, die beim Sturz über die Felsen getötet worden waren. Sogar die Wildschafe, die besten Bergsteiger von allen, wählen für ihre Wanderungen über die Gipfel regelmäßige Pässe. Hirsche überqueren die Bergkette selten in beide Richtungen. Ich habe noch nie ein einziges Exemplar des Maultierhirsches des Großen Beckens westlich des Gipfels beobachtet und selten eine der schwarzschwanzigen Arten am Osthang, obwohl viele von ihnen jeden Sommer die Bergkette fast bis zum Gipfel erklimmen, um in den wilden Gärten zu fressen und ihre Jungen zur Welt zu bringen.
Die Gletscher sind die Pässebauer, und sie bestimmen die Routen aller Bergsteiger. Ausnahmslos jeder Pass in der Sierra wurde von ihnen geschaffen, ohne die geringste Hilfe oder vorherbestimmende Führung durch irgendeine der kataklysmischen Kräfte. Ich habe ausführliche Berichte über die Menge an Bohr- und Sprengarbeiten gesehen, die beim Bau der Eisenbahn über die Sierra oberhalb des Donner Lake durchgeführt wurden; aber für jedes Pfund Gestein, das auf diese Weise bewegt wurde, zerschmetterten und zerstreuten die Gletscher, die nach Osten und Westen durch denselben Pass abstiegen, mehr als hundert Tonnen.
Bei den sogenannten befahrbaren Straßenpässen handelt es sich einfach um jene Teile der Bergkette, die durch die Gletschereinwirkung stärker erodiert sind als die angrenzenden Teile, und zwar in einer Weise, dass die Gipfel abgerundet statt spitz zulaufend sind; während die Gipfel aufgrund der größeren Festigkeit und Härte ihres Gesteins oder ihrer günstigeren Lage weniger erodiert sind und daher über den Pässen aufragen, als wären sie durch eine von unten einwirkende Kraft in den Himmel gehoben worden.
Die Landschaft aller Pässe, insbesondere am oberen Ende, ist von wildester und grandioser Schönheit: hohe Gipfel, die sich aneinander drängen und an ihren Füßen mit Eis und Schnee beladen sind; Ketten von Gletscherseen; kaskadenartige Flüsse in endloser Vielfalt, mit herrlichen Ausblicken, nach Westen über ein Meer aus Felsen und Wäldern und nach Osten über seltsame aschebedeckte Ebenen, Vulkane und die trockenen, tot aussehenden Gebirgszüge des Großen Beckens. Jeder Pass besitzt jedoch seine ganz eigenen Schönheiten.
Nachdem ich so in allgemeiner Weise die Höhe, die wichtigsten Merkmale und die Verteilung der wichtigsten Pässe aufgezeigt habe, werde ich nun versuchen, den Monopass im Besonderen zu beschreiben, der meiner Meinung nach als ein gutes Beispiel für die höheren Alpenpässe im Allgemeinen angesehen werden kann.
Der Hauptabschnitt des Mono Pass wird vom Bloody Cañon gebildet, der auf dem Gipfel der Bergkette beginnt und in etwa ostnordöstlicher Richtung bis zum Rand der Mono Plain verläuft.
Die ersten Weißen, die sich einen Weg durch seine düsteren Tiefen bahnten, waren, wie wir gesehen haben, eifrige Goldsucher. Aber der Canyon war den Indianern und Bergtieren schon lange vor seiner Entdeckung durch die Weißen als Pass bekannt und wurde von ihnen bereist, wie die zahlreichen Nebenpfade zeigen, die aus allen Richtungen in ihn hineinführen. Sein Name passt gut zum Charakter der „frühen Zeiten“ in Kalifornien und wurde vielleicht durch die vorherrschende Farbe der metamorphen Schiefer angedeutet, aus denen er größtenteils erodiert ist; oder wahrscheinlicher durch die Blutflecken der unglücklichen Tiere, die gezwungen waren, unbeholfen über seine rauen, schneidenden Felsen zu rutschen und zu schlurfen. Ich habe nie ein Tier, weder Maultier noch Pferd, erlebt, das sich seinen Weg durch den Canyon bahnte, weder beim Auf- noch beim Abstieg, ohne mehr oder weniger Blut aus Wunden an den Beinen zu verlieren. Gelegentlich wird eines auf der Stelle getötet – es stürzt kopfüber und rollt wie ein Felsbrocken über Abgründe. Doch solche Unfälle sind seltener, als man angesichts des schrecklichen Aussehens des Pfades erwarten würde; die Erfahreneren finden, wenn sie losgelassen werden, ihren Weg über die gefährlichen Stellen mit einer Vorsicht und Klugheit, die wirklich bewundernswert ist. Während der Goldjagd war es zeitweise eine Angelegenheit von beträchtlicher finanzieller Bedeutung, sich im Frühjahr mit Packzügen einen Weg durch die Schlucht zu bahnen, als sie noch schwer mit Schnee bedeckt war; und dann mussten die Maultiere mit ihrer Last manchmal mit Seilen über die steilsten Schneewehen und Lawinenbetten hinabgelassen werden.
Ein guter Reitweg führt von Yosemite durch viele Wäldchen und Wiesen bis zum Kopf des Canyons, eine Entfernung von etwa 50 Kilometern. Hier erfährt die Landschaft eine plötzliche und überraschende Verdichtung. Rote, graue und schwarze Berge erheben sich dicht neben uns auf der rechten Seite, an ihren Füßen weiß von Bänken aus dauerhaftem Schnee; links schwillt die riesige rote Masse des Mount Gibbs an, während vorn der Blick den schattigen Canyon hinab und hinaus auf die warme Ebene von Mono wandert, wo der See wie eine polierte Metallscheibe glänzt, mit Ansammlungen hoher Vulkankegel südlich davon.
Als wir schließlich das Bergtor betreten, scheinen die düsteren Felsen unsere Anwesenheit zu bemerken und sich immer dichter um uns zu drängen. Glücklicherweise sind die Amsel und das altbekannte Rotkehlchen hier, um uns willkommen zu heißen, und azurblaue Gänseblümchen strahlen Vertrauen und Sympathie aus, sodass wir selbst hier, unter dem Blick ihrer kältesten Felsen, etwas von der Liebe der Natur spüren können.
Die Wirkung dieser ausdrucksstarken Offenheit der Canyon-Felsen wird durch den ruhigen Anblick der alpinen Wiesen, die wir kurz vor dem Betreten des schmalen Tores durchqueren, noch verstärkt. Die Wälder, in denen sie liegen, und die Berggipfel, die sich dahinter erheben, wirken ruhig und still. Wir spüren ihre erholsame Stimmung, geben uns dem wohltuenden Einfluss des Sonnenscheins hin und schlendern verträumt durch Blumen und Bienen, kaum berührt von einem bestimmten Gedanken; dann finden wir uns plötzlich im schattigen Canyon wieder, eingeschlossen in die Natur in einer ihrer wildesten Festungen.
Nachdem der erste verwirrende Eindruck nachlässt, merken wir, dass es nicht ganz so schrecklich ist; denn neben den beruhigenden Vögeln und Blumen entdecken wir eine Kette von glitzernden kleinen Seen, die vom Gipfel des Passes herabhängen und durch einen silbrigen Bach miteinander verbunden sind. Die höchsten liegen in öden, rauen Mulden, spärlich gesäumt von braunen und gelben Seggen. Winterstürme treiben Schnee in blendenden Verwehungen durch die Schlucht, und Lawinen schießen von den Höhen herab. Dann werden diese glitzernden Bergseen aufgefüllt und begraben, ohne dass eine Spur ihrer Existenz zurückbleibt. Im Juni und Juli beginnen sie zu blinzeln und aufzutauen wie schläfrige Augen, die Karisen strecken ihre kurzen braunen Spitzen in die Höhe, die Gänseblümchen blühen abwechselnd, und der am tiefsten begrabene von allen wird schließlich erwärmt und besommelt, als wäre der Winter nur ein Traum.
Red Lake ist der niedrigste und zugleich größte der Kette. Auf den ersten Blick wirkt er ziemlich langweilig und abweisend, wie er reglos in seinem tiefen, dunklen Bett liegt. Die Canyonwand erhebt sich steil vom Wasserrand im Süden, aber auf der gegenüberliegenden Seite gibt es genügend Platz und Sonnenschein für einen mit Riedgras bewachsenen Gänseblümchengarten, dessen Mitte hell erleuchtet ist mit Lilien, Kastilien, Rittersporn und Akelei, durch belaubte Weiden vor dem Wind geschützt und eine äußerst freudige Ausweitung des Pflanzenlebens bildet, die durch die kalte Kahlheit der gegenüberliegenden Klippen noch deutlich hervorgehoben wird.
Nachdem er sich hier einer dösenden, schimmernden Seeruhe hingegeben hat, macht sich der fröhliche Strom wieder auf den Weg, trillert und trillert wie eine Amsel und ist immer wunderbar zutraulich, ganz gleich, wie dunkel der Weg ist. Er springt, gleitet, hierhin und dorthin, klar oder schäumend: Und in jedem Laut und jeder Geste offenbart er die Schönheit seiner Wildheit.
Eine seiner schönsten Entwicklungen ist die Diamond Cascade, die ein kurzes Stück unterhalb des Red Lake liegt. Hier wird das gespannte, kristallklare Wasser zunächst in grobkörnigen Sprühnebel gemischt mit staubigem Schaum gestürzt und dann in ein Rautenmuster aufgeteilt, indem es den diagonalen Spaltfugen folgt, die die Oberfläche des Abgrunds durchschneiden, über den es strömt. Von vorne betrachtet ähnelt es einem Streifen Stickerei mit einem bestimmten Muster, das sich im Laufe der Jahreszeiten mit der Temperatur und der Wassermenge verändert. An seinem schneebedeckten Rand sieht man kaum eine Blume. Ein paar gebogene Kiefern blicken aus der Ferne darauf, und kleine Büschel aus Cassiope und Felsenfarnen wachsen in Spalten in der Nähe des Wasserfalls, aber diese sind so niedrig und unauffällig, dass sie wahrscheinlich nur der aufmerksame Beobachter bemerken wird.
An der Nordwand des Canyons, etwas unterhalb der Diamond Cascade, taucht ein glitzernder Seitenstrom auf, der direkt aus dem Himmel zu springen scheint. Er ähnelt zunächst einem zerknitterten Silberband, das lose an der Wand herabhängt, wird aber beim Abstieg breiter und bespritzt den stumpfen Felsen mit Schaum. Ein langer, rauer Schutt wölbt sich an diesem Teil der Klippe hoch, überwuchert mit schneebedeckten Weiden, in dem der Wasserfall mit vielen eifrigen Wogen, Wirbeln und plätschernden Sprüngen verschwindet und sich schließlich seinen Weg nach unten bahnt, bis er in den Hauptstrom des Canyons mündet.
Unterhalb dieses Punktes ist das Klima nicht mehr arktisch. Schmetterlinge werden größer und zahlreicher, Gräser mit imposanter Rispenausbreitung wiegen sich über Ihren Schultern und das sommerliche Summen der Hummeln verdichtet die Luft. Die Zwergkiefer, der Baumbergbewohner, der am höchsten klettert und den kältesten Winden trotzt, findet man verstreut in sturmgepeitschten Büscheln vom Gipfel des Passes etwa auf halber Höhe des Canyons. Hier wird sie von der robusten Zweiblättrigen
Kiefer abgelöst, zu der sich schnell die größeren Gelb- und Bergkiefern gesellen. Diese werden zusammen mit dem stämmigen Wacholder und der schimmernden Espe schnell größer, wenn das Sonnenlicht intensiver wird, und bilden Haine, die die Sicht versperren; oder sie stehen hier und da weiter auseinander in malerischen Gruppen, die eine schöne und offensichtliche Harmonie mit den Felsen und untereinander bilden. Das Unterholz blüht im Überfluss – Azaleen, Spiersträucher und Hagebutten
flechten Fransen für die Bäche und zottelige Teppiche bieten den strengen, unerschrockenen Felsvorsprüngen Linderung.

Durch diese liebliche Wildnis schlängelt sich der Cañon Creek ohne einschränkende Kanäle, pulsierend und schwankend, mal im Sonnenschein, mal im nachdenklichen Schatten, fallend, wirbelnd, blitzend von einer Seite zur anderen in unermüdlicher Überschwänglichkeit von Energie. So entwickelt sich eine herrliche Milchstraße aus Wasserfällen, von denen Bower Cascade, obwohl einer der kleinsten, vielleicht der schönste von allen ist. Er liegt in der unteren Region des Passes, gerade dort, wo der Sonnenschein zwischen dem kalten und dem warmen Klima zu mildern beginnt. Hier singt der fröhliche Bach, stark geworden durch den Tribut, den er von vielen schneebedeckten Quellen auf den Höhen einnimmt, reichere Melodien und wird mit jedem Schritt menschlicher und liebenswerter. Jetzt kann man an seinem Rand Rosen und schlichtes Schafgarbenkraut finden und kleine Wiesen voller Bienen und Klee. Am Kopf eines niedrigen Felsens wölben sich üppige Hartriegelbüsche und Weiden von Ufer zu Ufer und schmücken den Bach mit ihren belaubten Zweigen. und herabhängende Federbüsche, die von der Strömung in Bewegung gehalten werden, säumen die Stirn des Wasserfalls davor. Aus diesem belaubten Versteck springt der Strom in einer geriffelten Kurve, die dicht mit glitzernden Kristallen übersät ist, ins Licht und fällt in einen mit braunen Felsbrocken gefüllten Teich, aus dem er grau mit Schaumglocken hervorkriecht und in einem Gewirr aus Grün verschwindet, wie dem, aus dem er kam.
Daher machen die metamorphen Schiefer am Fuße des Canyons dem Granit Platz, dessen edlere Skulptur dem Fluss, der darüber fließt, Ausdrücke von entsprechender Schönheit entlockt – helles Trillern von Stromschnellen, dröhnende Töne von Wasserfällen, feierliches Schweigen von sanft gleitenden Schichten, alles singt und vermischt sich in herrlicher Harmonie. Wenn sein ungestümes alpines Leben schließlich vorbei ist, gleitet er mit kaum hörbarem Flüstern durch eine Wiese und schläft im Moraine Lake ein.
Dieses Wasserbett ist eines der schönsten, die ich je gesehen habe. Immergrüne Pflanzen wiegen sich beruhigend um ihn herum, und der Atem der Blumen schwebt wie Weihrauch darüber. Hier ruht sich unser gesegneter Strom von seinen felsigen Wanderungen aus, alle seine Bergwanderungen sind vorüber – kein schäumendes Springen über Felsen mehr, kein wildes, jubelndes Lied mehr. Er fällt in einen sanften, glasigen Schlaf, nur vom Nachtwind geweckt, der, wenn er die Schlucht hinunterkommt, ihn in Wellen an seinen bestickten Ufern gurren und murmeln lässt.
Er verlässt den See und gleitet ruhig durch das Schilf, bestimmt, nie wieder den lebenden Fels zu berühren. Von nun an verläuft sein Weg durch alte Moränen und aschige Salbeiebenen, die nirgends Felsen bieten, die für die Entstehung von Kaskaden oder steilen Wasserfällen geeignet wären. Doch diese Schönheit der Reife ist, wenn auch weniger beeindruckend, von noch größerer Art und lockt uns liebevoll weiter durch Enzianwiesen und Haine aus raschelnden Espen zum Monosee, wo unser glücklicher Strom geisterhaft in Dampf verschwindet und wieder frei in den Himmel schwebt.
Bloody Cañon war wie alle anderen in der Sierra vor kurzem von einem Gletscher bedeckt, der seinen Quellschnee von den angrenzenden Gipfeln bezog und in den Mono Lake hinabstieg, zu einer Zeit, als dessen Wasserspiegel viel höher stand als heute. Die Hauptmerkmale, in denen die Geschichte der alten Gletscher erhalten ist, werden hier in wunderbarer Frische und Einfachheit dargestellt und bieten dem Studenten außergewöhnliche Vorteile für den Erwerb von Kenntnissen dieser Art. Die auffälligsten Passagen sind polierte und gestreifte Oberflächen, die an vielen Stellen die Sonnenstrahlen wie glattes Wasser reflektieren. Der Damm des Red Lake ist eine elegant modellierte Rippe aus metamorphem Schiefer, die aufgrund ihrer überlegenen Stärke und der stärkeren Gletschererosion des unmittelbar darüber liegenden Gesteins hervorgehoben wurde, die durch einen steil geneigten Nebengletscher verursacht wurde, der mit einem starken Abwärtsschub an der Spitze des Sees in den Hauptstamm eindrang.
Der Moraine Lake ist ein ebenso interessantes Beispiel für ein Becken, das ganz oder teilweise durch einen Endmoränendamm gebildet wird, der sich zwischen zwei Seitenmoränen quer über den Lauf eines Baches erstreckt.
Am Moraine Lake endet der eigentliche Canyon, obwohl er anscheinend durch die beiden Seitenmoränen des verschwundenen Gletschers fortgesetzt wird. Diese Moränen sind etwa 300 Fuß hoch und erstrecken sich ununterbrochen von den Seiten des Canyons in die Ebene, eine Entfernung von etwa fünf Meilen, wobei sie sich in schönen Linien biegen und verjüngen. Ihre sonnenzugewandten Seiten sind Gärten, ihre schattigen Seiten sind Haine; erstere sind hauptsächlich Eriogonen, Korbblütlern und Gräsern gewidmet; ein quadratischer Stab, der fünf oder sechs üppig blühende Eriogonen verschiedener Arten, etwa die gleiche Anzahl Bahia und Linosyris und ein paar Grasbüschel enthält; jede Art ist ordentlich voneinander getrennt gepflanzt, mit bloßem Kies dazwischen, als ob sie künstlich kultiviert worden wären.
Mein erster Besuch im Bloody Cañon fand im Sommer 1869 statt, unter Umständen, die die besonderen Eindrücke der Berge noch verstärken sollten. Ich kam aus dem blühenden Dickicht Floridas und watete in das Pflanzengold des großen Tals von Kalifornien, als dessen Flora noch unberührt war. Nie zuvor hatte ich halb so ausgedehnte oder halb so prächtige Ansammlungen von Volksblumen gesehen. Goldene Korbblütler bedeckten den gesamten Boden von der Küstenkette bis zur Sierra wie eine Schicht geronnenen Sonnenscheins, in der ich wochenlang schwelgte und den Auf- und Untergang der unzähligen Sonnen beobachtete; dann ließ ich mich auf dem Kamm der Sommerwelle vorwärts tragen, die jährlich die Sierra hinaufschwappt und sich auf den schneebedeckten Gipfeln erschöpft.
Ich blieb mehr als einen Monat auf den Big Tuolumne Meadows, um zu skizzieren, botanisch zu forschen und in den umliegenden Bergen zu klettern. Der Bergsteiger, mit dem ich damals kampierte, war einer jener bemerkenswerten Männer, denen man in Kalifornien so häufig begegnet, deren harte Kanten und Buckel durch die kräftezehrenden Erregungen der Goldzeit so deutlich hervortreten, dass sie Gletscherlandschaften ähneln. Aber zu diesem späten Zeitpunkt hatten die Aktivitäten meines Freundes nachgelassen, und sein Verlangen nach Ruhe veranlasste ihn, ein sanfter Hirte zu werden und sich buchstäblich neben das Lamm zu legen.
Er erkannte die unstillbaren Sehnsüchte meiner schottischen Hochlandinstinkte, machte mir einige Hinweise zum Bloody Cañon und riet mir, ihn zu erkunden. „Ich habe ihn selbst noch nie gesehen“, sagte er, „denn ich hatte noch nie das Pech, dort vorbeizukommen. Aber ich habe viele seltsame Geschichten darüber gehört, und ich garantiere, dass Sie ihn zumindest wild genug finden werden.“
Dann beeilte ich mich natürlich, es zu sehen. Früh am nächsten Morgen packte ich ein Bündel Brot, band mein Notizbuch an meinen Gürtel und schritt in der erfrischenden Luft davon, voller eifriger, unbestimmter Hoffnung. Die plüschigen Rasenflächen, die meinen Weg säumten, linderten meine morgendliche Hast. Der Rasen war an vielen Stellen mit Gänseblümchen und blauen Enzianen übersät, auf denen ich verweilte. Ich folgte den Pfaden der alten Gletscher über viele glänzende Gehwege und markierte die Lücken in den oberen Wäldern, die von der Kraft der Winterlawinen zeugten. Als ich höher stieg, sah ich zum ersten Mal, wie die Kiefern je nach Klima allmählich kleiner wurden, und entdeckte auf dem Gipfel kriechende Matten der arktischen Weide, die mit seidigen Kätzchen bewachsen waren, und Flecken der Zwerg-Vaccinium mit ihren runden Blüten, die wie purpurner Hagel ins Gras gestreut waren; während sich in alle Richtungen die Landschaft erhaben in frischer Wildheit erstreckte – ein Manuskript, das allein von der Hand der Natur geschrieben wurde.
Schließlich, als ich den Pass betrat, begannen sich die riesigen Felsen in ihrer ganzen wilden, geheimnisvollen Pracht um mich zu schließen, als plötzlich, während ich begierig um mich blickte, eine Herde grauhaariger Wesen in Sicht kam, die mit einer Art knochenloser, wälzender Bewegung wie Bären auf mich zukamen.
Ich drehe mich nie um, obwohl ich oft dazu geneigt bin, und in diesem besonderen Fall, inmitten einer solchen Umgebung, schien alles für die ruhige Aufnahme einer so grimmigen Gesellschaft ausgesprochen ungünstig. Ich unterdrückte meine Ängste und entdeckte bald, dass die seltsamen Kreaturen, obwohl sie so haarig wie Bären und so krumm wie Gipfelkiefern waren, aufrecht genug standen, um zu unserer eigenen Art zu gehören. Sie erwiesen sich als nichts Furchterregenderes als Mono-Indianer, die in die Felle von Salbeikaninchen gekleidet waren. Sowohl die Männer als auch die Frauen bettelten beharrlich um Whisky und Tabak und schienen so an Ablehnungen gewöhnt zu sein, dass es mir unmöglich war, sie davon zu überzeugen, dass ich ihnen nichts zu geben hatte. Außer den Namen dieser beiden Produkte der Zivilisation schienen sie kein Wort Englisch zu verstehen; aber später erfuhr ich, dass sie auf dem Weg ins Yosemite Valley waren, um eine Weile Forellen zu schlemmen und eine Ladung Eicheln zu beschaffen, die sie durch den Pass zu ihren Hütten am Ufer des Mono Lake zurückbringen konnten.
Gelegentlich kann man bei den Mono-Indianern ein gutes Gesicht erkennen, aber diese, die ersten Exemplare, die ich gesehen hatte, waren meist hässlich und einige von ihnen ganz und gar abscheulich. Der Schmutz auf ihren Gesichtern war ziemlich geschichtet und schien so alt und unberührt, dass er fast eine geologische Bedeutung haben könnte. Die älteren Gesichter waren außerdem seltsam verschwommen und durch Furchen in Abschnitte unterteilt, die wie die Spaltfugen von Felsen aussahen und darauf hindeuteten, dass sie jahrhundertelang in den Bergen ausgesetzt waren. Irgendwie schienen sie keinen richtigen Platz in der Landschaft zu haben, und ich war froh, als sie den Pass hinunter aus dem Blickfeld verschwanden.
Dann kam der Abend, und die düsteren Klippen wurden von der unbeschreiblichen Schönheit des Alpenglühens erfüllt. Eine feierliche Ruhe legte sich über alles. Der ganze untere Teil des Canyons lag im Dämmerlicht, und ich kroch in eine Senke in der Nähe eines der oberen Seen, um den Boden in einer geschützten Ecke als Bett zu glätten. Als die kurze Dämmerung verblasste, entzündete ich ein sonniges Feuer, machte mir eine Tasse Tee und legte mich hin, um mich auszuruhen und die Sterne zu betrachten. Bald begann der Nachtwind zu strömen und in Strömen zwischen den zerklüfteten Gipfeln zu strömen, wobei er seltsame Töne mit denen der Wasserfälle vermischte, die weit unten klangen; und als ich langsam einschlief, überkam mich ein unangenehmes Gefühl der Nähe zu den pelzigen Monos. Dann blickte der Vollmond über den Rand der Canyonwand herab, sein Antlitz schien von tiefer Sorge erfüllt und anscheinend so nah, dass es einen verblüffenden Effekt erzeugte, als ob er mein Schlafzimmer betreten hätte, die ganze Welt vergessend, um mich allein anzuschauen.
Die Nacht war voller seltsamer Geräusche und ich begrüßte den Morgen mit Freude. Das Frühstück war bald fertig und ich machte mich in der berauschenden Frische des neuen Tages auf den Weg und freute mich über die Fülle der reinen Wildnis, die mich so nah umgab. Die gewaltigen Felsen, zerhackt und vernarbt von Jahrhunderten der Stürme, hoben sich scharf im schwachen Morgenlicht, während sich unten im Canyon gefurchte und polierte Buckel hoben und glitzerten wie anschwellende Meereswellen und eine großartige alte Geschichte des alten Gletschers erzählten, der seine zermalmenden Fluten über sie ergoss.
Hier begegnete ich zum ersten Mal den arktischen Gänseblümchen in all ihrer Vollkommenheit an Reinheit und Spiritualität – sanften Bergbewohnern Auge in Auge mit dem stürmischen Himmel, die durch tausend Wunder sicher und warm gehalten werden. Ich sprang leichtfüßig von Fels zu Fels und erfreute mich an der ewigen Frische und Genügsamkeit der Natur und an der unbeschreiblichen Zärtlichkeit, mit der sie ihre Lieblinge in den Bergen in den Quellen der Stürme nährt. Mit jedem Schritt erschien frische Schönheit, zarte Felsenfarne und Gruppen der schönsten Blumen. Mal kam ein anderer See in Sicht, mal ein Wasserfall. Nie fiel das Licht in helleren Pailletten, nie fiel das Wasser in weißerem Schaum. Ich schien verzaubert durch den Canyon zu schweben, spürte nichts von seiner Rauheit und war in den Mono-Ebenen, bevor ich es bemerkte.
Wenn ich vom Ufer des Moraine Lake zurückschaue, kommt mir mein Morgenspaziergang wie ein Traum vor. Dort krümmt sich der Bloody Cañon, eine bloße Gletscherfurche von 2000 Fuß Tiefe, mit glatten Felsen, die aus den Seiten herausragen und in der Mitte wie pralle, anschwellende Muskeln miteinander verflochten sind. Hier waren die Lilien höher als mein Kopf und die Sonne war warm genug für Palmen. Doch der Schnee um die arktischen Weiden war nur vier Meilen entfernt deutlich sichtbar und dazwischen lagen schmale Musterzonen aller wichtigen Klimazonen der Erde.
Am Ufer eines kleinen Baches, der gurgelnd an der Seite der linken Seitenmoräne herunterkommt, entdeckte ich ein noch brennendes Lagerfeuer, das zweifellos den grauen Indianern gehörte, denen ich auf dem Gipfel begegnet war. Ich lauschte instinktiv und bewegte mich vorsichtig weiter, wobei ich beinahe damit rechnete, einige ihrer grimmigen Gesichter aus den Büschen hervorlugen zu sehen.
Als ich weiter in Richtung der offenen Ebene ging, bemerkte ich drei klar erkennbare Endmoränen, die sich anmutig über den Canyon-Strom wölbten und durch lange Fugen mit den beiden edlen Seitenarmen verbunden waren. Sie markieren die Haltepunkte des verschwundenen Gletschers, als er sich nach dem Ende des Eiswinters in den Schatten seines Gipfels zurückzog.
Fünf Meilen unterhalb des Moraine Lake, genau dort, wo die Seitenmoränen in die Ebene übergehen, gab es ein Feld mit wildem Roggen, der in prächtigen, wogenden Büscheln von sechs bis acht Fuß Höhe wuchs und Ähren von sechs bis zwölf Zoll Länge trug. Als ich einige der Körner ausrieb, fand ich, dass sie etwa fünf Achtel Zoll lang, dunkel gefärbt und süß waren. Indianerfrauen sammelten das Getreide in Körben, beugten große Handvoll herunter, schlugen es aus und fächerten es im Wind. Es war recht malerisch, wie sie durch das Roggenfeld wuchsen, da man sie hier und da in gewundenen Gassen und Lichtungen mit prächtigen Büscheln über ihren Köpfen erblickte, während ihr unaufhörliches Geplapper und Gelächter ihre unbekümmerte Freude verriet.
Wie das Roggenfeld fand ich auch die sogenannte Wüste von Mono in einem Zustand natürlicher Blüte mit Wildrosen, Kirschen, Astern und der zarten Abronie vor; außerdem zahllose Gilien, Phloxen, Mohnblumen und Korbblütler. Ich beobachtete ihre Gesten und die verschiedenen Ausdrücke ihrer Blütenkronen und fragte mich, wie sie in dieser vulkanischen Wüste so frisch und schön sein konnten. Sie erzählten von einem ebenso glücklichen Leben wie jede andere Pflanzengesellschaft, die ich je getroffen habe, und schienen sogar den heißen Sand und den Wind zu genießen.
Aber die Vegetation des Passes wurde zum größten Teil zerstört, und das Gleiche kann man von allen leichter zugänglichen Pässen in der gesamten Gebirgskette sagen. Unmengen verhungernder Schafe und Rinder wurden durch sie nach Nevada getrieben und haben die wilden Gärten und Wiesen fast vollständig zerstört. Die hohen Wände sind von keinem Fuß berührt worden und die Wasserfälle singen unverändert weiter; aber der Anblick zerdrückter Blumen und abgenagter, zerbissener Büsche trägt viel dazu bei, den Zauber der Wildnis zu zerstören.
Der Canyon sollte im Winter besichtigt werden. Ein guter, kräftiger Reisender, der den Weg und das Wetter kennt, könnte in ruhigen Zeiten, wenn die Stürme sich gelegt haben, problemlos eine sichere Exkursion vom Yosemite Valley aus mit Schneeschuhen durch ihn unternehmen. Die Seen und Wasserfälle wären dann begraben, aber auch die Spuren zerstörerischer Füße, während die Aussicht auf die Berge in ihrem Winterkleid und die blitzschnelle Fahrt den Pass hinunter zwischen den schneebedeckten
Wänden wahrhaft herrlich wären.

KAPITEL VI
DIE GLETSCHERSEEN
Unter den vielen unerwarteten Schätzen, die in den Tiefen der Einsamkeit der Sierra verborgen sind, bezaubern und überraschen die Gletscherseen Reisende aller Art mit Sicherheit am meisten. Die Wälder, Gletscher und schneeweißen Quellen der Flüsse lassen ihren Reichtum selbst aus der Ferne mehr oder weniger deutlich erkennen, aber von den Seen ist nichts zu sehen, bis wir über sie hinausgeklettert sind. Alle oberen Flussarme sind ziemlich voll mit Seen, wie Obstbäume mit Früchten. Sie liegen eingebettet in den tiefen Wäldern, unten in den zerklüfteten Böden der Schluchten, hoch auf kahlen Hochebenen und am Fuße der eisigen Gipfel und spiegeln ihre wilde Schönheit immer wieder wider. Eine Vorstellung von ihrem verschwenderischen Reichtum kann man sich aus der Tatsache machen, dass man von einem Standpunkt auf dem Gipfel des Red Mountain, eine Tagesreise östlich des Yosemite Valley, nicht weniger als zweiundvierzig Seen in einem Umkreis von zehn Meilen sieht. Die Gesamtzahl in der Sierra dürfte kaum unter fünfzehnhundert liegen, wenn man die unzähligen kleineren Teiche und Bergseen nicht mitzählt. Vielleicht zwei Drittel oder mehr davon liegen an der Westflanke der Bergkette, und alle sind auf die alpinen und subalpinen Regionen beschränkt. Am Ende der letzten Eiszeit gab es in den mittleren und vorgebirgigen Regionen ebenfalls viele Seen, die jedoch alle längst verschwunden sind, so vollständig wie die prächtigen alten Gletscher, die sie entstehen ließen.
Obwohl die Ostflanke des Gebirges extrem steil ist, finden wir selbst in den steilsten Abschnitten ziemlich regelmäßig verteilte Seen. Sie befinden sich hauptsächlich in den oberen Zweigen der Canyons und in den Gletscheramphitheatern rund um die Gipfel.
Gelegentlich kommen lange, schmale Exemplare an den steilen Seiten von Trennkämmen vor, deren Becken wie Hängematten der Länge nach geschwungen sind, und sehr selten liegt eines so genau auf dem Gipfel der Bergkette am Kopf eines Passes, dass sein Wasser bei starker Schneeschmelze beide Flanken hinabläuft. Doch egal, wo sie liegen, sie überraschen den eifrigen Bergsteiger bald nicht mehr, denn wie alle Liebeswerke der Natur stehen sie in harmonischer Beziehung zueinander und zu allen anderen Merkmalen der Berge. Es ist daher leicht, die hellen Seeaugen in der rauesten und unkontrollierbarsten Topographie jeder Landschaft zu finden. Sogar in den tieferen Regionen, wo sie viele Jahrhunderte lang geschlossen waren, sind ihre felsigen Umlaufbahnen noch erkennbar, aufgefüllt mit dem Schutt von Hochwasser und Lawinen. Bald erkennt man ein schönes Gruppierungssystem in Übereinstimmung mit den Gletscherquellen; auch ihre Ausdehnung in Richtung der Tendenzen der uralten Gletscher; und im Allgemeinen hängen Form, Größe und Lage von der Art der Gesteine ab, aus denen ihre Becken erodiert sind, sowie von der Menge und Richtung der Gletscherkraft, die auf jedes Becken ausgeübt wurde.
In den oberen Canyons finden wir sie normalerweise in ziemlich regelmäßiger Abfolge, aufgereiht wie Perlen auf den hellen Bändern ihrer Zuflüsse, die weiß und grau mit Schaum und Gischt von einem zum anderen strömen, wobei ihre vollkommene Spiegelstille eindrucksvolle Kontraste zu dem großartigen Getöse und dem Glanz der verbindenden Katarakte bildet. In Lake Hollow, auf der Nordseite des Hoffman-Sporns, unmittelbar oberhalb des großen Tuolumne-Canyons, liegen zehn liebliche kleine Seen dicht beieinander in einer großen Senke, wie Eier in einem Nest. Von oben betrachtet, in der Gesamtansicht, gefiedert mit Hemlocktannen und gesäumt von Seggen, scheinen sie mir die außergewöhnlichste und am interessantesten gelegene Seengruppe zu sein, die ich je entdeckt habe.
Lake Tahoe ist 22 Meilen lang, etwa 10 Meilen breit und zwischen 500 und über 1600 Fuß tief und damit der größte aller Sierra-Seen. Er liegt direkt hinter der nördlichen Grenze des höheren Teils der Bergkette zwischen der Hauptachse und einem Ausläufer, der auf der Ostseite nahe der Quelle des Carson River hervorragt. Seine bewaldeten Ufer schlängeln sich um viele smaragdgrüne Buchten und mit Kiefern bewachsene Vorgebirge, und sein Wasser ist überall so rein wie das Wasser in den höchsten Bergen.
Der Donner Lake, der durch das schreckliche Schicksal der Donner-Gruppe unvergesslich wurde, ist etwa drei Meilen lang und liegt etwa zehn Meilen nördlich von Tahoe an der Quelle eines der Nebenflüsse des Truckee. Ein paar Meilen weiter nördlich liegt der Lake Independence, der etwa so groß ist wie der Donner. Die weitaus meisten Seen liegen jedoch viel höher und sind recht klein. Nur wenige sind länger als eine Meile, die meisten weniger als eine halbe Meile.
Am unteren Rand des Seegürtels sind die kleinsten durch die Aufschüttung ihrer Becken verschwunden, sodass nur die von beträchtlicher Größe übrig geblieben sind. Doch entlang des oberen, frisch vergletscherten Randes der Seezone enthält jede noch so kleine Senke, die von irgendeinem Teil des dichten Flussnetzes aus erreichbar ist, einen hellen, randvollen Teich, so dass die Landschaft, von den Berggipfeln aus betrachtet, mit ihnen übersät zu sein scheint. Viele der größeren Seen sind von kleineren umgeben, wie zentrale Edelsteine, die von funkelnden Brillanten umgürtet sind. Im Allgemeinen gibt es jedoch keine deutliche Trennlinie hinsichtlich der Größe. Um Verwirrung vorzubeugen, möchte ich hier darauf hinweisen, dass ich bei der Angabe von Zahlen keinen Umfang von weniger als 500 Yards einschließe.
Im Becken des Merced River habe ich 131 gezählt, davon 111 an den Nebenflüssen, die so majestätisch ins Yosemite Valley münden. Der Pohono Creek, der den gleichnamigen Wasserfall bildet, entspringt in einem wunderschönen See, der im Schatten eines hohen Granitsporns liegt, der vom Gipfel des Buena Vista ausgeht. Dies ist jetzt der einzige verbliebene See im gesamten Pohono-Becken. Der Illilouette hat sechzehn, der Nevada nicht weniger als siebenundsechzig, der Tenaya acht, der Hoffmann Creek fünf und der Yosemite Creek vierzehn. Es gibt nur zwei weitere Zuflüsse des Merced, die Seen führen, nämlich den South Fork mit fünfzehn und den Cascade Creek mit fünf, die beide unterhalb von Yosemite in den Hauptarm münden.

Der Merced River als Ganzes ähnelt bemerkenswert einer Ulme, und man braucht nur wenig Vorstellungskraft, um ihn sich aufrecht stehend vorzustellen, mit all seinen Seen, die an seinen ausladenden Ästen hängen, von denen der oberste 130 Kilometer hoch ist. Zählt man nun alle anderen Flüsse der Sierra mit Seen hinzu, jeden an seinem Platz, erhält man ein wahrhaft herrliches Schauspiel – eine Allee in der Länge und Breite der Bergkette; die langen, schlanken, grauen Schäfte der Hauptstämme, die Milchstraße der gewölbten Äste und die silbrigen Seen, alle klar abgegrenzt und am Himmel glänzend. Wie aufregend wäre eine solche Ergänzung der Landschaft anzuschauen! Doch diese Flüsse mit Seen sind in ihrer natürlichen Lage für diejenigen, die die Augen haben, sie zu sehen, wie sie eingebettet in ihre Wiesen und Wälder und von Gletschern geformten Felsen liegen, noch aufregender und eindrucksvoller.
Wenn ein Bergsee entsteht – wenn er sich wie ein junges Auge zum ersten Mal dem Licht öffnet – ist er eine unregelmäßige, ausdruckslose Sichel, umschlossen von Fels- und Eisbänken – nackter, vergletscherter Fels auf der unteren Seite, die schroffe Gletscherzunge auf der oberen Seite. In diesem Zustand bleibt er viele Jahre, bis sich der Gletscher schließlich gegen Ende einer günstigen Jahreszeitengruppe über den oberen Rand des Beckens zurückzieht und es zum ersten Mal von Ufer zu Ufer offen lässt, Tausende von Jahren nach seiner Entstehung unter dem Gletscher, der sein Becken ausgehöhlt hat. Die kalte und kahle Landschaft spiegelt sich in seinen reinen Tiefen; die Winde kräuseln seine glasige Oberfläche und die Sonne füllt ihn mit pulsierendem Glitzer, während seine Wellen beginnen, an seine blattlosen Ufer zu plätschern und zu rauschen – Sonnenglitzer am Tag und reflektierte Sterne in der Nacht sind seine einzigen Blumen, der Wind und der Schnee seine einzigen Besucher. In der Zwischenzeit zieht sich der Gletscher weiter zurück und zahlreiche Rinnen, die noch jünger sind als der See selbst, bringen Gletscherschlamm, Sandkörner und Kieselsteine herunter, wodurch Randringe und Erdflächen entstehen. In diese frischen Erdbeete kommen viele wartende Pflanzen. Zuerst ein robuster Seggen mit gewölbten Blättern und einem Stiel brauner Blüten; dann, wenn die Jahreszeiten wärmer werden und die Erdbeete tiefer und breiter werden, nehmen andere Seggen ihren vorgesehenen Platz ein, und zu diesen gesellen sich blaue Enzianen, Gänseblümchen, Dodekatheonen, Veilchen, Honigkräuter und viele bescheidene Moose. Auch Sträucher eilen rechtzeitig in die neuen Gärten – Kalmia mit ihren glänzenden Blättern und violetten Blüten, die arktische Weide, die weiche gewebte Teppiche bildet, zusammen mit dem Heidekraut und der Cassiope, den schönsten und liebsten von allen. Insekten beleben jetzt die Luft, Frösche pfeifen fröhlich im seichten Wasser, bald gefolgt von der Amsel, die als erster Vogel einen Gletschersee besucht, so wie die Segge die erste der Pflanzen ist.
So wird der junge See immer schöner und von Jahrhundert zu Jahrhundert für den Menschen immer liebenswerter. Espenhaine sprießen, winterharte Kiefern und Schierlingsfichten, bis er von üppigen Bäumen und Schatten übersät ist. Doch während seine Ufer bereichert werden, dringen die Erdschichten unaufhörlich vor und verkleinern seine Fläche, während die leichteren Schlammpartikel, die sich auf dem Boden ablagern, ihn immer flacher werden lassen, bis schließlich der letzte Rest des Sees verschwindet – für immer verschlossen in reifem und natürlichem Alter. Und nun schlängelt sich sein Zufluss ohne Unterbrechung weiter durch die neuen Gärten und Haine, die seinen Platz eingenommen haben.
Die Lebensdauer eines Sees hängt normalerweise von der Kapazität seines Beckens im Vergleich zur Tragkraft der Ströme ab, die in ihn fließen, von der Beschaffenheit der Felsen, über die diese Ströme fließen, und von der relativen Lage des Sees zu anderen Seen. In einer Reihe von Seen, deren Becken in derselben Schlucht liegen und von ein und demselben Hauptstrom gespeist werden, wird das oberste natürlich zuerst verschwinden, sofern nicht ein anderer den See füllender Faktor hinzukommt, der das Ergebnis ändert; denn zuerst nimmt es fast alle Sedimente auf, die der Strom herunterbringt, und nur die feinsten Schlammpartikel werden durch das oberste der Reihe zum nächsten darunter getragen. Dann werden nacheinander die nächsthöheren und die nächsten gefüllt, und das unterste wäre das letzte, das verschwindet. Aber diese Einfachheit in Bezug auf die Dauer wird auf verschiedene Weise gestört, hauptsächlich durch die Wirkung von Seitenströmen, die direkt in die unteren Seen münden. Denn obwohl viele dieser Nebenflüsse recht kurz und im Spätsommer schwach sind, werden sie im Frühjahr, wenn der Schnee schmilzt, zu mächtigen Sturzbächen, die nicht nur Sand und Kiefernnadeln, sondern auch große Baumstämme und tonnenschwere Felsbrocken mit sich führen und diese mit erstaunlicher Kraft ihre steil abfallenden Kanäle hinab in die Seebecken reißen. Viele dieser Nebenflüsse haben außerdem den Vorteil, dass sie Zugang zu den seitlichen Hauptmoränen des verschwundenen Gletschers haben, der den Canyon bedeckte, und von diesen ziehen sie ihr seefüllendes Material heran, während der Hauptstrom meist über saubere Gletscherplatten fließt, wo nur wenig Moränenmaterial übrig bleibt, das er mit sich tragen könnte. So kann ein kleiner, schneller Strom mit einer Fülle von losem, transportablem Material in seiner Reichweite ein ausgedehntes Becken in wenigen Jahrhunderten füllen, während ein großer, ganzjähriger Hauptstrom, der über saubere, dauerhafte Platten fließt, obwohl er normalerweise hundertmal größer ist, ein kleineres Becken in Tausenden von Jahren nicht füllen kann.
Der relative Einfluss großer und kleiner Flüsse als Seefüller wird im Yosemite Valley, durch das der Merced fließt, eindrucksvoll illustriert. Der Talgrund besteht heute aus ebenem Wiesenland und trockenen, abfallenden Erdschichten, die mit Eichen und Kiefern bepflanzt sind, aber einst war es ein See, der sich von Wand zu Wand und fast von einem Ende des Tals zum anderen erstreckte und eine der schönsten, von Klippen umschlossenen Wasserflächen bildete, die es je in der Sierra gab. Und obwohl er vielleicht nie von einem menschlichen Auge gesehen wurde, war er geologisch gesehen erst gestern, da er verschwunden ist, und die Spuren seiner Existenz sind noch so frisch, dass er leicht vor dem Auge der Vorstellungskraft wiederhergestellt und in all seiner Pracht betrachtet werden kann, ungefähr so wahrhaftig und lebendig, als ob er tatsächlich vor uns stünde. Jetzt stellen wir fest, dass der Schutt, der dieses prächtige Becken füllt, nicht von den Hauptflüssen, die hier zusammenlaufen, um den Fluss zu bilden, von den entfernten Bergen heruntergebracht wurde, wie kraftvoll und für diesen Zweck geeignet er auf den ersten Blick auch erscheinen mag; sondern fast ausschließlich durch die kleinen örtlichen Nebenflüsse, wie denen des Indian Cañon, des Sentinel und der Three Brothers, und durch einige kleine Restgletscher, die im Schatten der Wände verblieben, lange nachdem der Hauptgletscher sich über die Talspitze zurückgezogen hatte.
Wären die Gletscher, die einst die Bergkette bedeckten, auf einmal geschmolzen und hätten die gesamte Oberfläche gleichzeitig von oben bis unten kahl gelassen, dann wären natürlich alle Seen gleichzeitig entstanden, und die höchsten würden, wenn alle anderen Umstände gleich blieben, wie wir gesehen haben, als erste verschwinden. Aber weil sie allmählich vom Fuß der Bergkette aufwärts schmolzen, waren die unteren Seen die ersten, die das Licht erblickten und die ersten, die ausgelöscht wurden. Deshalb finden wir die heutigen Seen nicht am Fuße der Bergkette, sondern an der Spitze. Die meisten der unteren Seen verschwanden Tausende von Jahren, bevor die Seen entstanden, die heute die alpine Landschaft erhellen. Und im Allgemeinen sind die untersten der bestehenden Seen aufgrund des absichtlichen Rückzugs der Gletscher nach oben auch die ältesten, wobei im gesamten Gürtel ein allmählicher Übergang von den älteren, bewaldeten, von Wiesen gesäumten und verengten Formen bis hinauf zu den neu entstandenen, kahlen und wiesenlosen Seen zwischen den höchsten Gipfeln erkennbar ist.

Einige kleine Seen an unglücklicher Lage werden plötzlich durch einen einzigen Lawinenstoß vernichtet, der eine riesige Anzahl von Bäumen samt dem Boden, auf dem sie wuchsen, mit sich reißt. Andere werden durch Erdrutsche, Erdbebenschutt usw. vernichtet, aber diese Seesterben können im Vergleich zu denen, die durch die absichtliche und unaufhörliche Ablagerung von Sedimenten entstehen, als zufällig bezeichnet werden. Ihr Schicksal ist das von Bäumen, die vom Blitz getroffen werden.
Die Seelinie steigt natürlich immer noch an, ihre derzeitige Höhe beträgt etwa 8000 Fuß über dem Meeresspiegel; etwas höher als diese Höhe in Richtung des südlichen Endes des Gebirges, niedriger in Richtung des nördlichen, aufgrund des zeitlichen Unterschieds des Rückzugs der Gletscher aufgrund der Klimaunterschiede. Exemplare kommen hier und da deutlich unterhalb dieser Grenze vor, in Becken, die speziell vor eingeschwemmtem Geröll geschützt sind oder eine außergewöhnliche Größe aufweisen. Diese sind jedoch nicht zahlreich genug, um eine auffällige Unregelmäßigkeit in der Linie zu verursachen. Das höchste, das ich bisher gefunden habe, liegt auf einer Höhe von etwa 12.000 Fuß in einem Gletscherschoß am Fuße eines der höchsten Gipfel, einige Meilen nördlich des Mount Hitter. Die Becken von vielleicht 25 oder 30 befinden sich noch im Entstehungsprozess unter den wenigen verbliebenen Gletschern, aber bis sie entstehen, wird wahrscheinlich eine ebenso große oder noch größere Zahl abgestorben sein. Seit Beginn des Endes der Eiszeit war die Gesamtzahl in der Bergkette vielleicht nie größer als gegenwärtig.
Eine grobe Schätzung der durchschnittlichen Dauer dieser Bergseen kann anhand bereits genannter Daten vorgenommen werden, aber ich kann hier nicht stehen bleiben, um das Thema im Detail zu behandeln. Ich muss in der Zwischenzeit auch auf das Vergnügen einer ausführlichen Diskussion der interessanten Frage der Seebeckenbildung verzichten, für die es in diesen Bergen reichlich gutes, klares und anschauliches Material gibt. Zusätzlich zu dem, was bereits zu diesem Thema gesagt wurde, möchte ich nur diese eine Feststellung machen. Jeder See in der Sierra ist ein Gletschersee. Ihre Becken wurden von diesem mächtigen Agens nicht nur umgestaltet und ausgehöhlt, sondern in erster Linie aus dem Festland erodiert.
Ich muss mich jetzt beeilen, einige nähere Ansichten repräsentativer Exemplare zu zeigen, die auf unterschiedlichen Höhen des Hauptgürtels des Sees liegen, und mich dabei auf die Beschreibung der für jedes Exemplar charakteristischsten Merkmale beschränken.
SCHATTENSEE
Dies ist ein schönes Exemplar des ältesten und am tiefsten gelegenen der existierenden Seen. Er liegt etwa acht Meilen oberhalb des Yosemite Valley, am Hauptarm des Merced, auf einer Höhe von etwa 7350 Fuß über dem Meeresspiegel und ist überall so fest von Klippen umgeben, dass ohne künstliche Pfade nur wilde Tiere aus jeder Richtung zu seinen felsigen Ufern gelangen können. Ursprünglich war er etwa anderthalb Meilen lang; jetzt ist er nur noch eine halbe Meile lang und etwa eine Viertelmeile breit und an der tiefsten Stelle des Beckens 98 Fuß tief. Sein kristallklares Wasser wird im Norden und Süden von majestätischen Granitwänden umschlossen, die im echten Yosemite-Stil in Kuppeln, Giebeln und zinnenbewehrten Landzungen geformt sind, die im Süden aus einer Höhe von 1500 bis 2000 Fuß steil ins tiefe Wasser abfallen. Der South-Lyell-Gletscher erodierte dieses prächtige Becken aus massivem Porphyr-Granit, während er sich seinen Weg von den Gipfelquellen westwärts in Richtung Yosemite bahnte. Die freiliegenden Felsen an den Ufern und die vorspringenden Vorsprünge der Wände, die unter der gewaltigen Eisflut geschliffen und poliert wurden, leuchten trotz der unzähligen zerstörerischen Stürme, die sie heimgesucht haben, immer noch in silbrigem Glanz. Die allgemeine Form des Beckens sowie die Moränen entlang der Oberseite der Wände und die Rillen und Kratzer auf dem Boden und an den Seiten zeigen auf unmissverständliche Weise die Richtung an, die dieser mächtige Eisfluss eingeschlagen hat, seine große Tiefe und die enorme Energie, die er aufbrach, als er sich in das Becken hinein und wieder hinaus schob. Aufgrund des größeren Gefälles übte er auf diesen Teil seines Kanals einen stärkeren Druck aus und erodierte ihn daher tiefer als die anderen Teile um ihn herum, was zwangsläufig zu der Bildung der Seeschüssel führte.
Angesichts dieser herrlichen Eismerkmale, die wir so lebhaft vor Augen haben, ist es nicht leicht zu begreifen, dass der alte Gletscher, der sie schuf, vor Jahrzehnten verschwand; denn abgesehen von der Vegetation, die aufgetaucht ist, und den Veränderungen, die ein Erdbeben mit sich brachte, das Felslawinen von den schwächeren Landzungen schleuderte, bietet das Becken als Ganzes dasselbe Aussehen wie damals, als es erstmals ans Tageslicht kam. Der See selbst hat jedoch deutliche Veränderungen erfahren; man sieht auf den ersten Blick, dass er altert. Mehr als zwei Drittel seiner ursprünglichen Fläche sind jetzt trockenes Land, bedeckt mit Wiesengräsern und Kiefern- und Tannenhainen, und das ebene Schwemmbett, das sich am Kopfende von Wand zu Wand erstreckt, wächst offensichtlich entlang seines gesamten seewärts gerichteten Randes und wird den See schließlich für immer verschließen.

Jeder Liebhaber schöner Wildnis würde an einem Sommertag sein Vergnügen daran haben, durch die blühenden Haine zu schlendern, die jetzt den aufgefüllten Teil des Beckens einnehmen. Das geschwungene Ufer ist deutlich durch ein Band aus weißem Sand nachgezeichnet, auf dem die Wellen spielen; dann kommt ein Gürtel aus breitblättrigen Seggen, hier und da unterbrochen von einem undurchdringlichen Gewirr aus Weiden; dahinter gibt es Haine aus Zitterpappeln; dann ein dunkler, schattiger Gürtel aus Zweiblättrigen Kiefern, mit hier und da einer runden, nestartig in ihrer Mitte eingebetteten Seggenwiese; und schließlich ein schmaler äußerer Rand aus majestätischen, 200 Fuß hohen Weißtannen. Der Boden unter den Bäumen ist mit einer üppigen Ernte von Gräsern bedeckt, hauptsächlich Triticum, Trespe und Calamagrostis, mit violetten Ähren und Rispen, die einem bis zu den Schultern reichen; während die offenen Wiesenflächen den ganzen Sommer über in prächtigen Blumen erstrahlen – Helenium, Goldruten, Erigeron, Lupinen, Kastilien und Lilien – und beliebte Verstecke und Futterplätze für Bären und Hirsche darstellen.
Die zerklüftete Südwand ist oben von einer imposanten Reihe turmhoher Weißtannen dunkel gefiedert, während die zerklüfteten Steilhänge bis hinunter zum Wasserrand mit malerischen alten Wacholderbüschen geschmückt sind, deren zimtfarbene Rinde sich fein vom neutralen Grau des Granits abhebt. Diese lehnen sich zusammen mit einigen wagemutigen Zwergkiefern und Fichten über zerklüftete Rippen und Tafeln oder stehen aufrecht in schattigen Nischen, auf unbeschreiblich wilde und furchtlose Weise. Außerdem bilden die weiß blühenden Douglas-Spiraea und die Zwerg-Eiche anmutige Fransen entlang der schmaleren Nähte, wo immer der geringste Halt gefunden werden kann. Auch Felsenfarne wie Allosorus, Pellaea und Cheilanthes sind hier zu finden und bilden hübsche Rosetten auf den trockeneren Spalten; und die zarten Frauenhaar-, Cistopperis- und Woodsia-Bäume verstecken sich in moosigen Grotten, die von einem plätschernden Bach befeuchtet werden; und dann reckt der orange Goldlack hier und da seine prächtigen Blütenrispen in die Höhe in die Sonne, und der Bahia bildet goldene Büschel. Doch trotz all dieser Pflanzenschönheit ist der Gesamteindruck beim Blick über den See der einer strengen, unerschütterlichen Felsigkeit; Farne und Blumen sind kaum zu sehen, und nicht einmal ein Fünfzigstel der gesamten Oberfläche ist mit Pflanzen bedeckt.
Die sonnigere Nordwand weist eine abwechslungsreichere Skulptur auf, aber der Grundton ist der gleiche. Einige flache, mit Erde bedeckte Landzungen stützen Zedern- und Kieferngruppen, und aufwärts geschwungene Dickichte aus Kastanien und Virginia-Eichen, die auf rauen Erdbeben-Schuttklumpen wachsen, umschließen ihre Basen. Zwischen ihnen strömen kleine Bäche herab, deren schäumende Ränder von bunten Primeln, Gilien und Mimulus erhellt werden. Und dicht am Ufer auf dieser Seite erstreckt sich ein Streifen felsiger Wiese, der mit Butterblumen, Gänseblümchen und weißen Veilchen übersät ist, und die Gräser mit den violetten Spitzen an ihrem abgeschrägten Rand tauchen ihre Blätter ins Wasser.
Die untere Kante des Beckens ist eine dammartige Erhebung aus massivem Granit, die vom alten Gletscher stark abgeschliffen, vom abfließenden Bach jedoch bisher kaum durchschnitten wurde, obwohl dieser seit der Entstehung des Sees unaufhörlich weitergeflossen ist.
Sobald der Strom den Seerand überschritten hat, bricht er in Kaskaden aus, hält keinen Augenblick an und verliert kaum ein Jota seiner fröhlichen Energie, bis er das nächste gefüllte Becken eine Meile weiter unten erreicht. Dann wirbelt und windet er sich schläfrig durch Wiesen und Wälder, bricht erneut in graue Stromschnellen und Wasserfälle aus, springt und gleitet in herrlicher Ausgelassenheit wilden Springens und Tanzes in ein weiteres und noch ein weiteres gefülltes Seebecken hinab. Dann, nach einer langen Ruhepause in den Ebenen von Little Yosemite, bietet er sein großartigstes Schauspiel im berühmten Nevada Fall. Der wilde, tosende Fluss bahnt sich seinen Weg aus den Gischtwolken am Fuße des Wasserfalls, legt eine weitere Meile voller Kaskaden und Stromschnellen zurück, ruht einen Moment im Emerald Pool, stürzt dann über die gewaltige Klippe des Vernal Falls und strömt donnernd und scheuernd durch eine mit Felsbrocken übersäte Schlucht von enormer Tiefe und Wildheit in die ruhigen Tiefen des alten Yosemite-Seebeckens.
Die Farbenschönheit um Shadow Lake ist während des Altweibersommers viel reicher, als man es in einer so jungen und eiszeitlichen Wildnis zu finden hoffen könnte. Fast jedes Blatt ist dann gefärbt und die Goldruten blühen; aber die meiste Farbe kommt von den reifen Gräsern, Weiden und Espen. Am Fuße des Sees steht man in einem zitternden Espenhain, jedes Blatt ist wie ein Schmetterling bemalt, und rechts und links um das Ufer herum zieht sich ein geschwungenes Band aus Wiesen, rot und braun mit blassem Gelb gesprenkelt, hier und da in ein dunstiges Purpurrot übergehend. Auch die Wände sind mit Flecken heller Farbe übersät, die auf dem neutralen Granitgrau hervorschimmern. Aber weder die Wände noch die Wiese am Rand, noch der fröhliche, flatternde Hain, in dem Sie stehen, noch der See selbst, der von Pailletten übersät ist, können Ihre Aufmerksamkeit lange fesseln; denn am oberen Ende des Sees befindet sich eine herrliche Masse von Orangegelb, die zum Hauptgürtel aus Espenholz des Beckens gehört und die Quelle zu sein scheint, aus der alle Farben darunter geflossen sind, und hier ist Ihr Blick erfüllt und fixiert. Diese herrliche Masse ist etwa dreißig Fuß hoch und erstreckt sich über das Becken fast von Wand zu Wand. Davor flammen üppige Weidenbüschel, und von deren Basis aus erstreckt sich die braune Wiese bis zum Rand des Wassers, wobei sich das Ganze vom unnachgiebigen Grün der Nadelbäume abhebt, während dickes Sonnengold über alles gegossen ist.
An diesen gesegneten, farbenfrohen Tagen verdunkelt keine Wolke den Himmel, der Wind ist sanft und die Landschaft ruht, überall ist es still und unbeschreiblich eindrucksvoll. Normalerweise sieht man ein paar Enten auf dem See segeln, anscheinend mehr zum Vergnügen als aus anderen Gründen, und die Amseln am Kopf der Stromschnellen singen immer; während Rotkehlchen, Kernbeißer und Douglas-Hörnchen in den Wäldern geschäftig sind, angenehme Gesellschaft leisten und das Gefühl dankbarer Abgeschiedenheit verstärken, ohne die tiefe, stille Ruhe und den Frieden zu stören.

Diese herbstliche Milde hält normalerweise bis Ende November an. Dann kommen Tage ganz anderer Art. Die Winterwolken wachsen und blühen und lassen ihre sternenklaren Kristalle auf jedes Blatt und jeden Stein fallen, und alle Farben verschwinden wie ein Sonnenuntergang. Die Hirsche versammeln sich und eilen ihre wohlbekannten Pfade entlang, aus Angst, vom Schnee eingesperrt zu werden. Sturm auf Sturm, häuft Schnee auf den Klippen und Wiesen auf und biegt die schlanken Kiefern in weiten Bögen zu Boden, eine über der anderen, sich drängend und ineinander verschlungen wie lagernder Weizen. Lawinen rauschen und donnern von den steilen Höhen und häufen riesige Haufen auf dem zugefrorenen See auf, und all die sommerliche Pracht ist begraben und verloren. Doch mitten in diesem harten Winter scheint die Sonne manchmal warm und ruft das Douglas-Eichhörnchen dazu auf, in den schneebedeckten Kiefern herumzutollen und seine verborgenen Vorräte aufzusuchen; und das Wetter ist nie so rau, dass es die Auerhähne und kleinen Kleiber und Meisen vertreibt.
Gegen Mai beginnt sich der See zu öffnen. Die heiße Sonne schickt unzählige Ströme über die Klippen und überzieht sie mit Schaum. Der Schnee verschwindet langsam und die Wiesen nehmen grüne Schattierungen an. Dann naht der Frühling mit großen Schritten; Blumen und Fliegen bereichern die Luft und den Rasen, und die Hirsche kehren in die höher gelegenen Wälder zurück wie Vögel in ein altes Nest.
Ich entdeckte diesen bezaubernden See zum ersten Mal im Herbst 1872, als ich auf dem Weg zu den Gletschern an der Quelle des Flusses war. Er erstrahlte damals in seinen fröhlichsten Farben, unbetreten, verborgen in der herrlichen Wildnis wie unerforschtes Gold. Jahr für Jahr wanderte ich an seinen Ufern entlang, ohne eine andere Spur menschlicher Natur zu entdecken als die Überreste eines indianischen Lagerfeuers und die Oberschenkelknochen eines Hirsches, die gebrochen worden waren, um an das Mark zu gelangen. Er liegt abseits der üblichen Wege der Indianer, die gerne auf zugänglicheren Feldern neben den Pfaden jagen. Ihre Kenntnis der Hirschgründe hatte sie wahrscheinlich in Zeiten des Hungers hierher gelockt, wenn sie sich ein Festmahl sichern wollten; denn die Jagd in dieser Seemulde ist wie die Jagd in einem umzäunten Park. Ich hatte nur ein paar Freunden von der Schönheit des Shadow Lake erzählt, aus Angst, er könnte zertrampelt und „verschönert“ werden wie Yosemite. Bei meinem letzten Besuch schlenderte ich auf dem Sandstreifen zwischen Wasser und Gras am Ufer entlang und las die Spuren der hier lebenden wilden Tiere. Dabei erschreckte mich eine menschliche Spur, die, wie ich sofort erkannte, einem Hirten gehörte. Denn jeder Schritt war um 35 oder 40 Grad von der üblichen Richtung abgekommen und war außerdem an der Ferse in einer unübersichtlichen, ausufernden Art überfahren, während eine Reihe runder Punkte auf der rechten Seite den Stab anzeigte, den die Hirten tragen. Nur ein Hirte konnte eine solche Spur hinterlassen, und nachdem ich ihr ein paar Minuten gefolgt war, begann ich zu befürchten, dass er vielleicht nach Weideland suchte. Denn was sonst könnte er suchen? Als ich kurz darauf von den Gletschern zurückkehrte, wurden meine schlimmsten Befürchtungen wahr. Von Norden her war eine Spur den Berghang hinuntergebahnt worden, und alle Gärten und Wiesen waren von einer Horde Heuschrecken mit Hufen zerstört worden, als ob sie von einem Feuer heimgesucht worden wären. Die Geldwechsler waren im Tempel.
Orange See
Neben diesen größeren Canyonseen, die von den Hauptflüssen des Canyons gespeist werden, gibt es viele kleinere, die hoch oben auf Felsbänken liegen, völlig unabhängig von den allgemeinen Entwässerungskanälen und natürlich aus einem sehr begrenzten Gebiet gespeist werden. Obwohl sie meist klein und flach sind, überdauern sie aufgrund ihrer Unempfindlichkeit gegenüber Lawinenschutt und dem Einschwemmen starker Ströme oft länger als andere, die um ein Vielfaches größer, aber weniger günstig gelegen sind. Wenn sie sehr flach sind, trocknen sie gegen Ende des Sommers aus; aber da ihre Becken aus nahtlosem Stein gegraben sind, erleiden sie keinen Verlust außer durch Verdunstung; und die große Schneehöhe, die bis in den Juni hinein fällt, macht ihre Trockenzeit in jedem Fall kurz.
Der Orange Lake ist ein gutes Beispiel für diese Bankform. Er liegt inmitten einer wunderschönen Gletscheroberfläche nahe dem unteren Rand der Seelinie, etwa anderthalb Meilen nordwestlich vom Shadow Lake. Sein Umfang beträgt nur etwa 100 Yards. Neben dem Wasser gibt es einen Gürtel aus Karisen mit weit überhängenden Blättern, dann in regelmäßiger Reihenfolge ein zotteliger Büschel aus Heidelbeerbüschen, eine Weidenzone mit hier und da einem Ebereschenbusch, dann eine Espenzone mit ein paar Kiefern am Rand. Diese Zonen sind natürlich konzentrisch und bilden zusammen eine Wand, hinter der sich der nackte, eispolierte Granit in alle Richtungen erstreckt und ihn auffallend hervortreten lässt, wie ein Palmenbüschel in einer Wüste.
Im Herbst, wenn die Farben reif sind, sieht der ganze kreisförmige Hain aus einiger Entfernung aus wie eine große Handvoll Blumen, die in einer Tasse frisch gehalten werden sollen – ein Büschel Goldruten. Seine Zuflüsse sind trotz ihrer Unbeständigkeit und extremen Flachheit außerordentlich schön. Sie haben keinerlei Kanal und können sich daher in dünnen Schichten auf dem glänzenden Granit ausbreiten und nach Belieben wandern. An vielen Stellen ist die Strömung weniger als einen Viertelzoll tief und fließt mit so wenig Reibung, dass sie kaum sichtbar ist. Manchmal gibt es keine einzige Schaumglocke, keine treibende Kiefernnadel oder Unregelmäßigkeit irgendeiner Art, die seine Bewegung verdeutlicht. Doch bei genauerem Hinsehen sieht man, dass er ein Netz aus gleitendem Spitzengewebe bildet, das exquisit gewebt ist und wunderschöne Spiegelbilder aus seinen winzigen, geschwungenen Wellen und Wirbeln erzeugt und sich von den Wasserspitzen großer Kaskaden dadurch unterscheidet, dass er überall transparent ist. Im Frühjahr, wenn der Schnee schmilzt, ist das Seebecken randvoll und gibt einen ziemlich großen Strom ab, der glasklar etwa 200 Meter weit fließt, bis er an einen fast senkrechten, 800 Fuß hohen Abgrund stößt, den er in einem schönen Katarakt hinabstürzt; dann sammelt er sein verstreutes Wasser und fließt sanft über sanft abfallende Granitfalten bis zu seiner Mündung in den Hauptstrom des Canyons. Während des größten Teils des Jahres hört man jedoch weder am Kopf noch am Fuß des Sees ein einziges Wassergeräusch, nicht einmal das geflüsterte Plätschern der Wellen am Ufer; denn die Winde sind draußen. Aber die tiefe Stille der Berge wird ab und zu durch Vögel versüßt, die hier Halt machen, um auf ihrem Weg über den Canyon auszuruhen und zu trinken.
See Starr König
Eine schöne Vielfalt an Bankettseen findet sich genau dort, wo die großen Seitenmoränen der Hauptgletscher von kleinen Nebengletschern in nach außen geschwungenen konzentrischen Ringen nach vorne geschoben wurden. Anstatt wie der Orange Lake von einem schmalen Ring aus Bäumen umgeben zu sein, liegen diese Seen in dichten Moränenwäldern eingebettet, so dicht, dass man auf der Suche nach ihnen immer wieder an ihnen vorbeikommt, obwohl man ungefähr weiß, wo sie verborgen liegen.
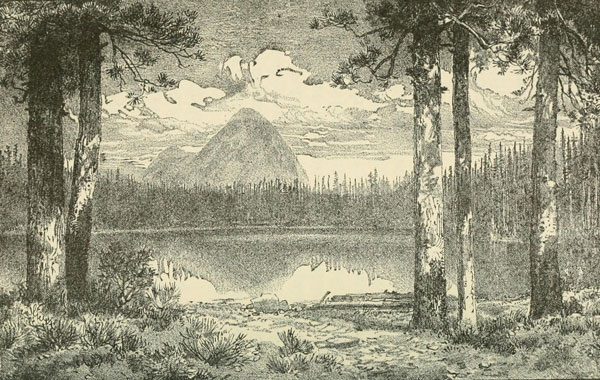
Lake Starr King, nördlich des gleichnamigen Kegels oberhalb des Little Yosemite Valley gelegen, ist ein schönes Exemplar dieser Art. Die Drosseln fliegen daran vorbei, ebenso die Enten; sie könnten kaum hineingelangen, ohne sich direkt in die ihn umringenden Bäume fallen zu lassen.
Doch diese isolierten Juwelen, die wie von den Zweigen herabgefallene Früchte daliegen, sind nicht ganz ohne Bewohner und fröhliche, animierende Besucher. Natürlich können Fische nicht in sie hineingelangen, und das gilt im Allgemeinen für fast jeden Gletschersee in der Gebirgskette, aber sie sind alle gut gefüllt mit fröhlichen Fröschen. Wie sind die Frösche überhaupt in sie hineingelangt? Vielleicht wurde ihr klebriger Laich an den Füßen von Enten oder anderen Vögeln hereingetragen, andernfalls müssen ihre Vorfahren aufregende Ausflüge durch die Wälder und die Seiten der Schluchten hinauf unternommen haben. In den stillen, reinen Tiefen dieser versteckten kleinen Seen finden Sie auch die Larven unzähliger Insekten und eine große Vielfalt an Käfern, während die Luft über ihnen voll von summenden Flügeln ist, durch deren Mitte ständig Fliegenschnäpper hin und her huschen. Und im Herbst, wenn die Heidelbeeren reif sind, kommen Scharen von Rotkehlchen und Kernbeißern zum Festmahl und bilden insgesamt entzückende kleine Nebenwelten für den Naturforscher.
Wenn wir uns nach oben in Richtung der Mittellinie des Gebirges vorarbeiten, finden wir immer mehr Seen, die jünger aussehen. Auf einer Höhe von etwa 9000 Fuß über dem Meeresspiegel scheinen sie ein mittleres Alter erreicht zu haben, das heißt, ihre Becken scheinen etwa zur Hälfte mit Schwemmland gefüllt zu sein. Breite Wiesenflächen erstrecken sich in sie hinein, an vielen Stellen unvollkommen und sumpfig und fast ebener als die der älteren Seen darunter, und die Vegetation ihrer Ufer ist natürlich alpiner. Kalmia, Lodum und Cassiope säumen die Wiesenfelsen, während die üppigen, wogenden Wälder, die für die tiefer gelegenen Seen so charakteristisch sind, nur durch Ansammlungen von Zwergkiefern und Hemlocktannen vertreten sind. Diese sind jedoch oft sehr malerisch auf felsigen Landzungen um den äußeren Rand der Wiesen gruppiert oder krönen mit noch eindrucksvollerer Wirkung eine felsige Insel.
Aus Gründen, die wir hier nicht näher erläutern können, sind die Klippen an diesen mittelalterlichen Seen außerdem selten von der massiven Art der Yosemite-Seen, sondern eher zerklüftet und weniger steil. Sie treten normalerweise zurück, so dass die Ufer verhältnismäßig frei bleiben; die wenigen steilen Felsen, die hervortreten und direkt ins tiefe Wasser abfallen, sind selten höher als 300 bis 400 Fuß.
Ich habe in keinem der Seen dieser Art bisher Enten gesehen, aber die Amsel fehlt nie, wo die Futterbäche ganzjährig Wasser führen. Auf den Wiesen sieht man gelegentlich wilde Schafe und Rehe, und sehr selten einen Bären. Man könnte wochenlang an den zerklüfteten Ufern dieser hellen Quellen campen, ohne einem größeren Tier zu begegnen als den Murmeltieren, die sich unter Gletscherblöcken entlang der Wiesenränder eingraben.
Der höchstgelegene und jüngste aller Seen liegt eingebettet in Gletscherschöße. Auf den ersten Blick erscheinen sie wie Bilder purer, blutleerer Trostlosigkeit, kleiner arktischer Meere, eingeschlossen in ewiges Eis und Schnee und überschattet von rauen, düsteren, bröckelnden Steilhängen. Ihr Wasser ist in den tiefsten Teilen von kräftigem Ultramarinblau, in den seichten Uferbereichen und an den Rändern der kleinen Eisberge, die normalerweise darin herumtreiben, lebhaft grasgrün. Gelegentlich findet man ein paar robuste Seggen, die jede Nacht vom Frost gequetscht werden und weiche Grasnarben entlang der sonnenbeschienenen Teile ihrer Ufer bilden, und wenn ihre Nordufer offen nach Süden abfallen und mit Erde bedeckt sind, egal wie grob, sind sie mit Sicherheit mit Blumen geschmückt. Jetzt fällt mir ein See im Besonderen ein, der die Blumenpracht der sonnenbeschienenen Ufer dieser eisigen Juwelen veranschaulicht. Ganz dicht unter dem Schatten des Sierra Matterhorns, am Osthang der Bergkette, liegt auf einer Höhe von etwa 12.000 Fuß einer der eisigsten dieser Gletscherseen. Ein kurzer Gletscher mit zerklüfteten Rändern kriecht von Süden her in ihn hinein, und auf der gegenüberliegenden Seite ist er von einer Reihe konzentrischer Endmoränen umgeben und aufgestaut, die der Gletscher gebildet hat, als er das Becken vollständig ausfüllte. Eine halbe Meile darunter liegt ein zweiter See auf einer Höhe von 11.500 Fuß, etwa so kalt und rein wie ein Schneekristall. Das Wasser des ersten Sees gurgelt über und durch den Moränendamm in ihn hinein, während ein zweiter Strom direkt von einem Gletscher im Südosten in ihn hineinfließt. Steile Abhänge aus kristallinem Schnee erheben sich aus dem tiefen Wasser im Süden und sorgen auf dieser Seite für ewigen Winter, aber auf der anderen Seite gibt es einen schönen Sommerfleck, obwohl der See nur etwa 300 Meter breit ist. Hier fand ich am 25. August 1873 eine zauberhafte Gesellschaft von Blumen, keine gekrümmten, hockenden Zwerge, die kaum aufblicken konnten, sondern warm und saftig, aufrecht dastehend in kräftiger, fröhlicher Farbe und Blüte. Auf einem schmalen Kiesstreifen dicht am Wasserrand standen ein paar Büschel Seggen, die ihre Samen gebildet hatten; und ein Stückchen weiter oben am felsigen Ufer, am Fuß einer bröckelnden Mauer, die so geneigt war, dass sie eine beträchtliche Menge Sonnenwärme absorbierte und abstrahlte sowie reflektierte, lag der Garten mit einem üppigen Cowania-Dickicht voller großer gelber Blüten; mehreren Büschen der Alpen-Ribe mit fast reifen, wild säuerlichen Beeren; ein paar schönen Gräsern zweier verschiedener Arten und einer Goldrute; ein paar behaarte Lupinen und strahlende Spragueas, deren blaue und rosafarbene Blüten sich wunderbar zwischen grünen Schalen abhoben; und entlang einer schmalen Naht im wärmsten Winkel der Wand ein wunderschöner Saum aus Weidenröschenmit Blüten, die einen Zoll breit sind, in üppiger Fülle dicht an dicht stehen und so königlich purpurn gefärbt sind, wie es je eine hochgezüchtete Pflanze der Tropen trug; und das Beste von allem, und das Größte von allem, eine edle Distel in voller Blüte, die aufrecht steht, Kopf und Schultern über ihren Gefährten, und ihre Lanzen mit kräftiger Kraft ausstreckt, als ob sie auf einem schottischen Hügel wächst. All diese tapfere, warme Blüte zwischen den rohen Steinen, direkt vor den Gletschern, die sie überblicken.
Soweit ich herausfinden konnte, sind diese oberen Seen im Winter bis zu einer Tiefe von etwa 10 bis 12 Metern unter Schnee begraben, und diejenigen, die Lawinen am stärksten ausgesetzt sind, sogar bis zu einer Tiefe von 30 Metern oder mehr. Letztere sind natürlich aus der Landschaft fast verschwunden. Einige bleiben bei außergewöhnlich starken Schneefällen jahrelang untergetaucht, und viele öffnen sich gegen Ende der Saison nur auf einer Seite. Der Schnee auf der geschlossenen Seite besteht aus groben Körnchen, die verdichtet und zu einer festen, schwach geschichteten Masse gefroren sind, wie der Firn eines Gletschers. Die plätschernden Wellen untergraben den offenen Teil allmählich und lassen ihn in großen Massen wie Eisberge abbrechen, wodurch eine steile Front entsteht, die der ins Meer abfallenden Wand eines Gletschers ähnelt. Das Spiel der Lichter zwischen den kristallklaren Winkeln dieser Schneeklippen, das perlmuttartige Weiß der hervorquellenden Berge, die davor treibenden, in der Sonne leuchtenden und von grünem Wasser gesäumten Eisberge und die tiefblaue Scheibe des Sees selbst, die sich bis zu Ihren Füßen erstreckt – all dies ergibt ein Bild, das Ihr ganzes Leben danach bereichert und das Sie nie vergessen werden. Doch wie perfekt die Jahreszeit und der Tag auch sein mögen, die kalte Unvollkommenheit dieser jungen Seen ist immer deutlich spürbar. Wir nähern uns ihnen mit einer Art schäbiger Vorsicht und schleichen unsicher um ihre kristallklaren Ufer herum, bestürzt und unbehaglich, als erwarteten wir eine abweisende Stimme. Doch die Liebeslieder der Amseln und die liebevollen Blicke der Gänseblümchen beruhigen uns allmählich und offenbaren die warme Quelle der Menschlichkeit, die den kältesten und einsamsten von allen durchdringt.
KAPITEL VII
DIE GLETSCHERWIESEN
Nach den Seen der High Sierra kommen die Gletscherwiesen. Sie sind glatte, ebene, seidige Rasenflächen, die eingebettet in die oberen Wälder, auf den Talböden und entlang der breiten Rücken der wichtigsten Trennberge in einer Höhe von etwa 2.400 bis 2.900 Metern über dem Meeresspiegel liegen.
Sie sind fast so eben wie die Seen, deren Platz sie eingenommen haben, und bieten eine trockene, ebene Oberfläche ohne Steinhaufen, moosigen Sumpf und die modrige Rauheit üppiger, grobblättriger, unkrautiger und strauchiger Vegetation. Der Rasen ist dicht und fein und so vollständig, dass man den Boden nicht sehen kann; und gleichzeitig so bunt mit Blumen und Schmetterlingen übersät, dass man ihn durchaus als Gartenwiese oder Wiesengarten bezeichnen könnte; denn der plüschige Rasen ist an vielen Stellen so voll mit Enzianen, Gänseblümchen, Ivesien und verschiedenen Arten von Orthocarpus, dass das Gras kaum zu sehen ist, während an anderen Stellen die Blumen nur hier und da einzeln oder in kleinen dekorativen Rosetten hervorstechen.
Das einflussreichste der Gräser, aus denen der Rasen besteht, ist ein zarter Calamagrostis mit feinen fadenförmigen Blättern und lockeren, luftigen Rispen, die wie ein purpurner Nebel über dem blühenden Rasen zu schweben scheinen. Aber so sehr ich auch schreibe, ich kann nicht annähernd eine angemessene Vorstellung von der exquisiten Schönheit dieser Bergteppiche vermitteln, wie sie glatt ausgebreitet in der wilden Wildnis liegen. Welche Worte sind schön genug, um sie zu beschreiben? Womit sollen wir sie vergleichen? Die blühenden Ebenen der Prärien des alten Westens, die üppigen Savannen des Südens und die schönsten kultivierten Wiesen sind im Vergleich dazu grob. Auf den ersten Blick kann man sie mit den sorgfältig gepflegten Rasenflächen von Vergnügungsparks vergleichen; denn sie sind ebenso unkrautfrei wie diese und ebenso glatt, aber hier endet die Ähnlichkeit; denn diese wilden Rasenflächen haben trotz ihrer ganzen exquisiten Feinheit keine Spur von diesem schmerzhaften, geleckten, geschnittenen, unterdrückten Aussehen, das Vergnügungsparkrasen selbst aus der Ferne oft haben. Und, ganz zu schweigen von den Blumen, die sie erhellen, sind ihre Gräser sehr viel feiner in Farbe und Struktur, und statt flach und bewegungslos da zu liegen, verfilzt wie ein totes grünes Tuch, reagieren sie auf die Berührung jeder Brise, erfreuen sich an purer Wildheit und blühen und tragen Früchte im lebenswichtigen Licht.
Gletscherwiesen gibt es in allen alpinen und subalpinen Regionen der Sierra in noch größerer Zahl als Seen. Wahrscheinlich gibt es zwischen 36° 30’ und 39° Breite 2500 bis 3000 davon, natürlich verteilt wie die Seen im Einklang mit allen anderen Gletschermerkmalen der Landschaft.
An den Quellgewässern der Flüsse gibt es sogenannte „Große Wiesen“, die normalerweise etwa fünf bis zehn Meilen lang sind. Sie liegen in den Becken der alten Eismeere, wo viele Nebengletscher zusammenkamen und die großen Stämme bildeten. Die meisten sind jedoch recht klein und im Durchschnitt vielleicht kaum mehr als eine Dreiviertelmeile lang.
Einer der allerschönsten der Tausenden, die ich genossen habe, liegt versteckt in einem ausgedehnten Wald aus Zweiblättrigen Kiefern, am Rande des Beckens des uralten Tuolumne Mer de Glace, etwa zwölf Kilometer westlich von Mount Dana.
Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich an den Tuolumne Soda Springs am Flussufer, eine Tagesreise oberhalb des Yosemite Valley. Sie machen sich nach Norden auf den Weg durch einen Wald, der sich endlos vor Ihnen erstreckt und scheinbar durch keinerlei Lichtungen unterbrochen wird. Sobald Sie sich im Wald befinden, sind die grauen Berggipfel mit ihren schneebedeckten Schluchten und Tälern nicht mehr zu sehen. Der Boden ist übersät mit umgestürzten Baumstämmen, die kreuz und quer übereinander liegen wie vom Sturm niedergeworfener Weizen; und neben diesem dichten Kiefernwald gedeiht auf dem reichen Moränenboden ein üppiges Wachstum von bandblättrigen Gräsern – Bromus, Triticum, Calamagrostis, Agrostis usw., die ihre schönen Ähren und Rispen bis über Ihre Taille strecken. Wenn Sie durch die fruchtbare Wildnis streifen und ab und zu interessante Dinge wie Eichhörnchen und Aaskrähen und vielleicht auch ein Reh oder einen Bären entdecken, sehen Sie nach ein oder zwei Stunden zwischen den braunen Kiefernstämmen senkrechte Sonnenstrahlen, die Ihnen zeigen, dass Sie sich einer offenen Fläche nähern. Dann treten Sie plötzlich aus den Schatten des Waldes auf einen herrlichen purpurnen Rasen, der glatt und frei im Licht liegt wie ein See. Dies ist eine Gletscherwiese. Sie ist etwa anderthalb Meilen lang und eine Viertelmeile breit. Die Bäume drängen sich in dichten Reihen vorwärts, stellen ihre Füße genau auf den Rand und halten sich aufrecht, streng und ordentlich wie Soldaten bei einer Parade. So begrenzen sie die Wiese mit exquisiter Präzision und doch mit frei geschwungenen Linien, wie sie nur die Natur zeichnen kann. Mit unaussprechlicher Freude waten Sie in den grasbewachsenen Sonnensee und fühlen sich in einer der heiligsten Kammern der Natur geborgen, abgeschirmt von den strengeren Einflüssen der Berge, sicher vor allen Störungen, sicher vor sich selbst, frei in der universellen Schönheit. Und obwohl die Szene so beeindruckend spirituell ist und Sie sich darin aufzulösen scheinen, pulsiert doch alles um Sie herum von warmer, irdischer, menschlicher Liebe und einem wunderbar gehaltvollen und vertrauten Leben. Die harzigen Kiefern sind Symbole der Gesundheit und Beständigkeit; die Rotkehlchen, die sich vom Gras ernähren, gehören zu derselben Art, die Sie seit Ihrer Kindheit kennen; und sicherlich sind diese Gänseblümchen, Rittersporne und Goldruten die Blumenfreunde des alten Hausgartens. Bienen summen wie an einem Erntedank, Schmetterlinge flattern über den Blumen, und wie sie baden Sie im lebenswichtigen Sonnenschein, zu reich und homogen freudeerfüllt, um zu partiellen Gedanken fähig zu sein. Sie sind ganz Auge, durch und durch durchdrungen von Licht und Schönheit. Wenn Sie am Bach entlangschlendern, der sich still von Osten her durch die Wiese schlängelt, rufen besondere Blumen Sie zu Ihrem Unterscheidungsbewusstsein zurück. Der Rasen wölbt sich bis zum Rand des Wassers, bildet steile, vorspringende Ufer und überlappt an einigen Stellen versenkte Felsblöcke und bildet Brücken. Hier finden Sie Matten der seltsamen Zwergweide, die kaum einen Zoll hoch sind,und doch treibt sie eine Vielzahl grauer, seidiger Kätzchen aus, die hier und da von den violetten Kelchen und Glocken der Bryanthus- und Vaccinium-Blüten erleuchtet werden.
Wohin Sie auch gehen, überall finden Sie den Rasen himmlisch schön, als hätte die Natur jede Pflanze an diesem Tag mit ihren Fingern bearbeitet und angepasst. Die schwebenden Grasrispen sind kaum zu spüren, wenn man durch sie hindurchstreicht, so rauchig sind sie, und keine der Blumen hat hohe oder starre Stiele. An den hellsten Stellen finden Sie drei Arten von Enzianen mit unterschiedlichen Blautönen, Gänseblümchen, rein wie der Himmel, seidenblättrige Ivesien mit warmen gelben Blüten, mehrere Arten von Orthocarpus mit stumpfen, dornigen Blütenständen, rot und violett und gelb; die Alpengoldrute, den Pentastemon und den Klee, duftend und honigsüß, mit ihren Farben in Massen und Mischungen. Wenn Sie die Gräser teilen und genauer hinsehen, können Sie die Verzweigung ihrer glänzenden Stiele verfolgen und die wunderbare Schönheit ihres Blütennebels, der Spelzen und Blütenblätter, die exquisit gestrichelt sind, der gelben herabhängenden Staubblätter und der federartigen Stempel bemerken. Unter den untersten Blättern entdecken Sie ein märchenhaftes Reich aus Moosen – Hypnum, Dicranum, Polytriclium und vielen anderen – deren kostbare Sporenbecher zierlich auf polierten Stielen ruhen, seltsam verhüllt oder geöffnet, und die reich verzierten Peristome zeigen, die wie Königskronen getragen werden. Kriechende Lebermoose gibt es hier ebenfalls in Hülle und Fülle, und mehrere seltene Pilzarten, außerordentlich klein, zerbrechlich und zart, als wären sie nur für die Schönheit geschaffen. Raupen, schwarze Käfer und Ameisen durchstreifen die Wildnis dieser Unterwelt und bahnen sich ihren Weg durch Miniaturhaine und Dickichte wie Bären in einem dichten Wald.
Und wie reich ist das Leben in der sonnigen Luft! Jedes Blatt und jede Blume scheint ihren geflügelten Vertreter am Himmel zu haben. Libellen schießen in kräftigen Zickzacklinien durch die tanzenden Schwärme, und eine reiche Fülle von Schmetterlingen – die Leguminosen der Insekten – ist eine schöne Ergänzung des allgemeinen Schauspiels. Viele dieser letzteren sind in dieser Höhe verhältnismäßig klein und der Wissenschaft bisher fast unbekannt; aber ab und zu segelt eine vertraute Vanessa oder ein Papilio vorbei. Auch Kolibris sind hier recht häufig, und das Rotkehlchen findet man immer am Ufer des Baches oder in den seichtesten Teilen des Rasens, und manchmal auch das Moorhuhn und die Bergwachtel mit ihren Bruten aus kostbaren, flauschigen Hühnern. Schwalben gleiten über den grasbedeckten See von einem Ende zum anderen, Fliegenschnäpper kommen und gehen in sprunghaften Flügen auf den Spitzen abgestorbener Masten, während Spechte in anmutigen Girlanden von einer Seite zur anderen schwingen – Vögel, Insekten und Blumen, die alle auf ihre eigene Art eine tiefe Sommerfreude verkünden.
Die Einflüsse der reinen Natur scheinen noch so wenig bekannt zu sein, dass allgemein angenommen wird, dass ein solches vollkommenes Vergnügen, das einem bis ins Mark vordringt, den Studenten für wissenschaftliche Beschäftigungen ungeeignet macht, bei denen kühles Urteilsvermögen und Beobachtungsgabe erforderlich sind. Aber die Wirkung ist genau das Gegenteil. Statt einen Zustand der Ausschweifungen zu erzeugen, wird der Geist befruchtet, angeregt und entwickelt wie sonnengespeiste Pflanzen. Alles, was wir hier gesehen haben, ermöglicht es uns, die Quellen zwischen den Gipfeln im Osten, aus denen die Gletscher flossen, die den Boden für den umgebenden Wald schufen, mit sichererem Blick zu erkennen; und unten am Fuße der Wiese die Moräne, die den Damm bildete, aus dem der See entstand, der dieses Becken einnahm, bevor die Wiese angelegt wurde; und am Rand die Steine, die durch die Ausdehnung des Seeeises während längst vergangener Winter zurückgeschoben und zu einer groben Mauer aufgetürmt wurden; und entlang der Seiten der Bäche die kleinen Mulden der Wiese, die jene Teile des alten Sees kennzeichnen, die als letzte verschwanden.
Ich möchte meine Leser bitten, eine Weile in dieser fruchtbaren Wildnis zu verweilen, ihre Geschichte von ihren frühesten Anfängen in der Eiszeit an zu verfolgen und so viel wie möglich über ihre wilden Bewohner und Besucher zu erfahren. Wie glücklich die Vögel den ganzen Sommer und manche von ihnen den ganzen Winter sind; wie die Beutelmurmeltiere Tunnel unter dem Schnee graben und wie schön und tapfer der verleumdete Kojote hier lebt, sowie die Hirsche und Bären! Da ich jedoch den Unterschied zwischen Lesen und Sehen gut kenne, werde ich nur um Aufmerksamkeit bitten, um einige kurze Skizzen ihrer unterschiedlichen Aspekte zu sehen, wie sie sich im Laufe der ausgeprägteren Jahreszeiten präsentieren.
Das Sommerleben, das wir beschrieben haben, dauert mit nur geringer Abschwächung bis Oktober, wenn die Nachtfröste zu stechen beginnen und die Gräser bronzen und die Blätter der kriechenden Heidekrautgewächse entlang der Bachufer rötlich-violett und purpurrot reifen lassen; während die Blumen verschwinden, alle außer den Goldruten und ein paar Gänseblümchen, die bis zum Beginn des schneereichen Winters unbeschadet weiterblühen. In stillen Nächten sind die Grasrispen und jedes Blatt und jeder Stängel mit Frostkristallen beladen, durch die die morgendlichen Sonnenstrahlen in hinreißender Pracht dringen und jeden in einen kostbaren Diamanten verwandeln, der in den Farben des Regenbogens strahlt. Die Bachseen sind quer und quer mit schlanken Eislanzen durchzogen, aber sowohl diese als auch die Graskristalle sind vor Mittag geschmolzen, und trotz der großen Höhe der Wiese sind die Nachmittage noch warm genug, um die durchgefrorenen Schmetterlinge wiederzubeleben und sie aufzufordern, sich an den spät blühenden Goldruten zu erfreuen. Das göttliche Alpenglühen erhellt jeden Abend die umliegenden Wälder, gefolgt von einer kristallklaren Nacht mit Heerscharen von Liliensternen, deren Größe und Glanz sich niemand vorstellen kann, der noch nie über das Tiefland hinausgekommen ist.
So kommen und gehen die hellen Sonnentage des Herbstes, ohne eine Wolke am Himmel, Woche für Woche bis fast Dezember. Dann kommt eine plötzliche Veränderung. Wolken von einem eigenartigen Aussehen und mit langsamem, kriechendem Gang sammeln und wachsen im Azurblau, werfen seidenartige Fransen aus und werden allmählich dunkler, bis jeder seeartige Riss und jede Öffnung geschlossen ist und das ganze gewölbte Firmament in ebenso strukturlose Düsternis gehüllt ist. Dann kommt der Schnee, denn die Wolken sind reif, die Wiesen des Himmels stehen in Blüte und verlieren ihre strahlenden Blüten wie ein Obstgarten im Frühling. Leicht, leicht lassen sie sich im braunen Gras und in den Quastennadeln der Kiefern nieder, fallen Stunde um Stunde, Tag für Tag, lautlos, liebevoll – alle Winde sind verstummt –, blicken und kreisen hierhin und dorthin, glitzern gegeneinander, die Strahlen verhaken sich in Flocken so groß wie Gänseblümchen; und dann stehen die trockenen Gräser, Bäume und Steine alle wieder in gleicher Weise in Blüte. Während der Sommermonate gibt es hier Gewitterschauer, und es ist beeindruckend, das Kommen der großen transparenten Tropfen zu beobachten, von denen jeder eine kleine Welt für sich ist – ein ununterbrochener Ozean ohne Inseln, der frei durch die Luft wirbelt wie Planeten durch den Weltraum. Aber noch beeindruckender finde ich das Kommen der Schneeblumen – Sternschnuppen, Wintergänseblümchen –, die den ganzen Boden gleichermaßen zum Blühen bringen. Regentropfen blühen strahlend im Regenbogen und verwandeln sich in Blumen im Gras, aber Schnee kommt in voller Blüte direkt aus dem dunklen, gefrorenen Himmel.
Die späteren Schneestürme werden oft von Winden begleitet, die die Kristalle bei niedrigen Temperaturen in einzelne Blütenblätter und unregelmäßige Staubpartikel zerbrechen; aber auf der Wiese weht verhältnismäßig wenig Schnee, so fest ist er in den Wäldern eingebettet. Von Dezember bis Mai folgt ein Sturm auf den anderen, bis der Schnee etwa fünf bis sechs Meter hoch ist, aber die Oberfläche ist immer so glatt wie die Brust eines Vogels.
Das Leben, das soeben noch warm schlug, ist jetzt verstummt. Die meisten Vögel sind unter die Schneegrenze gesunken, die Pflanzen schlafen und alle Fliegenflügel sind gefaltet. Doch die Sonne scheint herrlich an vielen wolkenlosen Tagen mitten im Winter und wirft lange, spitze Schatten über die blendende Weite. Im Juni beginnen kleine Flecken der toten, verrottenden Grasnarbe zu erscheinen, die sich allmählich ausbreiten und miteinander verbinden, tagsüber mit kriechenden Wasserfetzen und nachts mit Eis bedeckt sind und so hoffnungslos und leblos aussehen wie zerkleinerte Felsen, die gerade aus der Dunkelheit der Eiszeit auftauchen. Gehen Sie jetzt über die Wiese! Kaum die Erinnerung an eine Blume werden Sie finden. Der Boden scheint zweimal tot. Dennoch rückt die jährliche Auferstehung näher. Die lebensspendende Sonne ergießt ihre Fluten, der letzte Schneekranz schmilzt, Myriaden von Wachstumspunkten drängen sich eifrig durch die dampfende Erde, die Vögel kehren zurück, neue Flügel erfüllen die Luft und das glühende Sommerleben flammt auf, scheinbar noch herrlicher als zuvor.
Dies ist eine perfekte Wiese, und unter günstigen Umständen existiert sie seit Jahrhunderten, ohne dass sich merkliche Veränderungen zeigen. Trotzdem muss sie früher oder später unvermeidlich alt werden und verschwinden. Während des ruhigen Altweibersommers bewegt sich kaum ein Sandkorn um ihre Ufer, aber bei Hochwasser und Sturm wird Erde darauf gespült und in mehreren Schichten um ihren sanft abfallenden Rand herum abgelagert und allmählich bis zur Mitte ausgebreitet, wodurch sie trockener wird. Über einen beträchtlichen Zeitraum wird die Wiesenvegetation davon nicht stark beeinflusst, denn sie steigt allmählich mit dem ansteigenden Boden an und bleibt an der Oberfläche wie Wasserpflanzen, die auf der Dünung der Wellen aufsteigen. Aber schließlich geht die Hebung des Wiesenlandes so weit, dass der Boden für die spezifischen Wiesenpflanzen zu trocken wird, und sie müssen dann natürlich ihren Platz anderen überlassen, die den neuen Bedingungen angepasst sind. Die charakteristischsten Neuankömmlinge in dieser Höhe über dem Meer sind hauptsächlich sonnenliebende Gilias, Eriogonae und Compositae und schließlich Waldbäume. Von nun an sind die Veränderungen, die die Sicht verdecken, so vielfältig, dass nur noch Geologen die ursprüngliche Seeaue enthüllen und sehen können.
Im Allgemeinen verschwinden Gletscherseen langsamer als die ihnen folgenden Wiesen, da, sofern sie nicht sehr flach sind, eine größere Menge an Material erforderlich ist, um ihre Becken aufzufüllen und zu vernichten, als erforderlich ist, um die Oberfläche der Wiese zu hoch und trocken für Wiesenvegetation zu machen. Aufgrund der Verwitterung, der die angrenzenden Felsen ausgesetzt sind, ist außerdem Material der feineren Art, das durch Regen und normale Überschwemmungen weggetragen werden kann, während der Wiesenperiode reichlicher vorhanden als während der Seenperiode. Dennoch existiert zweifellos so manche schöne Wiese in günstiger Lage Tausende von Jahren in nahezu voller Schönheit, wobei der Aussterbeprozess unserer Zeitrechnung nach außerordentlich langsam ist. Dies ist insbesondere bei Wiesen der Fall, die in der Art der beschriebenen liegen – eingebettet in tiefe Wälder, deren Boden sich ringsum sanft erhebt, wobei das Netzwerk aus Baumwurzeln, in das der gesamte Boden eingebunden ist, jede schnelle reißende Abschwemmung verhindert. Doch in Ausnahmefällen werden auch mit großer Sorgfalt angelegte, schöne Rasenflächen durch Erdrutsche, Erdbebenlawinen oder außerordentliche Überschwemmungen auf einmal zerstört und ausgelöscht, genau wie Seen.
In jenen Gletscherwiesen, die die Stelle von seichten Seen einnehmen, die von schwachen Strömen gespeist wurden, sind Gletscherschlamm und feiner Pflanzenhumus in großem Maße Bestandteil der Bodenzusammensetzung. Aufgrund der geringen Tiefe dieses Bodens und des nahtlosen, wasserdichten, nicht entwässerten Zustands der Felsbecken sind sie normalerweise feucht und daher von hohen Gräsern und Seggen bewachsen, deren grobes Aussehen einen auffallenden Kontrast zu dem der oben beschriebenen zarten Rasenarten bietet. Diese Wiesen mit flachem Boden werden oft noch weiter aufgerauht und abwechslungsreicher gestaltet durch teilweise vergrabene Moränen und anschwellende Vorsprünge des Felsbetts, die mit den darauf wachsenden Bäumen und Sträuchern einen auffallenden Effekt erzeugen, da sie wie Inseln in der Grasebene hervortreten oder in schroffen Kurven von einer Waldwand zur anderen hinüberziehen.
Überall in der oberen Wiesenregion, wo Wasser ausreichend reichlich und kühl ist, bilden sich in Becken, die vor Überschwemmungen geschützt sind, schöne Sümpfe mit einem tiefen Bewuchs aus braunem und gelbem Torfmoos, malerisch zerstört durch Flecken von Kalmia und Ledum, die im Herbst in Massen wunderschöner Farben reifen. Zwischen diesen kühlen, schwammigen Sümpfen und den trockenen, blühenden Wiesen gibt es viele interessante Arten, die durch die bereits erwähnten unterschiedlichen Bedingungen ineinander übergehen und eine Reihe reizvoller Studien bilden.
HÄNGENDE WIESEN
Eine andere, sehr gut ausgeprägte und interessante Art von Wiesen, die sich sowohl in ihrer Herkunft als auch in ihrem Aussehen stark von den Seewiesen unterscheiden, findet man schräg auf moränenbedeckten Hügeln, die in Richtung des größten Abhangs verlaufen, und wogen über Felshaufen und Felsvorsprünge auf und ab wie satte grüne Bänder, die von hohen Blumen hell erleuchtet sind. Sie kommen sowohl in den alpinen als auch in den subalpinen Regionen in beträchtlicher Zahl vor und sind immer ein markantes Merkmal der Landschaft. Sie sind oft eine Meile oder mehr lang, aber nie sehr breit – normalerweise dreißig bis fünfzig Meter. Wenn die Berg- oder Canyonseite, auf der sie liegen, im erforderlichen Winkel abfällt und andere Bedingungen gleichzeitig günstig sind, erstrecken sie sich von oberhalb der Baumgrenze bis zum Boden eines Canyons oder Seebeckens, fallen in feinen, fließenden Linien wie Kaskaden ab, brechen hier und da in eine Art Gischt auf großen Felsblöcken oder teilen sich und fließen auf beiden Seiten einer vorspringenden Insel herum. Manchmal rauscht ein rauschender Bach durch sie hindurch, und dann ist kaum ein Wassertropfen zu sehen. Sie verdanken ihre Existenz jedoch sichtbaren oder unsichtbaren Bächen, wobei die wildesten Exemplare dort zu finden sind, wo eine ganzjährige Quelle, wie ein Gletscher, eine Schneebank oder eine Moränenquelle, ihr Wasser in einem verstreuten Netz schwacher, sickernder Rinnsale über eine raue Bodenfläche fließen lässt. Diese Bedingungen führen zu einer wiesenartigen Vegetation, deren sich ausdehnende Wurzeln den freien Fluss des Wassers noch mehr behindern und dazu neigen, es über eine noch größere Fläche zu verteilen. So sind der Moränenboden und die notwendige Feuchtigkeit, die für die bessere Klasse der Wiesenpflanzen erforderlich ist, manchmal ungefähr so perfekt miteinander verbunden, als ob sie glatt auf einer ebenen Fläche ausgebreitet wären. Wo der Boden zufällig aus den feineren Eigenschaften von Gletscherschutt besteht und das Wasser nicht im Übermaß vorhanden ist, kommt die Vegetation der einer Seewiese am nächsten. Aber wo, wie es häufiger der Fall ist, der Boden grob und steinig ist, ist die Vegetation entsprechend üppig. Hohe, breitblättrige Gräser nehmen ihren Platz an den Rändern ein und Binsen und nickende Karizien in den feuchteren Teilen, vermischt mit den schönsten und imposantesten Blumen – orangefarbene Lilien und Rittersporne von sieben oder acht Fuß Höhe, Lupinen, Senecios, Alium, Buntkelchgewächse, viele Arten von Mimulus und Pentstemon, das üppige kahnblättrige Veratrum alba und die prächtige Alpen-Akelei mit anderthalb Zoll langen Sporen. In einer Höhe von sieben- bis neuntausend Fuß bilden auffällige Blumen häufig den Großteil der Vegetation; dann werden die hängenden Wiesen zu hängenden Gärten.
In seltenen Fällen finden wir ein alpines Becken, dessen Boden eine reine Wiese ist und dessen Seiten fast rundherum in sanften Kurven ansteigend mit Moränenboden bedeckt sind, der, gesättigt mit schmelzendem Schnee aus den umliegenden Quellen, einen fast ununterbrochenen Gürtel aus nach unten gebogener Wiesenvegetation bildet, die anmutig in die ebene Wiese am Boden übergeht und so ein großes, glattes, weiches, von Wiesen gesäumtes Bergnest bildet. Auf Wiesen dieser Art baut der Bergbiber (Haplodon) gerne sein Zuhause, indem er gemütliche Kammern unter der Grasnarbe gräbt, Kanäle gräbt, das unterirdische Wasser nach Belieben von Kanal zu Kanal leitet und die Vegetation ernährt.
Eine andere Art von Wiesen oder Sümpfen findet sich an dicht bewaldeten Berghängen, wo kleine, ganzjährig fließende Bäche in kurzen Abständen durch umgestürzte Bäume aufgestaut wurden. Eine weitere Art hängt an glatten, flachen Abhängen herab, während sich ihnen entsprechende, schräge Wiesen entgegen erheben.
Darüber hinaus gibt es drei Arten kleiner Gletscherwiesen, eine davon befindet sich an den Ufern der Hauptbäche, eine andere auf den Gipfeln felsiger Bergrücken und die dritte auf Gletscherpflaster. Alle haben einen interessanten Ursprung und sind reich an Pflanzenschönheiten.
KAPITEL VIII
DIE WÄLDER
Die Nadelwälder der Sierra sind die großartigsten und schönsten der Welt und wachsen in einem herrlichen Klima auf den interessantesten und zugänglichsten Gebirgsketten, doch seltsamerweise sind sie nicht sehr bekannt. Vor mehr als sechzig Jahren wanderte David Douglas, ein begeisterter Botaniker und Baumliebhaber, allein durch schöne Abschnitte der wilden, wilden Zuckerkiefer- und Weißtannenwälder. Einige Jahre später unternahmen andere Botaniker kurze Reisen von der Küste in die tiefer gelegenen Wälder. Dann kam die wunderbare Schar der Bergleute in die Vorgebirgszone, die meisten von Goldstaub blind, bald gefolgt von „Schafzüchtern“, die mit Wolle über den Augen ihre Herden durch alle Waldgürtel von einem Ende der Kette zum anderen jagten. Dann wurde das Yosemite Valley entdeckt, und Tausende von bewundernden Touristen durchquerten auf ihrem Weg zu diesem wunderbaren Park Teile der unteren und mittleren Zone und erhaschten schöne Blicke auf die Zuckerkiefern und Weißtannen entlang der Ränder der staubigen Pfade und Straßen. Aber nur wenige, stark und frei, mit ungetrübten Augen vor Sorge, sind weit genug gekommen und haben lange genug mit den Bäumen gelebt, um so etwas wie eine liebevolle Vorstellung von ihrer Erhabenheit und Bedeutung zu entwickeln, die sich in der Harmonie ihrer Verbreitung und ihren wechselnden Erscheinungsformen im Laufe der Jahreszeiten zeigt, wenn sie in ihrem Winterkleid dastehen und sich an Stürmen erfreuen, wenn sie im Frühling ihre frischen Blätter austreiben und dabei harzigen Duft dampfen, wenn sie die Gewitterschauer des Sommers empfangen oder wenn sie, schwer beladen mit reifen Zapfen, im satten Sonnengold des Herbstes ruhen. Um dieses Wissen zu erlangen, muss man mit den Bäumen leben und mit ihnen wachsen, ohne Bezug zur Zeit im Sinne eines Kalenders.
Die Verteilung des Waldes in Streifen ist leicht zu erkennen. Diese erstrecken sich, wie wir gesehen haben, in regelmäßiger Ordnung von einem Ende der Bergkette zum anderen; und wie dicht und düster sie auch im Gesamtbild erscheinen mögen, weder auf den felsigen Höhen noch in den laubreichsten Tälern werden Sie etwas finden, das Sie an die feuchten, malariaverseuchten Selvas des Amazonas und des Orinoco mit ihrem „grenzenlosen Schatten“, die monotone Gleichförmigkeit der Deodar-Wälder des Himalaya, den Schwarzwald Europas oder die dichten dunklen Wälder aus Douglasien, wo der Oregon fließt, erinnert. Die riesigen Kiefern, Tannen und Mammutbäume strecken ihre Arme dem Sonnenlicht entgegen, ragen auf den Berghängen übereinander, in herrlicher Anordnung angeordnet, und geben mit unerschöpflicher Vielfalt und Harmonie den höchsten Ausdruck von Erhabenheit und Schönheit ab.

Die einladende Offenheit der Sierra-Wälder ist eines ihrer markantesten Merkmale. Die Bäume aller Arten stehen mehr oder weniger getrennt in Hainen oder in kleinen, unregelmäßigen Gruppen, so dass man fast überall einen Weg finden kann, entlang sonniger Kolonnaden und durch Öffnungen, die eine glatte, parkähnliche Oberfläche haben, die mit braunen Nadeln und Kletten übersät ist. Mal durchquert man einen wilden Garten, mal eine Wiese, mal einen farnigen, weidenbewachsenen Bach; und immer wieder taucht man aus all den Hainen und Blumen auf einem Granitpflaster oder einem hohen, kahlen Bergrücken auf, von dem aus man einen herrlichen Blick über das wogende Meer der immergrünen Pflanzen in der Ferne und in der Nähe hat.
Es würde kaum Schwierigkeiten bereiten, zu Pferd durch die aufeinanderfolgenden Gürtel bis hinauf zu den sturmgepeitschten Rändern der eisigen Gipfel zu reiten. Die tiefen Canyons, die sich jedoch von der Achse des Gebirges aus erstrecken, zerschneiden die Gürtel mehr oder weniger vollständig und verhindern, dass der berittene Reisende sie der Länge nach durchquert.
Diese einfache Einteilung in Zonen und Abschnitte macht den Wald als Ganzes für jeden Beobachter fassbar. Die verschiedenen Arten nehmen immer die gleiche relative Position zueinander ein, die durch Boden, Klima und die relative Kraft jeder Art, Boden zu erobern und zu halten, bestimmt wird. Und diese Beziehungen sind so deutlich, dass man nie in Verlegenheit geraten wird, die Höhe über dem Meeresspiegel allein anhand der Bäume auf ein paar hundert Fuß genau zu bestimmen. Denn obwohl sich einige Arten mehrere tausend Fuß weit nach oben erstrecken und alle mehr oder weniger aneinander vorbeiziehen, sind selbst diejenigen mit der größten vertikalen Verbreitung in diesem Zusammenhang erkennbar, da sie entsprechend den Höhenunterschieden neue Formen annehmen.
Wenn Sie die baumlosen Ebenen von Sacramento und San Joaquin von Westen her überqueren und die Vorgebirge der Sierra erreichen, gelangen Sie in den unteren Waldrand, der aus kleinen Eichen und Kiefern besteht, die so weit voneinander entfernt wachsen, dass an klaren Mittagstagen nicht einmal ein Zwanzigstel der Erdoberfläche im Schatten liegt. Nachdem Sie fünfzehn oder zwanzig Meilen vorgerückt sind und einen Anstieg von zwei- bis dreitausend Fuß hinter sich haben, erreichen Sie den unteren Rand des Hauptkiefergürtels, der aus riesigen Zuckerkiefern, Gelbkiefern, Weihrauchzeder und Sequoia besteht. Als nächstes kommen Sie zum prächtigen Weißtannengürtel und schließlich zum oberen Kieferngürtel, der sich in einem zwergartigen, wogenden Saum die felsigen Abhänge der Gipfel hinaufzieht und eine Höhe von zehn- bis zwölftausend Fuß erreicht.

Diese allgemeine Verteilungsordnung in Bezug auf das von der Höhe abhängige Klima ist sofort erkennbar, aber es gibt andere, in diesem Zusammenhang ebenso weitreichende Harmonien, die erst nach sorgfältiger Beobachtung und Untersuchung offensichtlich werden. Die vielleicht interessanteste davon ist die Anordnung der Wälder in langen, geschwungenen Bändern, die zu spitzenartigen Mustern zusammengeflochten und in bezaubernder Vielfalt ausgebreitet sind. Der Schlüssel zu dieser schönen Harmonie sind die alten Gletscher; wo sie flossen, folgten die Bäume ihnen und zogen ihren schwankenden Lauf entlang von Schluchten, über Bergrücken und über hohe, hügelige Hochebenen. Die Zedern des Libanon, sagt Hooker, wachsen auf einer der Moränen eines alten Gletschers. Alle Wälder der Sierra wachsen auf Moränen. Aber Moränen verschwinden wie die Gletscher, die sie bilden. Jeder Sturm, der über sie hereinbricht, verwüstet sie, schneidet Lücken, zerfällt Felsblöcke und reißt das verrottende Material in neue Formationen mit sich, bis sie schließlich nur noch von Akademikern erkannt werden, die ihre Übergangsformen von den frischen, noch im Entstehungsprozess befindlichen Moränen über die immer älteren, immer mehr von der Vegetation und allen Arten nacheiszeitlicher Verwitterung verdeckten Moränen verfolgen.
Wäre die Eisdecke, die einst die gesamte Bergkette bedeckte, gleichzeitig von den Vorgebirgen bis zu den Gipfeln geschmolzen, wären die Flanken natürlich fast kahl geblieben und diese edlen Wälder würden fehlen. Viele Gehölze und Dickichte wären zweifellos auf See- und Lawinenbetten gewachsen und viele schöne Blumen und Sträucher hätten in verwitterten Winkeln und Spalten Nahrung und einen Lebensraum gefunden, aber die Sierra als Ganzes wäre eine kahle, felsige Wüste gewesen.
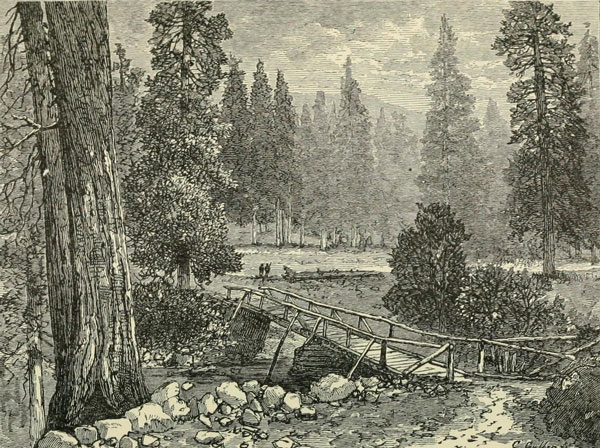
Es scheint daher, dass die Wälder der Sierra im Allgemeinen die Ausdehnung und Lage der alten Moränen ebenso anzeigen wie die Klimalinien. Denn Wälder können genau genommen nicht ohne Erde existieren; und da die Moränen auf dem festen Fels und nur an ausgewählten Stellen abgelagert wurden und einen beträchtlichen Teil der alten Gletscheroberfläche frei gelassen haben, finden wir üppige Kiefern- und Tannenwälder, die abrupt durch zerfurchte und polierte Oberflächen enden, auf denen nicht einmal Moos wächst, obwohl nur Erde erforderlich ist, um sie für das Wachstum von 200 Fuß hohen Bäumen vorzubereiten.
DIE NUSSKIEFER
(Pinus Sabiniana)
Die Nusskiefer, der erste Nadelbaum, den man beim Erklimmen der Bergkette von Westen her antrifft, wächst nur in den sengenden Vorgebirgen und scheint sich wie eine Palme an der glühendsten Sonnenhitze zu erfreuen. Sie sprießt hier und da einzeln oder in verstreuten Gruppen von fünf oder sechs zwischen struppigen Weißeichen und Dickichten aus Ceanothus und Manzanita. Ihre äußerste Obergrenze liegt etwa 4.000 Fuß über dem Meeresspiegel, ihre untere Grenze etwa 500 bis 800 Fuß.
Dieser Baum ist bemerkenswert wegen seines luftigen, weitläufigen, tropischen Aussehens, das eher an eine Region mit Palmen als an kühle, harzige Kiefernwälder erinnert. Niemand würde ihn auf den ersten Blick für einen Nadelbaum halten, so locker ist sein Wuchs und so weit verzweigt, und sein Laub ist so dünn und grau. Ausgewachsene Exemplare sind 12 bis 15 Meter hoch und haben einen Durchmesser von 60 bis 90 Zentimetern. Der Stamm teilt sich normalerweise in drei oder vier Hauptäste, etwa 4,5 bis 6 Meter über dem Boden, die, nachdem sie sich voneinander entfernt haben, gerade nach oben schießen und getrennte Spitzen bilden, während die krummen untergeordneten Äste in dekorativen Zweigen nach oben streben, strahlen und herabhängen. Die schlanken, graugrünen Nadeln sind 20 bis 30 Zentimeter lang, locker gefiedert und neigen dazu, in schönen Kurven herabzuhängen, was einen sehr auffälligen Kontrast zu dem steifen, dunkel gefärbten Stamm und den Ästen bildet. Kein anderer Baum, den ich kenne, hat von so massivem Körperbau ein so dünnes und lichtdurchlässiges Laub. Die Sonnenstrahlen dringen nahezu ununterbrochen selbst durch die laubreichsten Bäume, und der müde, erhitzte Reisende findet in ihrem Schatten nur wenig Schutz.

Die üppige Ernte nahrhafter Nüsse, die die Nusskiefer liefert, macht sie bei Indianern, Bären und Eichhörnchen beliebt. Die Zapfen sind wunderschön, 12 bis 20 Zentimeter lang und nicht viel dicker, haben eine satte schokoladenbraune Farbe und sind durch starke, nach unten gebogene Haken geschützt, die die Schuppen abschließen. Trotzdem kann das kleine Douglas-Eichhörnchen sie öffnen. Indianer, die die reifen Nüsse sammeln, bieten ein eindrucksvolles Bild. Die Männer klettern wie Bären auf die Bäume und schlagen die Zapfen mit Stöcken ab oder schneiden rücksichtslos die ertragreicheren Zweige mit Äxten ab, während die Squaws die großen, üppigen Zapfen sammeln und sie rösten, bis sich die Schuppen weit genug öffnen, um die hartschaligen Samen herauszuschlagen. Dann, an den kühlen Abenden, bilden Männer, Frauen und Kinder, deren Schmutzaufnahmefähigkeit durch das weiche Harz, mit dem sie alle bedeckt sind, noch viel größer ist, Kreise um Lagerfeuer am Ufer des nächsten Bachs und liegen in unbeschwerter Unabhängigkeit, knacken Nüsse, lachen und schwatzend und kümmern sich so wenig um die Zukunft wie die Eichhörnchen.
Pinus tuberculata
Diese eigenartige kleine Kiefer wächst in dichten, weidenbewachsenen Hainen auf einer Höhe von 1500 bis 3000 Fuß. Sie ist äußerst schlank und anmutig, obwohl Bäume, die außerhalb der Haine stehen, lange, gebogene Äste hervorbringen, die einen auffälligen Kontrast zur üblichen Hainform bilden. Das Laub hat dieselbe eigentümliche graugrüne Farbe wie das der Nusskiefer und ist etwa so locker, dass der Stamm des Baumes kaum davon verdeckt wird.

Im Alter von sieben oder acht Jahren beginnt er, Zapfen zu tragen, nicht an den Zweigen, sondern an der Hauptachse, und da sie nie abfallen, ist der Stamm bald malerisch mit ihnen übersät. Auch die Zweige werden fruchtbar, wenn sie eine ausreichende Größe erreicht haben. Die durchschnittliche Größe der älteren Bäume beträgt etwa neun bis zwölf Meter Höhe und zwölf bis vierzehn Zoll Durchmesser. Die Zapfen sind etwa vier Zoll lang, außerordentlich hart und mit einer Art kieselsäurehaltigem Lack und Gummi überzogen, wodurch sie feuchtigkeitsundurchlässig sind, offensichtlich im Hinblick auf die sorgfältige Konservierung der Samen.
Kein anderer Nadelbaum in diesem Gebirge ist so stark auf bestimmte Standorte beschränkt. Normalerweise findet man ihn abseits, tief im Chaparral an sonnigen Hügel- und Canyonhängen, wo der Boden nur wenig Tiefe hat, und wo er überhaupt vorkommt, ist er in großer Menge vorhanden; aber der gewöhnliche Reisende, der den Fahrstraßen und Pfaden folgt, kann das Gebirge viele Male erklimmen, ohne ihm zu begegnen.
Als ich den unteren Teil des Merced Cañon erkundete, traf ich einen einsamen Bergarbeiter, der sein Glück in einer Quarzader an einem wilden Berghang suchte, der mit diesem einzigartigen Baum bepflanzt war. Er erzählte mir, dass er ihn wegen der Weiße und Zähigkeit des Holzes Hickory-Kiefer nannte. Er ist jedoch so wenig bekannt, dass man kaum von einem gebräuchlichen Namen sprechen kann. Die meisten Bergsteiger bezeichnen ihn als „diese seltsame kleine Kiefer, die über und über mit Kletten bedeckt ist“. Bei meinen Studien zu dieser Art stieß ich auf eine Reihe sehr interessanter und bedeutsamer Fakten, deren Zusammenhänge sich fast sofort erschließen werden:
1. Alle Bäume in den von mir untersuchten Hainen sind, wie unterschiedlich groß sie auch sein mögen, gleich alt.
2d. Diese Haine sind alle auf trockenen, mit Chaparral bewachsenen Hügeln gepflanzt und laufen daher Gefahr, von Feuer erfasst zu werden.
3d. In den lebenden Hainen oder in ihrer Nähe gibt es keine Setzlinge oder Schösslinge, aber auf dem Boden, der früher von einem Hain eingenommen wurde, der durch das Abbrennen des Chaparrals zerstört wurde, sprießt immer eine schöne, hoffnungsvolle Ernte.
4. Die Zapfen fallen nie ab und geben ihre Samen nicht ab, bis der Baum oder Ast, zu dem sie gehören, stirbt.

Eine ausführliche Diskussion der Zusammenhänge dieser Tatsachen wäre hier vielleicht nicht angebracht, aber ich möchte zumindest auf die bewundernswerte Anpassung des Baumes an die feuergepeitschten Regionen aufmerksam machen, in denen er nur vorkommt. Nachdem ein Hain zerstört wurde, wird der Boden sofort großzügig mit allen Samen besät, die während seines gesamten Lebens gereift sind und die anscheinend für eine solche Katastrophe sorgfältig aufbewahrt wurden. Dann sprießt sofort ein junger Hain, der Schönheit statt Asche bietet.
ZUCKERKIEFER
(Pinus Lambertiana)
Dies ist die edelste Kiefer, die je entdeckt wurde. Sie übertrifft alle anderen nicht nur an Größe, sondern auch an königlicher Schönheit und Erhabenheit.
Es ragt erhaben von jedem Grat und jeder Schlucht der Bergkette auf, in einer Höhe von 3.000 bis 7.000 Fuß über dem Meeresspiegel, und erreicht seine vollkommenste Entwicklung in einer Höhe von etwa 5.000 Fuß.
Ausgewachsene Exemplare sind üblicherweise etwa 220 Fuß hoch und haben in Bodennähe einen Durchmesser von sechs bis acht Fuß, obwohl man gelegentlich auch großen alten Patriarchen begegnet, die fünf oder sechs Jahrhunderte Stürmen standgehalten haben und eine Dicke von zehn oder gar zwölf Fuß erreicht haben, wobei sie von unverwestem, in jeder Faser süßem und frischem Holz leben.
Im südlichen Oregon, wo er zuerst von David Douglas an den Quellgewässern des Umpqua entdeckt wurde, erreicht er noch größere Ausmaße. Ein Exemplar wurde gemessen, das 245 Fuß hoch und über 18 Fuß im Durchmesser war, drei Fuß über dem Boden. Der Entdecker war der Douglas, nach dem die edle Douglas-Fichte benannt ist, und viele andere Pflanzen, die seine Erinnerung frisch und süß halten werden, solange Bäume und Blumen geliebt werden. Sein erster Besuch an der Pazifikküste fand im Jahr 1825 statt. Die Oregon-Indianer beobachteten ihn neugierig, als er in den Wäldern umherwanderte und Exemplare sammelte, und im Gegensatz zu den Pelz sammelnden Fremden, die sie bis dahin kannten, kümmerte er sich nicht um den Handel. Und als sie ihn schließlich besser kennenlernten und sahen, dass von Jahr zu Jahr die wachsenden Pflanzen der Wälder und Prärien seine einzigen Ziele waren, nannten sie ihn „Der Mann des Grases“, ein Titel, auf den er stolz war. Während seines ersten Sommers auf den Gewässern des Columbia machte er Fort Vancouver zu seinem Hauptquartier und unternahm von diesem Posten in der Hudson Bay aus Ausflüge in alle Richtungen. Auf einer seiner langen Reisen entdeckte er in der Tasche eines Indianers einige Samen einer neuen Kiefernart, von denen er erfuhr, dass sie von einem sehr großen Baum weit südlich des Columbia-Nationalparks stammten. Am Ende des nächsten Sommers kehrte er nach Einsetzen der Winterregen nach Fort Vancouver zurück und machte sich, die große Kiefer im Sinn, von der er gehört hatte, auf die Suche nach ihr, und begab sich auf eine Exkursion ins Willamette-Tal. Wie es ihm erging und welche Gefahren und Strapazen er erdulden musste, kann man am besten in seinem eigenen Tagebuch schildern, aus dem ich wie folgt zitiere:
Oktober26. 1826. Das Wetter war trüb. Kalt und bewölkt. Wenn meine Freunde in England von meinen Reisen erfahren, fürchte ich, werden sie denken, ich hätte ihnen nur von meinen Leiden erzählt … Ich verließ mein Lager früh am Morgen, um die Nachbarländer zu erkunden, und überließ meinem Führer die Pferde bis zu meiner Rückkehr am Abend. Etwa eine Stunde Fußmarsch vom Lager entfernt traf ich einen Indianer, der, als er mich bemerkte, sofort seinen Bogen spannte, sich einen Ärmel aus Waschbärfell um den linken Arm legte und sich in Abwehrhaltung begab. Da ich ganz sicher war, dass sein Verhalten aus Angst und nicht aus feindseligen Absichten hervorging, da der arme Kerl wahrscheinlich noch nie zuvor ein Wesen wie mich gesehen hatte, legte ich mein Gewehr zu meinen Füßen auf den Boden und winkte ihm mit der Hand zu, zu mir zu kommen, was er langsam und mit großer Vorsicht tat. Dann ließ ich ihn seinen Bogen und seinen Köcher mit Pfeilen neben mein Gewehr legen, und als ich ein Feuer anzündete, gab ich ihm Rauch aus meiner eigenen Pfeife und ein paar Perlen als Geschenk. Mit meinem Bleistift fertigte ich eine grobe Skizze des Zapfens und der Kiefer an, die ich mir zulegen wollte, und lenkte seine Aufmerksamkeit darauf, woraufhin er sofort mit der Hand auf die fünfzehn oder zwanzig Meilen entfernten Hügel im Süden zeigte; und als ich ihm meine Absicht kundtat, dorthin zu gehen, machte er sich freudig auf den Weg, um mich zu begleiten. Gegen Mittag erreichte ich meine lang ersehnten Kiefern und verlor keine Zeit, sie zu untersuchen und zu versuchen, Exemplare und Samen zu sammeln. Neue und seltsame Dinge hinterlassen selten einen starken Eindruck und werden daher häufig überschätzt; damit ich meine Freunde in England nicht nie sehe, um ihnen mündlich von diesem wunderschönen und immens großartigen Baum zu erzählen, werde ich hier die Maße des größten Baums angeben, den ich unter mehreren finden konnte, die vom Wind umgeweht worden waren. In 3 Fuß Höhe über dem Boden beträgt sein Umfang 57 Fuß 9 Zoll; in 134 Fuß Höhe 17 Fuß 5 Zoll; die äußerste Länge beträgt 245 Fuß…. Da es unmöglich war, auf den Baum zu klettern oder ihn zu fällen, versuchte ich, die Zapfen mit Kugeln abzuwerfen, als der Knall meines Gewehrs acht Indianer herbeilockte, alle mit roter Erde bemalt und mit Bogen, Pfeilen, Speeren mit Knochenspitzen und Feuersteinmessern bewaffnet. Sie schienen alles andere als freundlich. Ich erklärte ihnen, was ich wollte, und sie schienen zufrieden und setzten sich hin, um zu rauchen; aber bald sah ich, wie einer von ihnen seinen Bogen spannte und ein anderer sein Feuersteinmesser mit einer hölzernen Zange schärfte und es an das Handgelenk seiner rechten Hand hängte. Weitere Beweise für ihre Absichten waren unnötig. Mich durch Flucht zu retten, war unmöglich, also trat ich ohne zu zögern etwa fünf Schritte zurück, spannte mein Gewehr, zog eine der Pistolen aus meinem Gürtel und hielt sie in meiner linken Hand und das Gewehr in meiner rechten, was meine Entschlossenheit zum Kampf um mein Leben zum Ausdruck brachte. So gut es ging, versuchte ich, die Ruhe zu bewahren, und so standen wir da und sahen uns an, ohne uns zu bewegen oder ein Wort zu sagen, vielleicht zehn Minuten lang.als endlich einer, der anscheinend der Anführer war, ein Zeichen gab, dass er etwas Tabak wollte; ich bedeutete ihnen, dass sie ihn bekommen sollten, wenn sie eine Menge Zapfen holten. Sie machten sich sofort auf die Suche nach ihnen, und kaum waren sie alle außer Sicht, nahm ich meine drei Zapfen und einige Zweige von den Bäumen und zog mich so schnell wie möglich zurück. Ich eilte zum Lager zurück, das ich vor Einbruch der Dunkelheit erreichte … Ich schreibe jetzt, während ich im Gras liege, mein Gewehr neben mir gespannt, und schreibe diese Zeilen im Licht meiner kolumbianischen Kerze, nämlich einem entzündeten Stück Kolophoniumholz.
Diese unter solch aufregenden Umständen entdeckte stattliche Kiefer wurde von Douglas zu Ehren seines Freundes Dr. Lambert aus London benannt.
Der Stamm ist ein glatter, runder, zart verjüngter Schaft, meist ohne Äste und von sattem Purpurbraun, meist belebt durch Büschel gelber Flechten. An der Spitze dieses prächtigen Stammes schwingen sich lange, gebogene Äste anmutig nach außen und unten und bilden manchmal eine palmenartige Krone, die aber weitaus edler und eindrucksvoller ist als jede Palmenkrone, die ich je gesehen habe. Die Nadeln sind etwa drei Zoll lang, fein gezähnt und in ziemlich engen Quasten an den Enden schlanker Zweige angeordnet, die die langen, nach außen geschwungenen Äste bedecken. Wie schön sie im Wind singen und welch auffallend harmonische Wirkung die riesigen zylindrischen Zapfen erzielen, die locker von den Enden der Hauptäste herabhängen! Niemand weiß, was die Natur in Sachen Kiefernbohrer zu bieten hat, bis er die der Zuckerkiefer gesehen hat. Sie sind normalerweise 15 bis 18 Zoll lang und drei Zoll im Durchmesser; grün, auf der der Sonne zugewandten Seite dunkelviolett schattiert. Sie sind im September und Oktober reif. Dann öffnen sich die flachen Schuppen und die Samen fliegen auf, aber die leeren Zapfen werden noch schöner und wirksamer, denn ihr Durchmesser verdoppelt sich durch das Ausbreiten der Schuppen fast und ihre Farbe ändert sich zu einem warmen Gelbbraun; während sie den ganzen folgenden Winter und Sommer am Baum schwingen und sogar viele Jahre nach dem Abfallen noch immer ihre Schönheit auf dem Boden behalten. Das Holz ist herrlich duftend und hat eine feine Maserung und Struktur; es hat ein sattes Cremegelb, als ob es aus gebündelten Sonnenstrahlen gebildet wäre. Retinospora obtusa, Siebold , die Pracht der östlichen Wälder, wird von den Japanern „Fu-si-no-ki“ (Baum der Sonne) genannt; die Zuckerkiefer ist der Sonnenbaum der Sierra. Leider wird sie von den Holzfällern sehr geschätzt und ist an zugänglichen Stellen immer der erste Baum im Wald, der ihren Stahl zu spüren bekommt. Aber die normalen Holzfäller mit ihren Sägemühlen haben bisher im Allgemeinen weniger Zerstörung angerichtet als die Schindelmacher. Das Holz lässt sich problemlos spalten und es besteht eine ständige Nachfrage nach Dachschindeln. Und da eine Axt, eine Säge und eine Maschine das einzige Kapital sind, das für das Geschäft erforderlich ist, gehen viele dieser in Kalifornien so häufig vorkommenden, unsteten Männer ein paar Monate im Jahr diesem Geschäft nach. Wenn Goldsucher, Jäger, Rancharbeiter usw. ihr „letztes Geld“ anrühren und sich arbeitslos wiederfinden, sagen sie: „Na ja, ich kann wenigstens zu den Zuckerkiefern gehen und Dachschindeln herstellen.“ Ein paar Pfosten werden in den Boden geschlagen und ein einziges Stück Holz, das vom ersten gefällten Baum geschnitten wird, ergibt genug Bretter für die Wände und das Dach einer Hütte; alles andere, was der Holzfäller herstellt, wird verkauft und er ist schnell unabhängig. Kein Gärtner oder Heumacher duftet süßer als diese rauen Bergbewohner, wenn sie diesem Geschäft nachgehen, aber die Verwüstung, die sie anrichten, ist höchst beklagenswert.
ZUCKERKIEFER AUF FREIEN KIEFERKAMM.
Der Zucker, von dem der gebräuchliche Name abgeleitet ist, ist für meinen Geschmack die beste Süßigkeit – besser als Ahornzucker. Er tritt aus dem Kernholz aus, wo Wunden durch Waldbrände oder die Axt entstanden sind, in Form unregelmäßiger, knuspriger, bonbonartiger Körner, die in Massen von beträchtlicher Größe zusammengedrängt sind, wie Ansammlungen von Harzkügelchen. Frisch ist er vollkommen weiß und köstlich, aber da die meisten Wunden, an denen er gefunden wird, durch Feuer entstanden sind, hinterlässt der austretende Saft auf der verkohlten Oberfläche Flecken und der gehärtete Zucker wird braun. Indianer mögen ihn gern, aber aufgrund seiner abführenden Wirkung dürfen nur kleine Mengen davon gegessen werden. Bären, die im Allgemeinen so gern Süßes mögen, scheinen ihn nie zu probieren; zumindest habe ich in diesem Zusammenhang keine Spur ihrer Zähne finden können.
Kein Baumliebhaber wird je seine erste Begegnung mit der Zuckerkiefer vergessen, noch wird er später einen Dichter brauchen, der ihn auffordert: „Höre, was die Kiefer sagt.“ Die meisten Kiefern weisen eine Gleichförmigkeit im Ausdruck auf, die den meisten Menschen schnell eintönig wird, denn die typische, spindelförmige Gestalt, so schön sie auch sein mag, bietet nur wenig Raum für einen erkennbaren individuellen Charakter. Die Zuckerkiefer ist so frei von Konventionen in Form und Bewegung wie jede Eiche. Keine zwei Bäume sind gleich, nicht einmal für den unaufmerksamsten Beobachter, und obwohl sie immer ihre riesigen Arme in scheinbar extravagantesten Gesten ausstrecken, strahlen sie eine Majestät und Ruhe aus, die jede Möglichkeit des Grotesken oder gar Pittoresken in ihrem Gesamtausdruck ausschließt. Sie sind die Priester der Kiefern und scheinen sich immer an den umgebenden Wald zu wenden. Die Gelbkiefer wächst mit ihnen an warmen Berghängen und die Weißtanne an kühlen Nordhängen. aber so edel diese auch sind, die Zuckerkiefer ist mühelos König und breitet seine Arme segnend über ihnen aus, während sie sich zum Zeichen der Anerkennung wiegen und wedeln. Die Hauptäste sind manchmal vierzig Fuß lang, aber durchweg einfach und teilen sich selten, außer in der Nähe des Endes; alles, was wie ein kahles Kabel aussieht, wird jedoch durch die kleinen, quastenförmigen Zweige verhindert, die sich überall um sie herum erstrecken; und wenn diese prächtigen Äste symmetrisch nach allen Seiten ausladen, entsteht eine sechzig oder siebzig Fuß breite Krone, die, anmutig auf der Spitze des edlen Schafts balanciert und von Sonnenschein erfüllt, eines der prächtigsten Waldobjekte ist, die man sich vorstellen kann. Normalerweise überwiegen jedoch die Äste stark nach Osten, weg von der Richtung der vorherrschenden Winde.
Keine andere Kiefer kommt mir so fremd und eigenständig vor. Wenn wir uns ihr nähern, haben wir das Gefühl, in der Gegenwart eines höheren Wesens zu sein, und beginnen mit leichten Schritten und angehaltenem Atem zu gehen. Dann, während wir ehrfürchtig starren, kommt vielleicht ein fröhliches Eichhörnchen daher, schnattert und lacht, um den Zauber zu brechen, rennt ohne Umstände den Stamm hinauf und nagt die Zapfen ab, als wären sie nur für es gemacht; während der Holzspecht auf die Rinde hämmert und Löcher bohrt, in denen er seinen Wintervorrat an Eicheln lagert.

Obwohl die Zuckerkiefer im ausgewachsenen Zustand so wild und unkonventionell ist, ist sie in ihrer Jugend ein bemerkenswert anständiger Baum. Der alte Baum hat von allen immergrünen Bäumen der Sierra das ursprünglichste und eigenständigste Aussehen; der junge Baum ist der regelmäßigste – ein strikter Anhänger der Nadelbaummode – schlank, aufrecht, mit belaubten, biegsamen Zweigen, die genau an ihrem Platz gehalten werden, wobei jeder im Umriss spitz zuläuft und in einer spitzen Spitze endet. Die aufeinanderfolgenden Übergangsformen zwischen der vorsichtigen Ordentlichkeit der Jugend und der kühnen Freiheit der Reife bieten ein reizvolles Studienobjekt. Im Alter von fünfzig oder sechzig Jahren beginnt die schüchterne, modische Form aufzubrechen. Spezialisierte Zweige drängen sich an den unvorstellbarsten Stellen hervor und biegen sich mit den großen Zapfen, wodurch sofort ein individueller Charakter erkennbar wird, und dieser wird von Jahr zu Jahr durch die unterschiedliche Einwirkung von Sonnenlicht, Wind, Schneestürmen usw. ständig verstärkt, sodass die Individualität des Baumes im allgemeinen Wald nie wieder verloren geht.
Der beständigste Begleiter dieser Art ist die Gelbkiefer, und sie ist ein würdiger Begleiter.

Auch Douglasien, Libocedrus, Sequoia und Weißtannen werden mehr oder weniger mit ihm in Verbindung gebracht; aber an vielen tiefgründigen Berghängen, in einer Höhe von etwa 5000 Fuß über dem Meeresspiegel, bildet er den Großteil des Waldes und füllt jede Anhöhe, jede Mulde und jede abfallende Schlucht. Die majestätischen Kronen, die sich in kühnen Kurven einander nähern, bilden ein herrliches Dach, durch das die milden Sonnenstrahlen strömen, die Nadeln versilbern und die massiven Stämme und den blühenden, parkähnlichen Boden vergoldet machen, sodass ein bezaubernder Anblick entsteht.
Auf den sonnigsten Hängen breitet sich die weiß blühende, duftende Chamoebatia wie ein Teppich aus, der im Frühsommer durch die purpurroten Sarcodes, die Wildrose und unzählige Veilchen und Gilias erhellt wird. Nicht einmal in den schattigsten Winkeln findet man üppiges, unordentliches Unkraut oder ungesunde Dunkelheit. Auf den Nordseiten der Bergrücken sind die Stämme schlanker und der Boden ist größtenteils von einem Unterholz aus Haselnuss, Ceanothus und blühendem Hartriegel bedeckt, das jedoch nie so dicht ist, dass es den Reisenden daran hindert, dorthin zu schlendern, wo er will; während die krönenden Zweige nie undurchdringlich für die Sonnenstrahlen sind und nie so ineinander verwachsen sind, dass sie ihre Eigenständigkeit verlieren.
Betrachten Sie den Wald von unten oder von der Spitze eines eindrucksvollen Bergrückens; jeder Baum ist für sich genommen eine Augenweide und zeugt von der unübertroffenen Erhabenheit seiner Art.
GELBE ODER SILBERNE KIEFER
(Pinus ponderosa)
Die Silberkiefer oder Gelbkiefer, wie sie allgemein genannt wird, ist unter den Kiefern der Sierra die zweitwichtigste Nutzholzart und kann es in puncto Wuchs und edlem Portwein fast mit der Zuckerkiefer aufnehmen. Aufgrund ihrer überlegenen Fähigkeit, Klima- und Bodenschwankungen zu überstehen, ist sie größer verbreitet als alle anderen Nadelbäume der Sierra. Am Westhang kommt sie erstmals in einer Höhe von etwa 2000 Fuß vor und reicht fast bis zur oberen Grenze der Waldgrenze. Von dort überquert sie die Bergkette auf den niedrigsten Pässen, steigt zur östlichen Basis hinab und dringt ein beträchtliches Stück in die heißen vulkanischen Ebenen vor, wo sie tapfer auf gut bewässerten Moränen, kiesigen Seebecken, arktischen Bergrücken und heißen Lavabetten wächst, sich auf den Rändern von Kratern niederlässt, selbst dort kräftig gedeiht und reife Zapfen zwischen die Asche und Schlacke der Herde der Natur wirft.
Die durchschnittliche Größe ausgewachsener Bäume am Westhang, wo sie mit der Zuckerkiefer in Verbindung stehen, beträgt etwas weniger als 200 Fuß in der Höhe und einen Durchmesser von fünf bis sechs Fuß, obwohl man leicht Exemplare finden kann, die erheblich größer sind. Ich habe einen Baum gemessen, der in einer Höhe von 4000 Fuß im Tal des Merced wächst, der einige Zoll über acht Fuß im Durchmesser und 220 Fuß hoch ist.
Wo es reichlich freies Sonnenlicht gibt und andere Bedingungen günstig sind, stellt er in seiner Form einen auffallenden Kontrast zur Zuckerkiefer dar, da er eine symmetrische Spitze hat, die aus einem geraden, runden Stamm besteht, der mit unzähligen Ästen bedeckt ist, die sich immer wieder teilen. Ungefähr die Hälfte des Stamms ist normalerweise astlos, aber wo er dicht wächst, sind drei Viertel oder mehr kahl; der Baum hat dann einen schlankeren und eleganteren Schaft als jeder andere Baum im Wald. Die Rinde ist meist in massiven Platten angeordnet, von denen einige vier oder fünf Fuß lang und achtzehn Zoll breit sind, mit einer Dicke von drei oder vier Zoll, was ein ziemlich markantes und unverwechselbares Merkmal darstellt. Die Nadeln haben eine schöne, warme, gelbgrüne Farbe, sind sechs bis acht Zoll lang, fest und elastisch und drängen sich in schönen, strahlenden Quasten an den nach oben gebogenen Enden der Äste. Die Zapfen sind etwa drei oder vier Zoll lang und zweieinhalb Zoll breit und wachsen in dichten, sitzenden Büscheln zwischen den Blättern.
PINUS PONDEROSA
Die Art erreicht ihre edelste Form in aufgefüllten Seebecken, insbesondere in denen der älteren Yosemite-Berge, und nimmt dort einen so prominenten Platz ein, dass man sie durchaus als Yosemite-Kiefer bezeichnen kann. Reife Exemplare an günstigen Standorten sind fast immer 200 Fuß oder mehr hoch, und die Äste bedecken den Stamm fast bis zum Boden, wie auf der Abbildung zu sehen ist.
Die Jeffrey-Art erreicht ihre beste Entwicklung im nördlichen Teil des Gebirges, in den weiten Becken der Flüsse McCloud und Pitt, wo sie prächtige Wälder bildet, in die kaum ein anderer Baum eindringt. Sie unterscheidet sich von der gewöhnlichen Form in der Größe – sie ist nur etwa halb so hoch – und in ihrer rötlicheren und dichter gefurchten Rinde, ihrem graugrünen Laub, ihren weniger gespaltenen Zweigen und größeren Zapfen; es gibt jedoch Zwischenformen, die eine klare Unterscheidung unmöglich machen, obwohl einige Botaniker sie als eigenständige Art betrachten. Es ist diese Art, die sturmgepeitschte Bergrücken erklimmt und zwischen den Vulkanen des Großen Beckens umherwandert. Ob sie extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt ist, sie wird wie jeder andere Baum kleinwüchsig und hat nur noch Knoten und Winkel, ganz anders als die majestätischen Formen, die wir skizziert haben. Alte Exemplare, deren Zapfen etwa so groß wie Ananas sind, kann man manchmal in über 2.100 bis 2.400 Metern Höhe an zerklüfteten Felsen klammern finden, und ihre höchsten Äste reichen kaum über die Schultern.
210 Fuß hohe Silberkiefer. (Die Art wächst im Yosemite Valley.)
Ich habe mich oft an der Schönheit dieser edlen Bäume erfreut, wenn sie in ihrer ganzen winterlichen Pracht aufragten, beladen mit Schnee – eine einzige Blütenmasse; auch im Sommer, wenn die braunen, stämmigen Büschel dicht zwischen den schimmernden Nadeln hängen und die großen violetten Kletten im milden Licht reifen; aber diese kolossalen Kiefern sind bei wolkenlosen Stürmen am eindrucksvollsten schön. Dann neigen sie sich wie Weiden, ihre Blätter strömen alle in eine Richtung, und wenn die Sonne im erforderlichen Winkel auf sie scheint, leuchten ganze Haine, als wäre jedes Blatt aus poliertem Silber. Der Fall des tropischen Lichts auf die königliche Krone einer Palme ist ein wahrhaft herrliches Schauspiel, die glühende Sonnenflut, die in langen, lanzenförmigen Strahlen auf den glänzenden Blättern bricht, wie Bergwasser zwischen Felsblöcken. Aber für mich hat der Lichteinfall auf diese Silberkiefern noch etwas Beeindruckenderes. Es scheint zu feinstem Staub zermahlen zu sein und löst sich in Myriaden winziger Funken auf, die aus dem tiefsten Herzen der Bäume zu kommen scheinen, als ob sie wie Regen, der auf fruchtbaren Boden fällt, absorbiert worden wären, um in Blumen aus Licht wieder aufzutauchen.
Diese Art gibt auch dem Wind die schönste Musik. Nachdem ich ihr bei allen Windarten, Tag und Nacht, Jahreszeit für Jahreszeit zugehört habe, glaube ich, dass ich allein durch diese Kiefernmusik meine Position in den Bergen annähernd bestimmen könnte. Wenn Sie die Töne einzelner Nadeln hören möchten, klettern Sie auf einen Baum. Sie sind wohltemperiert und geben keinen undeutlichen Ton von sich, jede steht hervor, ohne Interferenz, außer bei schweren Stürmen; dann können Sie das Klicken einer Nadel auf die andere hören, das sich leicht von ihrem freien, flügelartigen Summen unterscheidet. Eine Vorstellung von ihrer Temperament kann man aus der Tatsache gewinnen, dass die Schwingungen, die das eigentümliche Schimmern des Lichts verursachen, trotz ihrer langen Dauer mit einer Frequenz von etwa zweihundertfünfzig pro Minute erfolgen.
Wenn man eine Zuckerkiefer und eine Pflanze dieser Art von gleicher Größe zusammen beobachtet, fällt auf, dass letztere viel schlichter und anmutiger ist und ihre Schönheit leichter zu schätzen ist; andererseits ist sie aber auch viel weniger würdevoll und originell in ihrem Benehmen. Die Silberkiefer scheint es kaum erwarten zu können, in die Höhe zu schießen. Selbst wenn sie im Gold der Herbstsonne schlummert, kann man noch immer ein Streben nach dem Himmel erkennen. Aber die Zuckerkiefer scheint zu unbewusst edel und in jeder Hinsicht zu vollkommen, um auch nur Raum für eine himmlische Sorge zu lassen.
DOUGLAS-FICHTE
(Pseudotsuga Douglasii)
Dieser Baum ist der König der Fichten, so wie die Zuckerkiefer der König der Kiefern ist. Sie ist bei weitem die majestätischste Fichte, die ich je in einem Wald gesehen habe, und eine der größten und langlebigsten der Riesen, die im gesamten Hauptkiefergürtel gedeihen. Sie erreicht oft eine Höhe von fast 200 Fuß und einen Durchmesser von sechs oder sieben Fuß. Wo der Wuchs nicht zu dicht ist, reichen die starken, sich ausbreitenden Äste mehr als bis zur Hälfte des Stammes, und diese sind mit unzähligen schlanken, schwankenden Zweigen behangen, die hübsch mit den kurzen Blättern gefiedert sind, die in rechten Winkeln um sie herum strahlen. Diese kräftige Fichte ist immer schön, begrüßt die Bergwinde und den Schnee ebenso wie das milde Sommerlicht und behält ihre jugendliche Frische unvermindert von Jahrhundert zu Jahrhundert durch tausend Stürme hindurch.
In den Monaten Juni und Juli hat er seine schönste Erscheinung. Die satten braunen Knospen, die seine Zweige zieren, schwellen zu dieser Zeit an und brechen auf. Dadurch kommen die jungen Blätter zum Vorschein, die zunächst leuchtend gelb sind und den Baum aussehen lassen, als sei er mit bunten Blüten bedeckt. Die herabhängenden, mit Hochblättern versehenen Zapfen mit ihren muschelartigen Schuppen sind eine ständige Zierde.
Die jungen Bäume stehen meist in schönen Familiengruppen, wobei jeder einzelne Setzling herrlich symmetrisch ist. Die Hauptäste sind regelmäßig um die Achse gewunden, meist zu fünft, und jeder ist mit langen, federähnlichen Zweigen bedeckt, die in Kurven herabfallen, die so frei und fein gezeichnet sind wie die von fallendem Wasser.
In Oregon und Washington wächst er in dichten Wäldern, wird hoch und mastartig bis zu einer Höhe von 300 Fuß und wird als Nutzholzbaum sehr geschätzt. In der Sierra ist er jedoch zwischen anderen Bäumen verstreut oder bildet kleine Wäldchen, die selten höher als 5500 Fuß werden und nie das bilden, was man einen Wald nennen würde. Er ist nicht wählerisch in seiner Bodenwahl – nass oder trocken, glatt oder steinig, er kommt auf allen gut zurecht. Zwei der größten Exemplare, die ich gemessen habe, stehen im Yosemite Valley, eines davon hat einen Durchmesser von mehr als acht Fuß und wächst auf der Endmoräne des Restgletschers, der den South Fork Canon bedeckte; das andere ist fast genauso groß und wächst auf eckigen Granitblöcken, die von der steilen Front des Liberty Cap in der Nähe des Nevada Fall abgeschüttelt wurden. Kein anderer Baum scheint sich so gut an Erdbebenschutt anpassen zu können, und viele dieser schroffen Felshänge sind fast ausschließlich von ihm bewachsen, insbesondere in den von der Gischt der Wasserfälle befeuchteten Schluchten des Yosemite-Nationalparks.
Weihrauchzeder
(Libocedrus läuft)
Die Weihrauchzeder ist ein weiterer der Riesen, die in diesem Teil des Waldes weit verbreitet sind, ohne jedoch eine bedeutende Fläche ausschließlich einzunehmen oder sogar ausgedehnte Wälder zu bilden. Sie erreicht an den wärmeren Hängen eine Höhe von etwa 5000 Fuß und erreicht das für sie angenehmste Klima in einer Höhe von etwa 3000 bis 4000 Fuß. In dieser Höhe wächst sie auf allen Bodenarten kräftig und kann insbesondere mehr Feuchtigkeit um ihre Wurzeln herum vertragen als alle ihre Artgenossen, mit Ausnahme des Sequoia.
Die größten Exemplare sind etwa 150 Fuß hoch und haben einen Durchmesser von sieben Fuß. Die Rinde ist braun und hat einen außergewöhnlich satten Farbton, der Künstler sehr anspricht, und das Laub ist in einem wärmeren Gelb gefärbt als das jeder anderen immergrünen Pflanze im Wald. Wenn Sie Ihren Blick von einem Bergkamm aus über den Wald schweifen lassen, genügt schon die Farbe seiner spitzen Spitzen, um ihn in jeder Gesellschaft zu erkennen.

In der Jugend, sagen wir bis zum Alter von siebzig oder achtzig Jahren, bildet kein anderer Baum einen so streng verjüngten Kegel von oben nach unten. Die Äste sind in kräftigen Kurven nach außen und unten gebogen, mit Ausnahme der jüngeren Äste in der Nähe der Spitze, die nach oben streben, während die untersten bis zum Boden hängen und sich alle in flachen, farnartigen Federbüscheln ausbreiten, die wunderschön mit Wedeln bewachsen und übereinander gestapelt sind. Mit zunehmendem Alter wächst er auffallend unregelmäßig und malerisch. Große, besondere Äste wachsen im rechten Winkel vom Stamm ab, bilden große, sture Ellbogen und schießen dann parallel zur Achse nach oben. Sehr alte Bäume sind an der Spitze normalerweise abgestorben, die Hauptachse ragt über reichliche Mengen grüner Federbüschel hinaus, die grau und mit Flechten bedeckt sind und von den Spechten mit Eichellöchern vollgebohrt wurden. Die Federbüschel sind außerordentlich schön; kein wehender Farnwedel in einem schattigen Tal ist in Form und Struktur uneingeschränkter schön oder auch nur halb so inspirierend in Farbe und würzigem Duft. In seiner Blütezeit ist der ganze Baum mit ihnen bedeckt, so dass sie Regen und Schnee wie ein Dach abhalten und schöne Unterkünfte für sturmgeplagte Vögel und Bergsteiger bilden. Aber wenn Sie den Libocedrus in seiner ganzen Pracht sehen möchten, müssen Sie im Winter in die Wälder gehen. Dann ist er mit Myriaden von vierseitigen, staminierten Zapfen beladen, die etwa so groß sind wie Weizenkörner – Winterweizen –, die einen goldenen Schimmer erzeugen und ein edles Beispiel für die unsterbliche Kraft und Männlichkeit der Natur darstellen. Die fruchtbaren Zapfen sind etwa drei Viertel Zoll lang und befinden sich an der Außenseite der gefiederten Zweige, wo sie dazu dienen, die überragende Schönheit dieser großartigen, im Winter blühenden Goldrute noch mehr zu bereichern.
WEISSE WEISSTANNE
(Abies concolor)
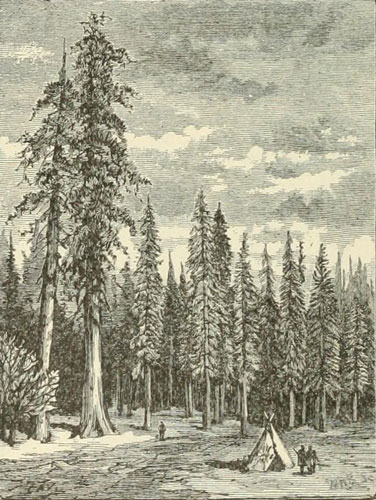
Wir kommen nun zu dem am regelmäßigsten angepflanzten aller Hauptwaldgürtel, der fast ausschließlich aus zwei Edeltannen besteht – A. concolor und A. magnifica . Er erstreckt sich ohne nennenswerte Unterbrechung über 450 Meilen in einer Höhe von 5.000 bis fast 9.000 Fuß über dem Meeresspiegel. In seiner Jugend ist A. concolor ein reizend symmetrischer Baum mit Zweigen, die in regelmäßigen Wirbeln um seine weißlich-graue Achse gewunden sind, die in einem starken, hoffnungsvollen Trieb endet. Die Blätter stehen in zwei waagerechten Reihen entlang von Zweigen, die normalerweise weniger als acht Jahre alt sind, und bilden schöne Federbüschel, die wie die Wedel von Farnen gefiedert sind. Die Zapfen sind im reifen Zustand graugrün, zylindrisch, etwa 3 bis 4 Zoll lang und 1,5 bis 2 Zoll breit und stehen aufrecht auf den oberen Zweigen.
Ausgewachsene Bäume, die hinsichtlich Boden und Ausrichtung günstig gelegen sind, sind etwa 200 Fuß hoch und haben in Bodennähe einen Durchmesser von fünf bis sechs Fuß, obwohl größere Exemplare keineswegs selten sind.
Mit fortschreitendem Alter wird die Rinde rauer und grauer, die Zweige verlieren ihre exakte Regelmäßigkeit, viele werden vom Schnee gebogen oder abgebrochen und die Hauptachse wird oft doppelt oder anderweitig unregelmäßig, wenn die Endknospe oder der Endtrieb verletzt wird. Doch trotz aller Wechselfälle seines Lebens in den Bergen ist die edle Erhabenheit dieser Art, komme was wolle, für jedes Auge offensichtlich.
Prächtige Silbertanne oder Rottanne
(Abies magnifica)
Von allen Riesen der Sierra-Wälder ist er der reizvollste und symmetrischste Baum. In dieser Hinsicht übertrifft er seine Artgenossen bei weitem. Von ihnen unterscheidet man ihn leicht an seiner purpurroten Rinde, die zudem stärker gefurcht ist als die der weißen Art, an seinen größeren Zapfen, seinen regelmäßiger quirligen und mit Wedeln versehenen Zweigen und an seinen Blättern, die kürzer sind, rund um die Zweige wachsen und nach oben zeigen.
In der Größe sind diese beiden Weißtannen etwa gleich groß, die Magnifica ist vielleicht etwas größer. Exemplare von 200 bis 250 Fuß Höhe sind auf gut geschliffenem Moränenboden in einer Höhe von 7500 bis 8500 Fuß über dem Meeresspiegel keine Seltenheit. Die größte, die ich gemessen habe, steht drei Meilen vom Rand der Nordwand des Yosemite Valley entfernt. Vor fünfzehn Jahren war sie 240 Fuß hoch und hatte einen Durchmesser von etwas mehr als fünf Fuß.
Glücklich der Mensch, der die Freiheit und die Liebe hat, auf einen dieser prächtigen Bäume in voller Blüte und Früchten zu klettern. Wie bewundernswert das Waldwerk der Natur ist, wenn man sich seinen Weg durch die Mitte der breiten, mit Wedeln besetzten Äste bahnt, die alle in exquisiter Ordnung um den Stamm angeordnet sind wie die quirligen Blätter von Lilien, und jeder Ast und jedes Ästchen ungefähr so streng gefiedert ist wie der symmetrischste Farnwedel. Man sieht die männlichen Zapfen in üppiger Fülle von der Unterseite der jungen Äste gerade nach unten wachsen und schöne purpurfarbene Büschel inmitten des graugrünen Laubes bilden. Auf den obersten Ästen stehen die fruchtbaren Zapfen fest aufrecht wie kleine Fässer. Sie sind ungefähr sechs Zoll lang, drei Zoll breit, mit einem feinen grauen Flaum bedeckt und mit Kristallbalsam durchzogen, der aussieht, als sei jeder Zapfen von oben übergossen worden.
Beide Weißtannen werden 250 Jahre oder länger alt, wenn die Bedingungen um sie herum einigermaßen günstig sind. Oft sieht man einen ehrwürdigen Patriarchen, der stark von Stürmen gezeichnet ist und in strenger Majestät über der heranwachsenden Generation thront, mit einem schützenden Wäldchen aus jungen Bäumen, die sich eng um seine Füße drängen, und die alle mit so viel Liebe gepflegt werden, dass kein Blatt zu fehlen scheint. Andere Gruppen bestehen aus Bäumen in der Blüte ihres Lebens, die in Form und Geste wunderbar aufeinander abgestimmt sind, als hätte die Natur sie mit feiner Unterscheidung einen nach dem anderen aus dem Rest des Waldes ausgewählt.

Von diesem Baum, der von den Holzfällern Rottanne genannt wird, schneiden die Bergsteiger immer Äste ab, um darauf zu schlafen, wenn sie das Glück haben, sich innerhalb seiner Grenzen aufzuhalten. Zwei Reihen plüschiger Äste, die sich in der Mitte überlappen, und eine Sichel aus kleineren Federn, gemischt mit Farnen und Blumen, bilden als Kissen das allerbeste Bett, das man sich vorstellen kann. Die Essenzen der gepressten Blätter scheinen jede Pore des Körpers zu füllen, das Geräusch fallenden Wassers verbreitet eine beruhigende Stille, während die Zwischenräume zwischen den großen Türmen edle Öffnungen bieten, durch die man verträumt in den Sternenhimmel blicken kann. Selbst in Sachen sinnlicher Bequemlichkeit erscheint jede Kombination aus Stoff, Stahlfedern und Federn im Vergleich dazu vulgär.
Die Tannenwälder sind zu jeder Jahreszeit ein herrliches Plätzchen zum Spazierengehen, aber im Herbst ist es besonders schön. Dann sind die edlen Bäume im dunstigen Licht verhüllt und triefen vor Balsam; die Zapfen sind reif und die Samen mit ihren üppigen violetten Flügeln fleckig die Luft wie Schmetterlingsschwärme; während Rehe, die in den blühenden Lichtungen zwischen den Wäldern fressen, und Vögel und Eichhörnchen in den Zweigen für eine angenehme Stimmung sorgen, die die tiefe, brütende Ruhe der Wildnis bereichert und jedem Baum eine besondere Pracht verleiht. Kein Wunder, dass der begeisterte Douglas vor Freude außer sich geriet, als er diese Art zum ersten Mal entdeckte. Sogar in der Sierra, wo so viele edle immergrüne Bäume Bewunderung aussprechen, verweilen wir mit neuer Liebe zwischen diesen riesigen Tannen und preisen ihre Schönheit immer wieder, als ob kein anderer Baum auf der Welt fortan unsere Beachtung verdienen könnte.
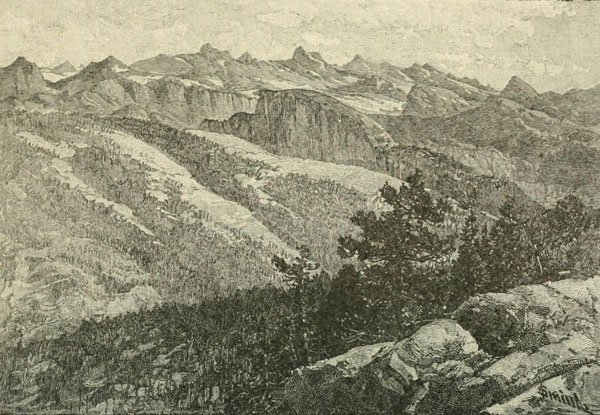
In diesen Wäldern erheben sich die großen Granitkuppeln, die ein so markantes und charakteristisches Merkmal der Sierra sind. Und hier finden wir auch die schönsten Gartenwiesen. Sie liegen eben auf den Gipfeln der Trennkämme oder abfallend an deren Seiten, eingebettet in den herrlichen Wald. Einige dieser Wiesen sind größtenteils von Veratrumalba bewachsen , die hier üppig und hoch wächst, mit bootförmigen Blättern von 33 cm Länge und 30 cm Breite, die wie die von Cypripedium gerippt sind. Akelei wächst an den trockeneren Rändern mit hohen Ritterspornen und hüfttiefen Lupinen in Gräsern und Seggen; auch mehrere Arten von Castilleia sind ein leuchtender Anblick in Beeten aus blauen und weißen Veilchen und Gänseblümchen. Aber die Pracht dieser Waldwiesen ist eine Lilie – L. parvum . Die Blüten sind orangefarben und recht klein, die kleinsten echten Lilien, die ich je gesehen habe; Aber dennoch ist er ein Hingucker, denn er wird sieben bis acht Fuß hoch und lässt seine prächtigen Trauben aus zehn bis zwanzig Blüten oder mehr über dem Kopf wehen, während er auf freiem Gelände hervorsticht und gerade genug Gras und andere Pflanzen um sich hat, um einen Rand für seine Füße zu bilden und so optimal zur Geltung zu kommen.
Ein trockener Fleck etwas abseits vom Rand eines Weißtannen-Liliengartens ist ein herrlicher Campingplatz, besonders dort, wo der Hang nach Osten zeigt und einen Blick auf die fernen Gipfel entlang des Gipfels der Bergkette bietet. Die hohen Lilien kommen im Licht Ihres lodernden Lagerfeuers in all ihrer Pracht zum Vorschein und heben sich von der Dunkelheit draußen ab. Die nächsten Bäume mit ihren wirbelnden Zweigen ragen wie größere Lilien über Ihnen auf, und der Himmel, den man durch die Gartenöffnung sieht, erscheint wie eine einzige weite Wiese aus weißen Liliensternen.
Am Morgen ist alles fröhlich und hell, das köstliche Purpurrot der Morgendämmerung wechselt sanft zu Narzissengelb und -weiß, während die Sonnenstrahlen, die durch die Pässe zwischen den Gipfeln strömen, jedem von ihnen einen goldenen Rand verleihen. Dann fangen die Spitzen der Tannen in den Tälern der mittleren Region das Glühen ein, und Ihr Lagerhain ist mit Licht erfüllt. Die Vögel beginnen sich zu regen, suchen sonnige Zweige am Rand der Wiese für ein Sonnenbad nach der kalten Nacht und suchen nach ihrem Frühstück, jedes von ihnen so frisch wie eine Lilie und so reizend gekleidet. Unzählige Insekten beginnen zu tanzen, die Hirsche ziehen sich von den offenen Lichtungen und Berggipfeln in ihre blattreichen Verstecke im Chaparral zurück, die Blumen öffnen sich und richten ihre Blütenblätter auf, während der Tau verschwindet, jeder Puls schlägt hoch, jede Lebenszelle freut sich, selbst die Felsen scheinen vor Leben zu kribbeln, und man fühlt, wie Gott über allem brütet, ob groß oder klein.
GROSSER BAUM
(Sequoia gigantea)
Zwischen den dichten Kiefern- und Weißtannengürteln finden wir den Big Tree, den König aller Nadelbäume der Welt, „den edelsten einer edlen Rasse“. Er erstreckt sich in einem weit unterbrochenen Gürtel von einem kleinen Wäldchen am mittleren Arm des American River bis zur Quelle des Deer Creek, eine Entfernung von etwa 260 Meilen, wobei die nördliche Grenze nahe dem 39. Breitengrad liegt, die südliche etwas unterhalb des 36. Breitengrads, und die Höhe des Gürtels über dem Meeresspiegel variiert zwischen etwa 5000 und 8000 Fuß. Vom Wäldchen am American River bis zum Wald am King’s River kommt die Art nur in kleinen isolierten Gruppen vor, die so spärlich entlang des Gürtels verteilt sind, dass drei der Lücken darin 40 bis 60 Meilen breit sind. Doch vom King’s River nach Süden beschränkt sich der Sequoia-Wald nicht auf bloße Haine, sondern erstreckt sich in herrlichen Wäldern über die breiten, zerklüfteten Becken der Flüsse Kaweah und Tule, eine Entfernung von fast siebzig Meilen, wobei die Kontinuität dieses Teils des Gürtels nur durch tiefe Schluchten unterbrochen wird. Der Fresno, der größte der nördlichen Haine, nimmt eine Fläche von drei bis vier Quadratmeilen ein, ein kurzes Stück südlich des berühmten Mariposa-Hains. Entlang des abgeschrägten Randes der Schlucht des südlichen Arms des King’s River gibt es einen majestätischen Sequoia-Wald, der etwa sechs Meilen lang und zwei Meilen breit ist. Dies ist die nördlichste Ansammlung großer Bäume, die man mit Fug und Recht als Wald bezeichnen kann. Wenn Sie die steile Wasserscheide zwischen dem King’s River und Kaweah hinabsteigen, betreten Sie die großartigen Wälder, die den Hauptteil des Gürtels bilden. Je weiter sie nach Süden vordringen, desto unbändiger werden die Riesen, die ihre massiven Kronen von jedem Bergrücken und Hang in den Himmel strecken und sich anmutig der komplizierten Topographie der Region anpassen. Der schönste Teil des Kaweah-Gürtels befindet sich auf dem breiten Grat zwischen Marble Creek und dem mittleren Arm und erstreckt sich von den Granitvorsprüngen über den heißen Ebenen bis auf wenige Meilen an die kühlen Gletscherquellen der Gipfel heran. Die äußerste Obergrenze des Gürtels wird zwischen dem mittleren und südlichen Arm des Kaweah auf einer Höhe von 2.500 Metern erreicht. Der schönste Block des Big Tree-Waldes im gesamten Gürtel befindet sich jedoch am nördlichen Arm des Tule River. In den nördlichen Wäldern gibt es vergleichsweise wenige junge Bäume oder Setzlinge. Doch hier gibt es für jeden alten, vom Sturm heimgesuchten Riesen viele in voller Pracht und bester Lebenskraft und für jeden von ihnen eine Menge eifriger, hoffnungsvoller junger Bäume und Setzlinge, die kräftig auf Moränen, Felsvorsprüngen, entlang von Wasserläufen und im feuchten Schwemmland der Wiesen wachsen und scheinbar heiß auf der Jagd nach dem ewigen Leben sind.

Aber obwohl das von dieser Art eingenommene Gebiet von Norden nach Süden so stark zunimmt, gibt es keine merkliche Zunahme der Größe der Bäume. Eine Höhe von 275 Fuß und ein Durchmesser in Bodennähe von etwa 20 Fuß ist vielleicht die Durchschnittsgröße ausgewachsener Bäume an günstigen Standorten. Exemplare mit 25 Fuß Durchmesser sind nicht sehr selten und einige sind fast 300 Fuß hoch. Im Calaveras Grove gibt es vier Bäume mit einer Höhe von über 300 Fuß, von denen der höchste bei sorgfältiger Messung 325 Fuß misst. Der größte, den ich bisher im Laufe meiner Erkundungen gesehen habe, ist ein majestätisches altes, vernarbtes Monument im King’s River Forest. Sein Durchmesser beträgt innerhalb der Rinde 4 Fuß über dem Boden. Unter den günstigsten Bedingungen werden diese Riesen wahrscheinlich 5000 Jahre oder älter, obwohl selbst die größten Bäume nur wenige mehr als halb so alt werden. Ich habe nie einen großen Baum gesehen, der eines natürlichen Todes gestorben wäre. Sofern keine Unfälle passieren, scheinen sie unsterblich zu sein und sind frei von allen Krankheiten, die andere Bäume befallen und töten. Sofern sie nicht vom Menschen zerstört werden, leben sie unbegrenzt weiter, bis sie verbrennen, vom Blitz zertrümmert oder von Stürmen umgeworfen werden oder der Boden, auf dem sie stehen, nachgibt. Ein Baum, der im Calaveras Grove gefällt wurde, um seinen Stumpf als Tanzfläche zu verwenden, war etwa 1300 Jahre alt, und sein Durchmesser, quer über den Stumpf gemessen, betrug innerhalb der Rinde 24 Fuß. Ein anderer Baum, der im King’s River Forest gefällt wurde, war etwa gleich groß, aber fast tausend Jahre älter (2200 Jahre), obwohl er nicht sehr alt aussah. Er wurde gefällt, um ein Stück für eine Ausstellung zu erhalten, und so bot sich die Gelegenheit, seine Jahresringe zu zählen. Das oben erwähnte kolossale, vernarbte Denkmal im King’s River-Wald ist zur Hälfte abgebrannt, und ich verbrachte einen Tag damit, sein Alter zu schätzen, indem ich die verkohlte Oberfläche mit einer Axt wegräumte und die Jahresringe mithilfe einer Taschenlupe sorgfältig zählte. Die Holzringe in dem Abschnitt, den ich freigelegt habe, waren an manchen Stellen so verwickelt und verdreht, dass ich sein Alter nicht genau bestimmen konnte, aber ich zählte über 4000 Ringe, die zeigten, dass dieser Baum in seiner Blütezeit war und sich in den Sierra-Winden wiegte, als Christus auf Erden wandelte. Soweit ich weiß, hat kein anderer Baum auf der Welt so viele Jahrhunderte lang auf ihn herabgeblickt wie der Sequoia oder bietet so eindrucksvolle und eindrucksvolle Einblicke in die Geschichte.
Sogar die mächtigsten dieser Monarchen der Wälder sind in all ihren Proportionen und Verhältnissen so wunderbar harmonisch und ausgewogen, dass sie niemals überwuchert oder monströs aussehen. Wenn Sie sie zum ersten Mal sehen, werden Sie wahrscheinlich sagen: „Oh, sehen Sie, was für schöne, edel aussehende Bäume dort zwischen den Tannen und Kiefern aufragen!“ Ihre Erhabenheit ist vorerst größtenteils unsichtbar, wird sich dem lebenden Auge jedoch früher oder später offenbaren und sich langsam in die Sinne schleichen, wie die Erhabenheit der Niagarafälle oder die erhabenen Kuppeln des Yosemite-Gebirges. Ihre enorme Größe bleibt dem unerfahrenen Beobachter verborgen, solange er sie aus der Ferne in einem harmonischen Blick betrachtet. Wenn Sie sich ihnen jedoch nähern und um sie herumgehen, beginnen Sie, über ihre enorme Größe zu staunen und nach einem Maßstab zu suchen. Diese Giganten wölben sich an der Basis beträchtlich, aber nicht mehr, als für Schönheit und Sicherheit erforderlich ist; und der einzige Grund, warum diese Wölbung in manchen Fällen übertrieben erscheint, ist, dass man bei näherer Betrachtung nur einen vergleichsweise kleinen Abschnitt des Schafts auf Anhieb sieht. Ein Baum, den ich im King’s River Forest gemessen habe, hatte einen Durchmesser von 25 Fuß am Boden und 10 Fuß in 200 Fuß Höhe, was zeigt, dass die Verjüngung des Stammes als Ganzes bezaubernd schön ist. Und wenn man weit genug zurücktritt, um die massiven Säulen vom anschwellenden Spann bis zum hohen Gipfel zu sehen, die sich in einer Kuppel aus Grün auflösen, erfreut man sich an der unvergleichlichen Darstellung kombinierter Erhabenheit und Schönheit. Etwa 100 Fuß oder mehr des Stammes sind normalerweise astlos, aber seine massive Einfachheit wird durch die Rindenfurchen aufgelockert, die statt eines unregelmäßigen Netzwerks gleichmäßig parallel verlaufen, wie die Kannelierung einer architektonischen Säule, und in gewissem Maße durch Büschel schlanker Zweige, die leicht im Wind wehen und Schattenflecken werfen und hier und da nur der Schönheit wegen angesteckt zu sein scheinen. Die jungen Bäume haben schlanke, einfache Äste bis zum Boden, die mit strenger Regelmäßigkeit wachsen, oben scharf nach oben streben, etwa auf halber Höhe horizontal sind und an der Basis in schönen Kurven herabhängen. Wenn der Setzling fünf- oder sechshundert Jahre alt ist, geht diese spirig-federartige, jugendliche Wuchsform in die feste, abgerundete Kuppelform des mittleren Alters über, die wiederum die exzentrische Malerische des Alters annimmt. Kein anderer Baum im Sierra-Wald hat so dichtes Laub oder weist so fest gezeichnete und so fest einem speziellen Typus untergeordnete Umrisse auf. Ein knotiger, unkontrollierbar aussehender Ast von fünf bis acht Fuß Dicke kann abrupt aus dem glatten Stamm hervortreten, als ob er die regelmäßige Kurve mit Sicherheit durcheinanderbringen würde, aber sobald die allgemeine Kontur erreicht ist, bleibt er abrupt stehen und löst sich in sich ausbreitende Büschel gesetzestreuer Zweige auf, gerade so, als ob jeder Baum unter einer riesigen, unsichtbaren Glasglocke wachsen würde.an dessen Seiten jeder Zweig gedrückt und geformt wurde, und dennoch gibt es so viele kleine Abweichungen von der regulären Form, dass immer noch der Anschein von Freiheit besteht.
Das Laub der Setzlinge ist dunkel bläulich-grün, während die älteren Bäume zu einem warmen bräunlich-gelben Farbton wie Libocedrus heranreifen. Die Rinde ist satt zimtbraun, bei jungen Bäumen und in schattigen Teilen der alten violett, während der Boden mit braunen Blättern und Kletten bedeckt ist, die Farbmassen von außerordentlicher Fülle bilden, ganz zu schweigen von den Blumen und dem Unterholz, die sich zu ihrer Jahreszeit an ihnen erfreuen. Gehen Sie zu jeder Jahreszeit durch die Sequoia-Wälder und Sie werden sagen, dass sie die schönsten und majestätischsten der Erde sind. Überall begegnen Ihnen schöne und eindrucksvolle Kontraste: die Farben von Baum und Blume, Fels und Himmel, Licht und Schatten, Stärke und Gebrechlichkeit, Ausdauer und Vergänglichkeit, Gewirr geschmeidiger Haselnussbüsche, Baumsäulen, die etwa so starr sind wie Granitkuppeln, Rosen und Veilchen, die kleinsten ihrer Art, die um die Füße der Riesen blühen, und Teppiche der bescheidenen Chamaebatia, auf die die Sonnenstrahlen fallen. Im Winter brechen die Bäume dann in Blüte aus, Myriaden kleiner vierseitiger männlicher Zapfen drängen sich an den Enden der schlanken Zweige, färben den ganzen Baum und bestäuben, wenn sie reif sind, die Luft und den Boden mit goldenem Pollen. Die fruchtbaren Zapfen sind hell grasgrün, etwa zwei Zoll lang und eineinhalb Zoll dick und bestehen aus etwa vierzig festen, rautenförmigen Schuppen, die dicht gepackt sind und an deren Basis jeweils fünf bis acht Samen sitzen. Ein einzelner Zapfen enthält daher zwei- bis dreihundert Samen, die etwa ein Viertel Zoll lang und drei Sechzehntel Zoll breit sind und einen dünnen, flachen Rand haben, der sie im Fallen wie den Drachen eines Jungen hin und her wirbeln lässt. Die Fruchtbarkeit von Sequoia kann durch zwei Musteräste mit einem Durchmesser von eineinhalb und zwei Zoll veranschaulicht werden, auf denen ich 480 Zapfen gezählt habe. Kein anderer Konifere der Sierra produziert annähernd so viele Samen. Millionen von Samen werden jährlich von einem einzigen Baum geerntet, und in einem fruchtbaren Jahr würde das Produkt eines der nördlichen Wälder ausreichen, um alle Gebirgsketten der Welt zu bepflanzen. Die Natur sorgt jedoch dafür, dass nicht ein Samenkorn von einer Million überhaupt keimt, und von denen, die es tun, überlebt vielleicht nicht einmal eins von zehntausend die vielen Wechselfälle von Sturm, Dürre, Feuer und Schneesturm, die ihre Jugend heimsuchen.
Das Douglas-Hörnchen ist der freudige Ernter der meisten Sequoia-Zapfen. Von hundert fallen ihm vielleicht neunzig zu, und wenn sie nicht von seiner Elfenbeinsichel abgeschnitten werden, schütteln sie ihre Samen aus und bleiben viele Jahre am Baum. Den Eichhörnchen im Altweibersommer bei ihrer Erntearbeit zuzusehen, ist eine der schönsten Freizeitbeschäftigungen, die man sich vorstellen kann. Die Wälder sind ruhig, und die reifen Farben leuchten in all ihrer Pracht. Die mit Zapfen beladenen Bäume stehen reglos in der warmen, dunstigen Luft, und Sie können die Waldschnepfe mit dem purpurnen Schopf sehen, den Fürsten der Sierra-Spechte, wie er mit seinem Schnabel irgendwelche abgestorbenen Äste oder umgestürzten Stämme anbohrt und ab und zu die Täler mit seinem fröhlichen Gackern erfüllt. Auch der Kolibri lebt in diesen edlen Wäldern, und man kann ihn oft dabei beobachten, wie er zwischen den Blumen umherspäht oder sich mit müden Flügeln auf einem blattlosen Zweig ausruht. Hier gibt es auch das bekannte Rotkehlchen der Obstgärten und die Braun- und Grizzlybären, die so offensichtlich für diese majestätische Einsamkeit geeignet sind; und das Douglas-Eichhörnchen, das für mehr lustige, ausgelassene und lebendigere Aufregung sorgt als alle Bären, Vögel und summenden Flügel zusammen.
Sobald der Krone dieser Sequoias etwas zustößt, sie beispielsweise vom Blitz getroffen oder von Stürmen abgebrochen wird, scheinen die Äste unter der Wunde, egal wo sie sich befinden, aufgeregt zu sein wie ein Bienenvolk, das seine Königin verloren hat, und streben danach, den Schaden zu reparieren. Äste, die jahrhundertelang im rechten Winkel zum Stamm nach außen gewachsen sind, beginnen sich nach oben zu drehen, um bei der Bildung einer neuen Krone zu helfen, wobei jeder rasch die besondere Form echter Spitzen annimmt. Selbst bei bloßen Stümpfen, die halb durchgebrannt sind, versucht ein bloßer Zierbüschel, in die Höhe zu wachsen und sein Bestes zu geben, um als Anführer bei der Bildung eines neuen Kopfes zu dienen.
Gruppen von zwei oder drei dieser prächtigen Bäume stehen oft dicht beieinander. Die Samen, aus denen sie entstanden, sind wahrscheinlich auf Boden gewachsen, der durch den Fall eines großen Baumes einer früheren Generation für sie freigelegt wurde. Diese Flecken frischer, weicher Erde neben den nach oben gerichteten Wurzeln des umgestürzten Riesen können 12 bis 18 Meter breit sein und werden schnell von Setzlingen besetzt. Aus diesen Setzlingsdickichten können vielleicht zwei oder drei zu Bäumen werden und jene engen Gruppen bilden, die „drei Grazien“, „liebende Paare“ usw. genannt werden. Denn selbst wenn man annimmt, dass die Bäume in jungen Jahren 6 bis 9 Meter voneinander entfernt stehen, werden sich ihre Stämme, wenn sie ausgewachsen sind, berühren und aneinander drängen und in einigen Fällen sogar wie ein einziger erscheinen.
Es wird allgemein angenommen, dass dieser großartige Sequoia-Baum einst weitaus weiter über die Sierra verbreitet war. Nach langen und sorgfältigen Studien bin ich jedoch zu dem Schluss gekommen, dass dies zumindest seit dem Ende der Eiszeit nie der Fall war, da eine sorgfältige Suche entlang der Ränder der Wälder und in den Lücken dazwischen keine einzige Spur seiner früheren Existenz außerhalb seiner heutigen Grenzen zutage fördert. Trotzdem bin ich überzeugt, dass, wenn heute jeder Sequoia-Baum in der Bergkette aussterben würde, zahlreiche Monumente ihrer Existenz erhalten blieben, die so unvergänglich sind, dass sie dem Forscher auch in mehr als zehntausend Jahren noch zur Verfügung stehen.
Zunächst fällt auf, dass keine andere Nadelbaumart in diesem Gebiet ihre Einzelexemplare so gut zusammenhält wie der Sequoia. Eine Meile ist vielleicht die größte Entfernung, die ein Nachzügler vom Hauptbestand zurücklegt, und alle diese Nachzügler, die mir aufgefallen sind, sind keine alten, monumentalen Bäume, sondern junge Relikte eines ausgedehnteren Wuchses.
Sequoia-Stämme überdauern nach ihrem Umfallen oft Jahrhunderte. Ich habe einen Probenblock, der aus einem umgestürzten Stamm geschnitten wurde und kaum von Proben aus lebenden Bäumen zu unterscheiden ist, obwohl das alte Stammfragment, aus dem es stammt, mehr als 380 Jahre, wahrscheinlich dreimal so lange, im feuchten Wald gelegen hat. Die Zeitmessung in diesem Fall ist einfach diese: Als der schwere Stamm, zu dem das alte Überbleibsel gehörte, umfiel, sank er in den Boden und hinterließ einen langen, geraden Graben, und in der Mitte dieses Grabens wächst eine Weißtanne, die jetzt einen Durchmesser von vier Fuß hat und 380 Jahre alt ist, was man ermittelt hat, indem man sie zur Hälfte durchschneidet und die Jahresringe zählt, was beweist, dass der Rest des Stammes, der den Graben verursacht hat, mehr als 380 Jahre auf dem Boden gelegen hat. Denn es ist offensichtlich, dass wir, um die gesamte Zeit zu ermitteln, zu den 380 Jahren die Zeit hinzufügen müssen, die der verschwundene Teil des Stammes im Graben lag, bevor er verbrannt wurde, plus die Zeit, die verging, bis der Samen, aus dem die monumentale Tanne hervorging, in den vorbereiteten Boden fiel und Wurzeln schlug. Da Sequoia-Stämme bei einem Waldbrand nie vollständig vernichtet werden und diese Brände nur in beträchtlichen Abständen wiederkehren, und da Sequoia-Gräben nach der Rodung oft jahrhundertelang unbepflanzt bleiben, ist es offensichtlich, dass der fragliche Stammrest wahrscheinlich tausend Jahre oder länger gelegen hat. Und dieser Fall ist keineswegs selten.
Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass in den Gebieten, die einst mit Sequoia bedeckt waren, jeder Baum umgestürzt und jeder Stamm verbrannt oder begraben worden sein könnte, ohne dass ein Überrest übrig geblieben wäre, würden viele der Gräben, die durch die fallenden schweren Stämme entstanden sind, und die Mulden, die ihre nach oben gerichteten Wurzeln geformt haben, noch Tausende von Jahren sichtbar bleiben, nachdem die letzten Überreste der Stämme, die sie geformt haben, verschwunden sind. Viele dieser Grabenmalereien würden ohne Zweifel schnell durch Überschwemmungen, über die Ufer tretende Bäche und Regenschwemmungen ausgelöscht werden; aber kein unerheblicher Teil würde über solche zerstörerischen Einflüsse hinaus dauerhaft in die Bergrücken eingraviert bleiben; denn unter günstigen Bedingungen sind sie nahezu unvergänglich. Nun kommen diese historischen Gräben und Wurzelmulden in allen heutigen Sequoia-Hainen und -Wäldern vor, aber soweit ich beobachtet habe, ist außerhalb dieser nicht die geringste Spur davon zu finden .
Wir gelangen daher zu der Schlussfolgerung, dass sich die von Sequoia bedeckte Fläche während der letzten acht- oder zehntausend Jahre nicht verringert hat und in der nacheiszeitlichen Zeit vermutlich überhaupt nicht.
Ist die Art vom Aussterben bedroht? Welche Beziehungen hat sie zu Klima, Boden und den damit verbundenen Bäumen?
Alle Phänomene, die sich auf diese Fragen beziehen, werfen, wie wir zu zeigen versuchen werden, auch Licht auf die besondere Verbreitung der Arten und stützen die bereits hinsichtlich der Frage der Verbreitung gezogene Schlussfolgerung.
In den nördlichen Gruppen gibt es, wie wir gesehen haben, nur wenige junge Bäume oder Setzlinge, die um die alten herum wachsen und die Art fortpflanzen, und da diese alten, fast kinderlosen Sequoias die einzigen sind, die allgemein bekannt sind, scheint die Art für die meisten Beobachter zum schnellen Aussterben verurteilt zu sein, da sie nichts weiter als ein sterbender Überrest ist, der im sogenannten Kampf ums Überleben von Kiefern und Tannen besiegt wurde, die ihn in seine letzten Hochburgen in feuchten Tälern mit außergewöhnlich günstigem Klima getrieben haben. Aber die Sprache der majestätischen, zusammenhängenden Wälder des Südens erweckt einen ganz anderen Eindruck. Kein Baum des gesamten Waldes ist dauerhafter im Einklang mit Klima und Boden verankert. Er wächst überall kräftig – auf Moränen, Felsvorsprüngen, entlang von Wasserläufen und im tiefen, feuchten Schwemmland von Wiesen, wobei sich eine Vielzahl von Setzlingen und Setzlingen um die alten Bäume drängen und scheinbar in der Lage sind, den Wald in bester Kraft zu erhalten. Für jeden alten, vom Sturm heimgesuchten Baum gibt es einen oder mehrere in voller Blüte und für jeden dieser Bäume viele junge Bäume und Scharen üppiger Setzlinge. Würde man also alle Bäume eines beliebigen Abschnitts des Hauptwaldes der Sequoia nach Alter anordnen, ergäbe sich eine sehr vielversprechende Kurve, die von den Setzlingen des letzten Jahres bis zu den Riesen reicht und bei der der junge und mittelalte Teil der Kurve um ein Vielfaches länger ist als der alte Teil. Sogar im Norden bis nach Fresno zählte ich 536 Setzlinge und Setzlinge, die vielversprechend auf einem Stück rauen Lawinenbodens von nicht mehr als zwei Morgen Fläche wuchsen. Dieses Bodenbett ist etwa sieben Jahre alt und wurde fast gleichzeitig von Kiefern, Tannen, Libocedrus und Sequoia besät, was ein einfaches und lehrreiches Beispiel für den Überlebenskampf zwischen den rivalisierenden Arten darstellt. Es war interessant zu beobachten, dass die Bedingungen, die sie bisher beeinflussten, es den jungen Sequoias ermöglichten, einen deutlichen Vorteil zu erlangen.
In jedem Fall wie dem oben genannten habe ich beobachtet, dass der Sequoia-Sämling sowohl auf trockenerem als auch auf feuchterem Boden wachsen kann als seine Rivalen, aber mehr Sonnenschein benötigt als sie; letztere Tatsache zeigt sich deutlich überall dort, wo eine Zuckerkiefer oder -tanne in engem Kontakt mit einem Sequoia von etwa gleichem Alter und gleicher Größe wächst und der Sonne gleichermaßen ausgesetzt ist; die Zweige der letzteren sind in solchen Fällen immer weniger belaubt. Gegen Süden jedoch, wo der Sequoia üppiger und zahlreicher wird , werden die rivalisierenden Bäume weniger üppig; und wo sie sich mit Sequoias vermischen, wachsen sie meist unter ihnen empor, wie schlanke Gräser zwischen Maisstängeln. Auf einem Bett aus sandigem Überschwemmungsboden zählte ich 94 Sequoias, von einem bis zwölf Fuß hoch, auf einem Stück Boden, auf dem einst vier große Zuckerkiefern standen, die unter ihnen zerbröckelten – ein Beispiel für Bedingungen, die es Sequoias ermöglicht haben, die Kiefern zu verdrängen.

Ich bemerkte auch 86 kräftige Setzlinge auf einem Stück frischen Bodens, der für ihre Aufnahme durch Feuer vorbereitet worden war. So liefert Feuer, der große Zerstörer von Sequoia, auch nackten, unberührten Boden, eine der wesentlichen Voraussetzungen für sein Wachstum aus dem Samen. Frischer Boden wird jedoch in ausreichender Menge für die ständige Erneuerung der Wälder ohne Feuer geliefert, nämlich durch das Umfallen alter Bäume. Der Boden wird so umgegraben und aufgeweicht, und für jeden umgestürzten Baum werden viele neue gepflanzt. Erdrutsche und Überschwemmungen bringen ebenfalls nackten, unberührten Boden hervor; und ab und zu verdankt ein Baum seine Existenz einem grabenden Wolf oder Eichhörnchen, aber die regelmäßigste Versorgung mit frischem Boden wird durch das Umfallen alter Bäume gewährleistet.
Die Klimaveränderungen in der Sierra, die sich auf die Lebensdauer der Bäume auswirken, werden völlig falsch eingeschätzt, insbesondere was den Zeitpunkt und die Mittel betrifft, mit denen die Natur sie bewirkt hat. Es wird ständig vage behauptet, dass die Sierra viel feuchter war als heute und dass die zunehmende Dürre die Sequoia von selbst auslöschen und ihren Boden anderen Bäumen überlassen wird, von denen angenommen wird, dass sie in einem trockeneren Klima überleben können. Aber dass Sequoia auf ebenso trockenem Boden wachsen kann und dies auch tut, ist an tausend Stellen offensichtlich. „Warum“, wird man fragen, „sind Sequoias dann immer in größter Menge an gut bewässerten Orten zu finden, an denen es außergewöhnlich viele Bäche gibt?“ Einfach, weil das Wachstum von Sequoias diese Bäche erzeugt. Der durstige Bergsteiger weiß genau, dass er in jedem Sequoia-Hain fließendes Wasser finden wird, aber es ist ein Fehler anzunehmen, dass das Wasser der Grund dafür ist, dass der Hain dort ist; im Gegenteil, der Hain ist der Grund dafür, dass das Wasser da ist. Wenn man das Wasser ablässt, bleiben die Bäume erhalten, aber wenn man die Bäume fällt, verschwinden die Ströme. Nie wurde Ursache häufiger mit Wirkung verwechselt als bei diesen verwandten Phänomenen der Sequoia-Wälder und der ganzjährigen Ströme, und ich gestehe, dass ich anfangs an diesem Fehler beteiligt war.
Wenn man sich die Methode der Sequoia-Bäche ansieht, wird man sofort verstanden. Die Wurzeln dieses riesigen Baumes füllen den Boden und bilden einen dicken Schwamm, der Regen und schmelzenden Schnee aufnimmt und zurückhält und sie nur sanft sickern und fließen lässt. Tatsächlich kann jedes abgefallene Blatt und jede Wurzel sowie jede lange, sich festklammernde Wurzel und jeder niederliegende Stamm als Damm betrachtet werden, der die Fülle der Sturmwolken auffängt und sie den ganzen Sommer über als Segen verteilt, anstatt sie in kurzlebigen Fluten kopfüber loszulassen. Die Verdunstung wird durch das dichte Laub auch stärker gehemmt als bei jedem anderen Baum der Sierra, und die Luft wird in Massen und breiten Schichten verwickelt, die schnell gesättigt sind; während durstige Winde nicht über den Boden lecken und schwammig werden können.
Die Wasserstauung ist an vielen Stellen im Hauptgürtel so groß, dass durch das Absterben der Bäume Sümpfe und Wiesen entstehen. Ein einzelner Baumstamm, der über einen Bach im Wald fällt, bildet einen 200 Fuß langen und 10 bis 30 Fuß hohen Damm, der einen Teich entstehen lässt, der die Bäume in seinem Umkreis abtötet. Diese toten Bäume fallen der Reihe nach um und bilden so eine Lichtung, während sich Sedimente allmählich ansammeln und den Teich in einen Sumpf oder eine Wiese verwandeln, auf der Karizien und Torfmoos wachsen. In einigen Fällen erheben sich an einem Hang mehrere kleine Sümpfe oder Wiesen übereinander, die allmählich ineinander übergehen und abfallende Sümpfe oder Wiesen bilden, die markante Merkmale von Sequoia-Wäldern sind, und da alle Bäume, die in sie gefallen sind, erhalten geblieben sind, enthalten sie Aufzeichnungen der Generationen, die seit ihrer Entstehung vergangen sind.
Da es also eine Tatsache ist, dass Tausende von Sequoias üppig auf sogenanntem trockenen Boden wachsen und sich sogar wie Bergkiefern an Spalten in Granitfelsen klammern; und da außerdem nachgewiesen wurde, dass die zusätzliche Feuchtigkeit, die in Verbindung mit dem dichteren Wachstum auftritt, eine Folge ihrer Anwesenheit und nicht deren Ursache ist, erweisen sich die Vorstellungen von der früheren Ausbreitung der Art und ihrem nahen Aussterben, die auf ihrer angenommenen Abhängigkeit von größerer Feuchtigkeit beruhen, als falsch.
Der Rückgang der Regen- und Schneefälle seit dem Ende der Eiszeit in der Sierra ist viel geringer als gemeinhin angenommen. Die höchsten postglazialen Wasserstände sind in allen oberen Flussbetten gut erhalten und liegen nicht viel höher als die heutigen Hochwasserstände im Frühjahr. Dies zeigt schlüssig, dass es in den oberen Zuflüssen der postglazialen Sierra-Bäche seit ihrer Entstehung zu keinem außergewöhnlichen Rückgang des Wasserspiegels gekommen ist. Wenn man jedoch die komplizierte Frage des Klimawandels einmal außen vor lässt, bleibt die schlichte Tatsache bestehen, dass die gegenwärtigen Regen- und Schneefälle für das üppige Wachstum der Sequoia-Wälder völlig ausreichen . Alle meine Beobachtungen deuten sogar darauf hin, dass bei einer länger anhaltenden Dürre die Zuckerkiefern und -tannen vor den Sequoias zugrunde gehen würden, und zwar nicht nur wegen der längeren Lebensdauer einzelner Bäume, sondern auch, weil diese Art mehr Dürre aushält und die fallende Feuchtigkeit optimal verwerten kann.
Wenn die Einschränkung und unregelmäßige Verbreitung der Art wiederum als Folge der Austrocknung des Verbreitungsgebiets interpretiert wird, dann müsste die Anzahl weiter südlich, wo es weniger Niederschläge gibt, abnehmen und nicht zunehmen, wie es bei einzelnen Arten der Fall ist.
Wenn also die besondere Verbreitung der Sequoia nicht auf bessere Bodenbedingungen hinsichtlich Fruchtbarkeit oder Feuchtigkeit zurückzuführen ist, wodurch wurde sie dann bestimmt?
Im Laufe meiner Studien fiel mir auf, dass die nördlichen Haine, die einzigen, die ich zunächst kannte, genau in jenen Teilen des allgemeinen Waldbodengürtels lagen, die gegen Ende der Eiszeit erstmals freigelegt wurden, als die Eisdecke begann, sich in einzelne Gletscher aufzulösen. Und während ich das weite Becken des San Joaquin absuchte und versuchte, das Fehlen von Sequoia zu erklären, wo alle Bedingungen für ihr Wachstum günstig schienen, fiel mir auf, dass diese bemerkenswerte Lücke im Sequoia-Gürtel genau im Becken des riesigen alten Mer de Glace der Becken des San Joaquin und des King’s River liegt, der seine gefrorenen Fluten in die Ebene strömen ließ, gespeist durch den Schnee, der auf mehr als fünfzig Meilen des Gipfels fiel. Dann fiel mir auf, dass die nächste große Lücke im Gürtel im Norden, die sechzig Kilometer breit ist und sich zwischen den Calaveras- und Tuolumne-Hainen erstreckt, im Becken des großen alten Gletschermeeres der Tuolumne- und Stanislaus-Becken liegt, und dass die kleinere Lücke zwischen den Merced- und Mariposa-Hainen im Becken des kleineren Gletschers des Merced liegt. Je breiter der alte Gletscher, desto breiter die entsprechende Lücke im Sequoia-Gürtel .
Schließlich entdeckte ich bei meinen Untersuchungen in den Becken des Kaweah und des Tule, dass der Sequoia-Gürtel seine größte Entwicklung gerade dort erreichte, wo der Boden aufgrund der topographischen Besonderheiten der Region am besten vor den großen Eisflüssen geschützt war, die noch lange, nachdem die kleineren örtlichen Gletscher geschmolzen waren, aus den Gipfelquellen weiterströmten.
Wenn wir uns nun einen Gesamtüberblick über den Gürtel verschaffen und im Süden beginnen, sehen wir, dass die majestätischen alten Gletscher rechts und links von den hohen, schützenden Ausläufern, die sich über die warmen, mit Sequoiabäumen gefüllten Becken von Kaweah und Tule ausbreiten, in die Täler von Kern und King’s River abgeworfen wurden. Weiter nördlich folgt der breite, Sequoia-lose Kanal oder das Becken des alten Eismeeres von San Joaquin und King’s River ; dann die warmen, geschützten Stellen der Fresno- und Mariposa-Haine; dann der Sequoia-lose Kanal des alten Merced-Gletschers; dann der warme, geschützte Boden der Merced- und Tuolumne-Haine; dann der Sequoia-lose Kanal des großen alten Eismeeres von Tuolumne und Stanislaus; dann der warme alte Boden der Calaveras- und Stanislaus-Haine. Es scheint daher, dass der Sequoia genau dort steht, wo es zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte der Sierra keine Gletscher gab, und dass der Sequoia genau dort nicht steht, wo es Gletscher gab.
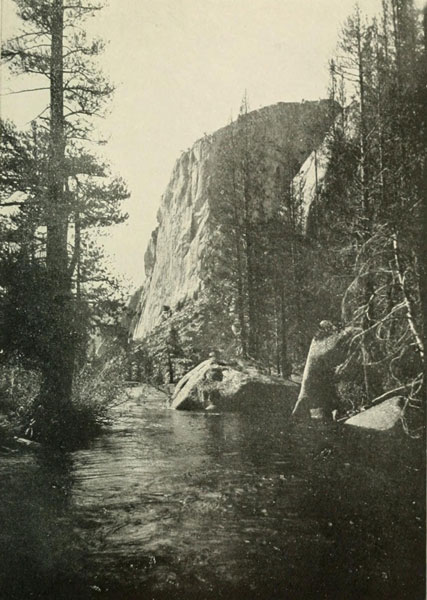
Welche anderen Bedingungen es dem Sequoia ermöglicht haben, sich auf diesen ältesten und wärmsten Teilen des Hauptgletscherbodengürtels anzusiedeln, kann ich nicht sagen. Ich wage jedoch in diesem Zusammenhang zu behaupten, dass, da die Sequoia-Wälder nach Süden hin ein immer älteres Aussehen annehmen, ich geneigt bin zu glauben, dass die Art von Süden her verbreitet wurde, während die Zuckerkiefer, ihr großer Rivale in den nördlichen Wäldern, um die Spitze des Sacramento-Tals herum und von Norden her die Sierra hinunter gekommen zu sein scheint; als die Sierra-Bodenschichten also erstmals freigelegt wurden, um dem Schmelzen der Eisdecke zuvorzukommen, könnte sich der Sequoia vor der Ankunft der Zuckerkiefer entlang der verfügbaren Teile der südlichen Hälfte des Gebirges angesiedelt haben, während die Zuckerkiefer vor der Ankunft des Sequoia die nördliche Hälfte in Besitz nahm.
Doch wie viel Unsicherheit auch mit diesem Teil der Frage verbunden sein mag, es gibt keine verdunkelnden Schatten auf der großen allgemeinen Beziehung, die wir zwischen der gegenwärtigen Verbreitung der Sequoia und den alten Gletschern der Sierra aufgezeigt haben. Und wenn wir bedenken, dass alle gegenwärtigen Wälder der Sierra jung sind und auf Moränenboden wachsen, der erst vor kurzem abgelagert wurde, und dass die Flanke des Gebirges selbst mit all seinen Landschaften neugeboren, erst vor kurzem geformt und aus dem Eismantel des eisigen Winters ans Tageslicht gebracht wurde, dann verschwinden tausend gesetzlose Geheimnisse und breite Harmonien nehmen ihren Platz ein.
Aber obwohl alle beobachteten Phänomene im Zusammenhang mit der nacheiszeitlichen Geschichte dieses riesigen Baumes zu der Schlussfolgerung führen, dass er seit dem Ende der Eiszeit nie weiter in der Sierra verbreitet war; dass seine heutigen Wälder ihre Blütezeit kaum überschritten haben, wenn sie sie überhaupt bereits erreicht haben; dass die nacheiszeitliche Zeit der Art wahrscheinlich noch nicht zur Hälfte vorüber ist, so zeigt sich doch, wenn man aus einer umfassenderen Perspektive das enorme Alter der Gattung und ihren historischen Reichtum an Arten und Individuen betrachtet; Vergleicht man unseren Sierra Giant und Sequoia sempervirens aus der Küstenkette, die einzige andere lebende Sequoia-Art, mit den zwölf fossilen Arten, die bereits von Heer und Lesquereux entdeckt und beschrieben wurden, von denen einige während der Tertiär- und Kreidezeit in weiten Gebieten der Arktis und in Europa und unseren eigenen Territorien gediehen zu sein scheinen, dann wird tatsächlich klar, dass unsere beiden überlebenden Arten, die auf schmale Gürtel innerhalb der Grenzen Kaliforniens beschränkt sind, sowohl hinsichtlich der Arten als auch der Individuen bloße Überbleibsel der Gattung sind und dass sie wahrscheinlich kurz vor dem Aussterben stehen. Aber die Schwelle einer Periode, die in der Kreidezeit begann, kann Zehntausende von Jahren umfassen, ganz zu schweigen von der möglichen Existenz von Bedingungen, die geeignet sind, sowohl Arten als auch Individuen zu vermehren und neu auszubreiten. Dies ist jedoch ein Teil der Frage, auf den ich jetzt nicht eingehen möchte.
Bei der Untersuchung des Schicksals unseres Waldkönigs haben wir bisher nur die Wirkung rein natürlicher Ursachen betrachtet; aber leider lebt der Mensch in den Wäldern, und Verwüstung und reine Zerstörung schreiten rasch voran. Wenn die Bedeutung der Wälder auch nur aus wirtschaftlicher Sicht überhaupt verstanden würde, würde ihre Erhaltung die wachsamste Aufmerksamkeit der Regierung erfordern. Erst in den letzten Jahren wurde durch Waldreservate die einfachste Grundlage für die verfügbare Gesetzgebung geschaffen, während in vielen der schönsten Wälder jede Art der Zerstörung noch immer mit beschleunigter Geschwindigkeit voranschreitet.
Im Laufe meiner Erkundungen fand ich nicht weniger als fünf Sägewerke am oder nahe dem unteren Rand des Sequoia-Gürtels, die alle beträchtliche Mengen Big Tree-Holz fällen. Der Großteil der Fresno-Gruppe ist dazu verdammt, die Sägewerke zu beliefern, die vor kurzem in ihrer Nähe errichtet wurden, und eine Gruppe von Holzfällern fällt derzeit den prächtigen Wald am King’s River. Bei diesen Sägewerken übersteigt der Abfall den Nutzen bei weitem, denn nachdem die besten jungen, pflegeleichten Bäume an einem bestimmten Ort gefällt wurden, werden die Wälder abgebrannt, um den Boden von Ästen und Abfällen für weitere Arbeiten zu befreien, und natürlich werden die meisten Setzlinge und Schösslinge vernichtet.
Diese Verwüstungen durch die Mühlen sind jedoch gering im Vergleich zu der umfassenden Zerstörung, die die „Schafzüchter“ anrichten. Unglaubliche Mengen von Schafen werden jeden Sommer auf die Bergweiden getrieben, und ihr Weg ist stets von Verwüstung geprägt. Jeder verwilderte Garten wird niedergetrampelt, die Sträucher werden entlaubt, als ob sie von Heuschrecken gefressen worden wären, und die Wälder werden niedergebrannt. Überall werden Lauffeuer entzündet, um den Boden von umgestürzten Stämmen zu befreien, den Herden die Bewegung zu erleichtern und die Weiden zu verbessern. Der gesamte Waldgürtel wird auf diese Weise von einem Ende des Gebirges zum anderen hinweggefegt und verwüstet, und mit Ausnahme der harzigen Pinus contorta leidet der Sequoia am meisten. Indianer brennen in bestimmten Gegenden das Unterholz ab, um die Hirschjagd zu erleichtern, Bergbewohner und Holzfäller lassen ihre Lagerfeuer achtlos weiterbrennen; aber die Feuer der Schafzüchter oder Muttoneers machen über neunzig Prozent des Waldes aus. aller zerstörerischen Brände, die in den Wäldern der Sierra wüten.
Es scheint daher, dass unser Waldkönig, obwohl er in der Obhut der Natur prächtig weiterleben könnte, durch das Feuer und den Stahl des Menschen rasch verschwindet. Und wenn nicht schnell Schutzmaßnahmen erfunden und angewendet werden, werden in höchstens ein paar Jahrzehnten vom Sequoia gigantea nur noch ein paar zerhackte und vernarbte Monumente übrig sein.
ZWEIBLATTIGE KIEFER ODER TAMARACK
(Pinus contorta , var. Marrayana)
Diese Art bildet den Großteil der alpinen Wälder und erstreckt sich entlang der Gebirgskette oberhalb der Tannenzone bis zu einer Höhe von 8.000 bis 9.500 Fuß über dem Meeresspiegel. Sie wächst in schöner Ordnung auf Moränen, die bisher kaum durch postglaziale Verwitterung verändert wurden. Verglichen mit den Riesen der tieferen Zonen ist dies ein kleiner Baum, der selten eine Höhe von 100 Fuß erreicht. Das größte Exemplar, das ich je gemessen habe, war 90 Fuß hoch und hatte einen Durchmesser von etwas über 6 Fuß und eine Höhe von vier Fuß über dem Boden. Die durchschnittliche Höhe der ausgewachsenen Bäume im gesamten Gürtel beträgt wahrscheinlich nicht weit von fünfzig oder sechzig Fuß bei einem Durchmesser von zwei Fuß. Es ist eine wohl proportionierte, recht schöne kleine Kiefer mit graubrauner Rinde und krummen, stark geteilten Ästen, die den größten Teil des Stammes bedecken, jedoch nicht so dicht, dass man sie nicht mehr sehen kann. Die unteren Äste sind nach unten gebogen, nehmen etwa auf halber Höhe des Stammes allmählich eine horizontale Position ein und streben dann immer weiter Richtung Spitze, wodurch eine scharfe, kegelförmige Spitze entsteht. Das Laub ist kurz und steif, zwei Blätter in einem Bündel, angeordnet in verhältnismäßig langen, zylindrischen Quasten an den Enden der zähen, nach oben gebogenen Zweige. Die Zapfen sind etwa zwei Zoll lang und wachsen in steifen Büscheln zwischen den Nadeln, ohne irgendeinen auffallenden Effekt zu erzielen, außer wenn sie sehr jung sind, eine leuchtend purpurfarbene Farbe haben und der ganze Baum mit leuchtenden Blüten übersät zu sein scheint. Die sterilen Zapfen sind aufgrund ihrer großen Fülle noch auffälliger, da sie der gesamten Laubmasse oft einen rötlich-gelben Schimmer verleihen und die Luft mit Pollen erfüllen.
Keine andere Kiefer in der Bergkette ist so regelmäßig gepflanzt wie diese. Moränenwälder ziehen sich kilometerweit ohne Unterbrechung an den Seiten der hohen, felsigen Täler entlang; streng genommen sind sie jedoch nicht dicht, denn Sonnenflecken und Blumen finden ihren Weg in die dunkelsten Stellen, wo die Bäume am höchsten und dichtesten wachsen. Hohe, nahrhafte Gräser sind unter ihnen besonders reichlich vorhanden und bedecken den gesamten Boden, in der Sonne und im Schatten, auf ausgedehnten Flächen wie die Felder eines Bauern und dienen als Weide für die vielen Schafe, die jeden Sommer von den trockenen Ebenen vertrieben werden, sobald der Schnee geschmolzen ist.
Die Zweiblättrige Kiefer ist mehr als jede andere Art anfällig für Feuer. Die dünne Rinde ist mit Harz überzogen und besprenkelt, als ob es wie Regen darauf niedergeprasselt wäre, sodass sogar die grünen Bäume leicht Feuer fangen, und bei starkem Wind werden ganze Wälder zerstört, wobei die Flammen von Baum zu Baum springen und einen ununterbrochenen Gürtel aus loderndem Feuer bilden, das wie die Grasfeuer einer Prärie über den sich windenden Wäldern dahinwogt und davonrast. Während der ruhigen, trockenen Jahreszeit des Altweibersommers kriecht das Feuer ruhig über den Boden und ernährt sich von den trockenen Nadeln und Kletten; wenn es dann den Fuß eines Baumes erreicht, wird die harzige Rinde entzündet, und die erhitzte Luft steigt in einem kräftigen Strom auf, nimmt an Geschwindigkeit zu und zieht die Flammen rasch nach oben; dann fangen die Blätter Feuer, und eine gewaltige Flammensäule, wunderschön an den Rändern gewölbt und rosa-violett gefärbt, schießt neun bis zwölf Meter über die Spitze des Baumes hinaus und bietet ein großartiges Schauspiel, besonders in einer dunklen Nacht. Sie währt jedoch nur wenige Sekunden und verschwindet mit magischer Geschwindigkeit, woraufhin wochenlang in unregelmäßigen Abständen andere entlang der Feuerlinie folgen - ein Baum nach dem anderen blitzt auf und wird dunkler, und an Stamm und Ästen bleiben kaum Narben zurück. Die Hitze reicht jedoch aus, um die Bäume abzutöten, und nach wenigen Jahren schrumpft die Rinde und fällt ab. Meilenlange Gürtel werden so abgetötet und bleiben mit den Ästen stehen, geschält und starr, und erscheinen in der Ferne grau wie Nebelwolken. Später fallen die Äste ab und hinterlassen einen Wald aus gebleichten Holmen. Schließlich verfaulen die Wurzeln und die verlassenen Stämme werden bei einem Sturm umgeweht und übereinander gestapelt, so dass sie den Boden belasten, bis sie vom nächsten Feuer verzehrt werden und ihn für eine neue Ernte bereit machen.
Die Ausdauer dieser Art zeigt sich darin, dass sie gelegentlich mit der Gelb-Kiefer über die Lavaebenen wandert und mit der Zwerg-Kiefer moränenlose Berghänge erklimmt und sich an jeder möglichen Stütze in Spalten und Spalten sturmgepeitschter Felsen festklammert. Die Auswirkungen dieser Strapazen sind jedoch stets in allen Einzelheiten zu erkennen.
Unten in geschützten Seen, auf Böden aus reichem Schwemmland, weicht er so sehr von der üblichen Form ab, dass er oft für eine eigene Art gehalten wird. Hier wächst er in dichten Grasnarben, 40 bis 80 Fuß hoch, biegt sich im Wind und wirbelt in wirbelnden Böen geschmeidiger als jeder andere Baum im Wald. Ich habe oft Exemplare gefunden, die 50 Fuß hoch waren und weniger als 5 Zoll im Durchmesser. Da er so schlank und gleichzeitig gut mit belaubten Zweigen bedeckt ist, biegt er sich oft bis zum Boden, wenn er mit weichem Schnee beladen ist, und bildet wunderschöne Bögen in endloser Vielfalt, von denen einige bis zur Schneeschmelze im Frühling bestehen bleiben.
Bergkiefer
(Pinus monticola)
Die Bergkiefer ist die Königin der alpinen Wälder, mutig, robust und langlebig. Sie überragt ihre Artgenossen majestätisch und wird gerade dort stärker und imposanter, wo andere Arten zu kauern und zu verschwinden beginnen. In ihrer besten Form ist sie normalerweise etwa neunzig Fuß hoch und hat einen Durchmesser von fünf oder sechs Fuß, obwohl man oft auch Exemplare findet, die deutlich größer sind. Der Stamm ist so massiv und zeugt von ebenso ausdauernder Stärke wie der einer Eiche. Etwa zwei Drittel des Stammes sind normalerweise frei von Ästen, aber bis ganz nach unten sind dichte, fransige Büschel von Zweigen vorhanden, wie sie die riesigen Stämme von Sequoia zieren. Die Rinde ist bei Bäumen, die in exponierter Lage nahe der oberen Grenze stehen, tief rötlich-braun und ziemlich tief gefurcht, wobei die Hauptfurchen nahezu parallel zueinander verlaufen und durch auffällige Querfurchen verbunden sind, die, mit einer Ausnahme, meines Wissens nach dieser Art eigen sind.
Die Zapfen sind vier bis acht Zoll lang, schlank, zylindrisch und etwas gebogen und ähneln denen der gewöhnlichen Weißkiefer an der Atlantikküste. Sie wachsen in Gruppen von etwa drei bis sechs oder sieben und werden mit zunehmendem Gewicht herabhängend, hauptsächlich durch das Biegen der Zweige.
Diese Art ist eng mit der Zuckerkiefer verwandt und obwohl sie nicht halb so groß ist, erinnert sie durch die Art, wie sie ihre langen Arme ausstreckt und durch ihre allgemeine Wuchsform, immer an ihren edlen Verwandten. Die Bergkiefer trifft man zuerst am oberen Rand der Tannenzone an, wo sie einzeln in einer gedämpften, unauffälligen Form wächst, in scheinbar zufälligen Situationen, ohne großen Eindruck auf den Gesamtwald zu machen. Weiter oben durch die Zweiblättrigen Kiefern in demselben verstreuten Wachstum beginnt sie ihren Charakter zu zeigen und erreicht in einer Höhe von etwa 10.000 Fuß ihre edelste Entwicklung in der Nähe der Mitte des Gebirges, indem sie ihre zähen Arme in die frostige Luft wirft, Stürme willkommen heißt und sich von ihnen ernährt und das hohe Alter von 1000 Jahren erreicht.
WACHOLDER ODER ROTE ZEDER
(Juniperus occidentalis)

Der Wacholder ist in erster Linie ein Felsenbaum, der die kahlsten Kuppeln und Gehsteige bewohnt, wo es kaum eine Handvoll Erde gibt, in einer Höhe von 7000 bis 9500 Fuß. In solchen Lagen hat der Stamm häufig einen Durchmesser von über acht Fuß und ist nicht viel höher. Bei alten Bäumen ist die Spitze fast immer abgestorben, und große, störrische Äste ragen horizontal hervor, die an den Enden meist abgebrochen und kahl sind, aber dicht bedeckt und hier und da von buschigen Hügeln aus grauem Laub umgeben sind. Einige sind bloße verwitterte Stümpfe, so breit wie lang, mit ein paar Blattzweigen geschmückt und erinnern an die zerfallenen Türme einer alten Burg, die spärlich mit Efeu behangen sind. Nur an den Quellgewässern des Carson habe ich diese Art auf gutem Moränenboden gefunden. Hier gedeiht er zusammen mit den Silberkiefern und den Zweiblattkiefern in großer Schönheit und Üppigkeit, erreicht eine Höhe von 40 bis 60 Fuß und zeigt nur wenig von der felsigen Kantigkeit, die für den größten Teil seines Verbreitungsgebiets so charakteristisch ist. Zwei der größten Bäume, die am oberen Ende des Hope Valley wachsen, messen 29 Fuß 3 Zoll bzw. 25 Fuß 6 Zoll im Umfang, jeweils 4 Fuß über dem Boden. Die Rinde hat eine leuchtende Zimtfarbe und ist bei üppigen Bäumen wunderschön geflochten und netzartig, wobei sie in dünnen, glänzenden Streifen abblättert, die von Indianern manchmal als Zeltmatten verwendet werden. Seine schöne Farbe und seine seltsame malerische Wirkung ziehen immer die Aufmerksamkeit eines Künstlers auf sich, aber für mich scheint der Wacholder ein außergewöhnlich langweiliger und schweigsamer Baum zu sein, der nie zu einem Herzen spricht. Ich habe viele Tage und Nächte in seiner Gesellschaft verbracht, bei jedem Wetter, und habe ihn immer still, kalt und starr gefunden, wie eine Eissäule. Seine breite Stumpfheit schließt natürlich jede Möglichkeit des Winkens oder gar Wankens aus; aber es ist nicht diese felsige Standhaftigkeit, die sein Schweigen ausmacht. An ruhigen Sonnentagen predigt die Zuckerkiefer wie ein Apostel die Erhabenheit der Berge, ohne ein Blatt zu bewegen.

Auf ebenen Felsen stirbt es stehend ab und verkümmert unmerklich wie Granit, wobei der Wind auf es, ob lebendig oder tot, ebenso wenig Einfluss hat wie auf einen Gletscherblock. Einige sind zweifellos über 2000 Jahre alt. Alle Bäume der alpinen Wälder leiden mehr oder weniger unter Lawinen, die Zweiblättrige Kiefer am meisten. Zwei- bis dreihundert Meter breite Lücken, die sich von der oberen Grenze der Baumgrenze bis in die Tal- und Seebeckenböden erstrecken, sind in allen höher gelegenen Wäldern üblich und ähneln den Lichtungen der Siedler in den alten Hinterwäldern. Kaum ein Baum bleibt verschont, sogar die Erde wird weggekratzt, während Tausende von entwurzelten Kiefern und Fichten mit dem Kopf nach unten übereinander gestapelt und in zwei Schwaden wie Seitenmoränen gemütlich an den Seiten der Lichtung zusammengequetscht werden. Die Kiefern liegen mit verwelkten und herabhängenden Zweigen wie Unkraut da. Anders verhält es sich mit den stämmigen Wacholdern. Nachdem sie vielleicht ein Dutzend oder zwanzig Jahrhunderte lang schweigend den Stürmen getrotzt haben, scheinen sie in dieser, ihrer letzten Katastrophe, etwas mitteilsamer zu werden, indem sie Zeichen einer sehr widerwilligen Akzeptanz ihres Schicksals geben, indem sie sich hoch über dem Boden auf Knie und Ellbogen halten, scheinbar unbehaglich und wie sture Ringer darauf bedacht, wieder aufzustehen.
HEMLOCK-FICHTE
(Tsuga Pattoniana)
Die Hemlocktanne ist die schönste aller kalifornischen Nadelbäume. Ihre Achse an der Spitze ist so schlank, dass sie sich biegt und herabhängt wie der Stiel einer nickenden Lilie. Auch die Zweige hängen herab und teilen sich in unzählige schlanke, wehende Zweige, die in einer abwechslungsreichen, beredten Harmonie angeordnet sind, die völlig unbeschreiblich ist. Ihre Zapfen sind violett und hängen frei in Form kleiner, zwei Zoll langer Quasten von allen Zweigen von oben bis unten herab. Obwohl sie von außerordentlicher Zartheit und Weiblichkeit ist, wächst sie am besten dort, wo der Schnee am tiefsten liegt, weit oben in der Sturmregion, auf einer Höhe von 9.000 bis 9.500 Fuß, an frostigen Nordhängen; sie kann aber auch erheblich höher wachsen, sagen wir 10.500 Fuß. Die größten Exemplare, die in geschützten Mulden etwas unterhalb der stärksten Windströmungen wachsen, sind 24 bis 30 Meter hoch und haben einen Durchmesser von 60 bis 120 Zentimetern. Das allergrößte Exemplar, das ich je fand, hatte einen Umfang von 57 Metern und 1,20 Meter über dem Boden. Es wuchs am Rande des Lake Hollow in einer Höhe von 2.800 Metern über dem Meeresspiegel. Im Alter von zwanzig oder dreißig Jahren wird er fruchtbar und lässt seine wunderschönen violetten Zapfen an den Enden der schlanken Zweige hängen, wo sie frei im Wind schwingen und einen reizvollen Kontrast zu dem kühlen grünen Laub bilden. In jungen Jahren sind sie durchscheinend und ihre Schönheit ist köstlich. Wenn sie völlig reif sind, breiten sie ihre schalenartigen Schuppen aus und lassen die braunflügeligen Samen in der milden Luft fliegen, während die leeren Zapfen bleiben und den Baum verschönern, bis eine neue Ernte kommt.

Die männlichen Zapfen aller Koniferen sind wunderschön und wachsen in leuchtenden Büscheln in Gelb, Rosa und Purpur. Die Zapfen der Hemlocktanne sind die schönsten von allen und bilden kleine Zapfen mit blauen Blüten, die jeweils auf einem schlanken Stiel sitzen.
Unter allen Bedingungen, geschützt oder sturmgepeitscht, gut ernährt oder schlecht ernährt, ist dieser Baum von außergewöhnlich anmutiger Wuchsform. Selbst an seiner höchsten Stelle auf exponierten Berggipfeln, obwohl er gezwungen ist, sich in dichten Dickichten zu ducken, eng zusammengekauert, als ob er sich gegenseitig schützen wollte, schafft er es immer noch, seine Zweige in unbändiger Schönheit auszustrecken; während er auf gut gemahlenem Moränenboden eine vollkommen tropische Üppigkeit an Laub und Früchten entwickelt und der allerschönste Baum im Wald ist; in dünnem, weißem Sonnenlicht stehend, von Kopf bis Fuß mit Zweigen bekleidet, doch nicht im Geringsten schwer oder büschelig, ragt er in bescheidener Majestät empor, herabhängend, als ob er von den aufstrebenden Tendenzen seiner Art unberührt wäre, den Boden liebend, während er sich des Himmels klar bewusst ist und freudig seine Segnungen empfängt, seine Zweige wie empfindliche Tentakeln ausstreckt, das Licht fühlt und darin schwelgt. Kein anderer unserer alpinen Nadelbäume verhüllt seine Stärke so fein. Seine zarten Zweige geben dem sanftesten Hauch der Berge nach, und doch ist er stark genug, um den wildesten Angriffen des Sturms zu trotzen – stark nicht im Widerstand, sondern im Nachgeben, beugt sich schneebeladen dem Boden entgegen und akzeptiert anmutig die Bestattung in der Dunkelheit unter der schweren Decke des Winters, Monat für Monat.
Wenn der erste weiche Schnee zu fallen beginnt, bleiben die Flocken in den Blättern hängen und drücken die Zweige gegen den Stamm. Dann biegt sich die Achse immer tiefer, bis die schlanke Spitze den Boden berührt und so einen schönen, dekorativen Bogen bildet. Der Schnee fällt immer noch in Strömen, und der ganze Baum wird schließlich begraben, um in seinem schönen Grab zu schlafen und zu ruhen, als wäre er tot. Ganze Haine junger Bäume, von drei bis zwölf Metern hoch, werden auf diese Weise jeden Winter wie schlanke Gräser begraben. Aber wie die Veilchen und Gänseblümchen, die der schwerste Schnee nicht zerdrückt, sind sie sicher. Es ist, als wäre dies nur die Methode der Natur, ihre Lieblinge einzuschläfern, anstatt sie den beißenden Stürmen des Winters auszusetzen.
So warm eingehüllt warten sie auf die Wiederauferstehung im Sommer. Der Schnee wird im Sonnenschein weich und gefriert nachts, wodurch die Masse hart und kompakt wird wie Eis, sodass man in den Monaten April und Mai auf einem Pferd über die liegenden Wälder reiten kann, ohne ein einziges Blatt zu sehen. Schließlich befreit sie der herabströmende Sonnenschein. Zuerst beginnen die elastischen Spitzen der Bögen zu erscheinen, dann ein Ast nach dem anderen, jeder springt mit einem leisen Rascheln los, und schließlich streckt sich der ganze Baum mit Hilfe des Windes allmählich, richtet sich auf und legt sich wieder an seinen Platz in der warmen Luft, so trocken und federleicht und frisch wie junge Farne, die gerade aus dem Wind geschlüpft sind.
Einige der schönsten Wälder, die ich bisher gefunden habe, liegen an den Südhängen von Lassen’s Butte. Es gibt auch viele reizende Gruppen an den Quellflüssen des Tuolumne, Merced und San Joaquin, und im Allgemeinen ist die Art alles andere als selten, sodass man beim Überqueren der Bergkette kaum auf Wälder von beträchtlicher Größe stoßen kann, egal welchen Weg man wählt. Daneben wächst die Bergkiefer und häufiger die zweiblättrige Art; es gibt aber auch viele schöne Gruppen mit 1000 oder mehr Exemplaren ohne einen einzigen Eindringling.
Ich wünschte, ich hätte genug Platz, um mehr über die unübertreffliche Schönheit dieser beliebten Fichte zu schreiben. Jeder Baumliebhaber wird sie mit besonderer Bewunderung betrachten; selbst gleichgültige Bergsteiger, die nur auf der Suche nach Wild oder Gold sind, bleiben stehen, um sie anzustarren, wenn sie sie zum ersten Mal sehen, und murmeln vor sich hin: „Das ist ein mächtig hübscher Baum“, und manche fügen hinzu: „Verdammt hübsch!“ Im Herbst, wenn ihre Zapfen reif sind, sorgen die kleinen gestreiften Tamias, das Douglas-Hörnchen und die Clark-Krähe für fröhliches Treiben in ihren Hainen. Die Hirsche legen sich gern unter ihre ausladenden Zweige; helle Ströme aus dem immer nahen Schnee plätschern durch ihre Haine, und der Bryanthus breitet in ihrem Schatten kostbare Teppiche aus. Aber die besten Worte deuten nur auf ihren Charme hin. Kommen Sie in die Berge und sehen Sie selbst.
ZWERG-KIEFER
(Pinus albicaulis)
Diese Art bildet auf beiden Seiten fast über die gesamte Länge des Gebirges die äußerste Grenze der Waldgrenze. Man trifft sie erstmals zusammen mit Pinus contorta , var. Murrayana , am oberen Rand des Gürtels als aufrecht stehenden Baum von 4,5 bis 6 Metern Höhe und 30 bis 60 Zentimeter Dicke an; von dort wächst sie vereinzelt die Flanken der Gipfel hinauf, auf Moränen oder bröckelnden Felsvorsprüngen, wo immer sie Halt finden kann, bis auf eine Höhe von 3.000 bis 3.660 Metern, wo sie zu einer Masse krummer, niederliegender Zweige heranwächst, die mit schlanken, aufrecht stehenden Trieben bedeckt sind, von denen jeder an der Spitze eine kurze, dicht gepackte Blattquaste trägt. Die Rinde ist glatt und violett, an manchen Stellen fast weiß. Die fruchtbaren Zapfen wachsen in starren Büscheln auf den oberen Zweigen, sind in jungen Jahren dunkel schokoladenbraun und tragen wunderschöne perlenartige Samen von der Größe von Erbsen, von denen die meisten von zwei Tamias-Arten und der bemerkenswerten Clark-Krähe gefressen werden. Die männlichen Zapfen wachsen in Büscheln von etwa einem Zoll Breite unten zwischen den Blättern, und da sie leuchtend rosa-violett gefärbt sind, verleihen sie einem Baum dieser Art ein lebhaftes, blumiges Aussehen, das man nicht erwartet.
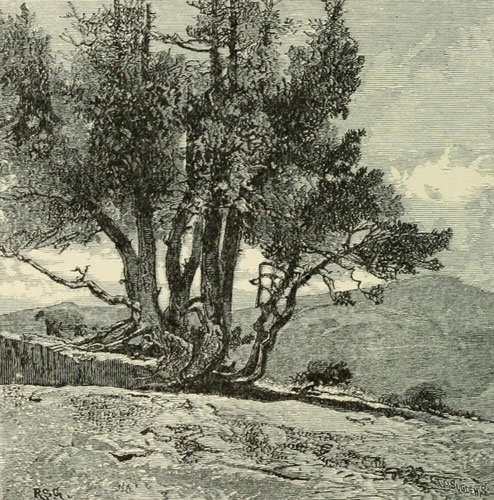
Kiefern werden allgemein als himmelliebende Bäume angesehen, die entweder nach oben streben oder sterben müssen. Diese Art bildet eine deutliche Ausnahme, denn sie wächst niedrig, um den strengsten Anforderungen des Klimas gerecht zu werden, und überdauert dennoch tapfer ein höheres Alter als viele ihrer erhabenen Verwandten in den Sonnenländern darunter. Aus der Ferne betrachtet würde man sie niemals für einen Baum irgendeiner Art halten. Dort drüben ist beispielsweise Cathedral Peak, etwa drei Meilen entfernt, mit einem verstreuten Bewuchs dieser Kiefer, der wie Moos über das Dach und um die abgeschrägten Kanten des Nordgiebels kriecht und nirgends einen Hinweis auf eine aufsteigende Achse gibt. Wenn man ganz nah herankommt, wirkt sie immer noch verfilzt und kahl und ist so niedrig, dass man keine großen Schwierigkeiten hat, über ihre Spitze zu gehen. Doch sie ist selten völlig niederliegend, erreicht in ihrer niedrigsten Position normalerweise eine Höhe von drei oder vier Fuß, mit einem Hauptstamm und Ästen, die sich darüber ausbreiten und verflechten, als ob sie beim Aufsteigen durch eine Decke aufgehalten worden wären, an der sie gewachsen waren und sich gezwungen sahen, sich horizontal auszubreiten. Der Schnee im Winter bildet tatsächlich eine solche Decke, die das halbe Jahr über liegen bleibt. Die gepresste, abgeraspelte Oberfläche wird jedoch durch heftige Winde noch glatter gemacht. Diese Winde mit ihren schneidenden Sandkörnern schlagen jeden Trieb nieder, der sich weit über das allgemeine Niveau erhebt, und formen wunderschöne Muster in den toten Stämmen und Zweigen.
In stürmischen Nächten habe ich oft gemütlich unter den verschlungenen Bögen dieser kleinen Kiefer gezeltet. Die Nadeln, die sich über Jahrhunderte angesammelt haben, ergeben schöne Betten, eine Tatsache, die auch andere Bergbewohner wie Hirsche und Wildschafe gut kennen, die ovale Höhlen aushöhlen und sich unter den größeren Bäumen in sicherer und bequemer Deckung niederlassen.

Die Langlebigkeit dieses bescheidenen Zwerges ist weitaus größer als man vermuten würde. Hier ist zum Beispiel ein Exemplar, das in einer Höhe von 10.700 Fuß wächst und aussieht, als könnte man es mitsamt der Wurzel ausreißen, denn es hat nur einen Durchmesser von dreieinhalb Zoll und seine oberste Quaste befindet sich kaum drei Fuß über dem Boden. Wenn wir es halb durchschneiden und die Jahresringe mit Hilfe einer Lupe zählen, stellen wir fest, dass es nicht weniger als 255 Jahre alt ist. Hier ist ein weiteres aussagekräftiges Exemplar von etwa gleicher Höhe, 426 Jahre alt, dessen Stamm nur sechs Zoll im Durchmesser misst; und einer seiner biegsamen Zweige, der innerhalb der Rinde kaum einen Achtelzoll im Durchmesser misst, ist fünfundsiebzig Jahre alt und so mit öligem Balsam gefüllt und von Stürmen so gut abgelagert, dass wir ihn wie eine Peitschenschnur verknoten können.
WEISSE KIEFER
Pinus flexilis
Diese Art ist in den Rocky Mountains und in allen höheren der vielen Gebirgsketten des Großen Beckens zwischen den Wahsatch Mountains und der Sierra weit verbreitet, wo sie als Weißkiefer bekannt ist. In der Sierra ist sie spärlich verstreut entlang der Ostflanke, vom Bloody Cañon im Süden fast bis zum äußersten Ende der Gebirgskette, gegenüber dem Dorf Lone Pine, und bildet nirgends einen nennenswerten Teil des Gesamtwaldes. Aufgrund ihrer besonderen Position in losen, verstreuten Gruppen scheint sie aus den Gebirgsketten des Beckens im Osten zu stammen, wo sie häufig vorkommt.
Es ist ein größerer Baum als die Zwergkiefer. In einer Höhe von etwa 9.000 Fuß über dem Meeresspiegel erreicht es oft eine Höhe von vierzig oder fünfzig Fuß und einen Durchmesser von drei bis fünf Fuß. Die Zapfen öffnen sich frei, wenn sie reif sind, und sind doppelt so groß wie die der albicaulis , und das Laub und die Zweige sind offener und neigen dazu, in freien, wilden Kurven auszubrechen, wie die der Bergkiefer, mit der es eng verwandt ist. Man findet es selten tiefer als 9.000 Fuß über dem Meeresspiegel, aber von dieser Höhe schiebt es sich nach oben über die rauesten Felsvorsprünge bis zur äußersten Grenze des Baumwachstums, wo es in seinem zwergartigen, sturmzerdrückten Zustand eher der Art mit der weißen Rinde ähnelt.
In ganz Utah und Nevada ist es einer der wichtigsten Nutzholzbäume, von denen jedes Jahr große Mengen für die Minen gefällt werden. Der berühmte White Pine Mining District, White Pine City und die White Pine Mountains haben ihre Namen von ihm.
NADELKIEFER
(Pinus aristata)
Diese Art ist in der Sierra auf den südlichen Teil des Gebirges beschränkt, etwa an den Quellgewässern der Flüsse Kings und Kern, wo sie ausgedehnte Wälder bildet und an manchen Stellen die Zwergkiefer bis zur äußersten Grenze des Baumwachstums begleitet.
Man trifft zuerst auf einer Höhe zwischen 9.000 und 10.000 Fuß und wächst bis auf 11.000 Fuß, ohne dass das Klima oder die Kargheit des Bodens nennenswert darunter zu leiden scheinen. Es ist ein viel schönerer Baum als die Zwergkiefer. Statt in Büscheln und niedrigen, heidebewachsenen Matten zu wachsen, gelingt es ihr irgendwie, eine aufrechte Position beizubehalten, und sie steht gewöhnlich einzeln. Wo immer die jungen Bäume überhaupt geschützt sind, wachsen sie gerade und pfeilförmig nach oben, mit zart verjüngtem Stamm und aufsteigenden Zweigen, die mit glänzenden Flaschenbürstenquasten enden. Im mittleren Alter sind bestimmte Äste spezialisiert und weit nach außen geschoben, um Zapfen zu tragen, nach Art der Zuckerkiefer; und im Alter hängen diese Zweige herab und ragen in alle Richtungen, was sehr malerische Effekte erzeugt. Der Stamm wird dunkelbraun und rau, wie der der Bergkiefer, während die jungen Zapfen eine seltsame, stumpfe, schwarzblaue Farbe haben und sich an den oberen Zweigen drängen. Wenn sie reif sind, sind sie drei bis vier Zoll lang, gelblich braun und ähneln in jeder Hinsicht denen der Bergkiefer. Mit Ausnahme der Zuckerkiefer ist kein Baum in den Bergen so individuell ausdrucksstark, während er in seiner Anmut von Form und Bewegung ständig an die Hemlocktanne erinnert.
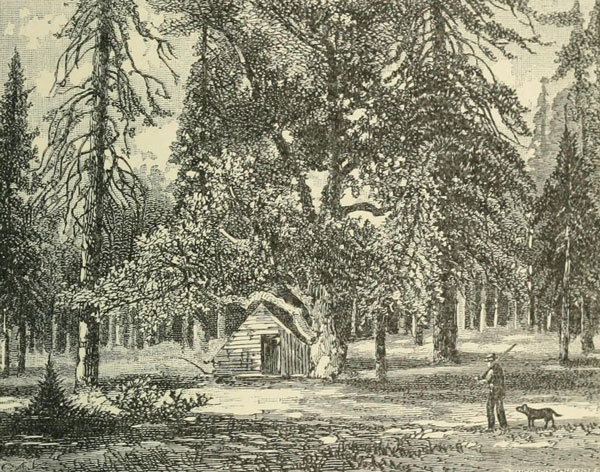
Das größte Exemplar, das ich gemessen habe, hatte einen Durchmesser von etwas über 1,52 m und eine Höhe von 27,52 m, was jedoch mehr als das Doppelte der üblichen Größe ist.
Diese Art ist in den Rocky Mountains und den meisten kleineren Gebirgsketten des Großen Beckens verbreitet, wo sie wegen ihrer langen, dichten Blattquasten „Fuchsschwanz-Kiefer“ genannt wird. In den Gebirgsketten Hot Creek, White Pine und Golden Gate ist sie recht häufig. Etwa 35 cm der Enden der Zweige sind dicht mit steifen, hervorstehenden Nadeln besetzt, die wie der Schwanz eines elektrischen Fuchses oder Eichhörnchens strahlen. Die Nadeln sind glänzend, und das durch sie hindurchscheinende Sonnenlicht lässt sie in silbrigem Schimmer brennen, während ihre Zahl und Elastizität im Wind entzückend zur Geltung kommen. Dieser Baum ist hier noch ursprünglicher und malerischer als in der Sierra und übertrifft in dieser Hinsicht nicht nur seine Begleitkoniferen bei weitem, sondern auch die berühmtesten Tiefland-Eichen. Einige stehen fest aufrecht, bis zum Boden mit strahlenden Quasten gefiedert, und bilden schlanke, sich spitz zulaufende Türme aus glänzendem Grün; andere, mit zwei oder drei spezialisierten Ästen, die im rechten Winkel zum Stamm herausragen und dicht mit Quastenzweigen bedeckt sind, nehmen die Form wunderschöner, dekorativer Kreuze an. In denselben Wäldern findet man wiederum Bäume, die aus mehreren Stämmen bestehen, die in Bodennähe zusammengewachsen sind und sich an den Seiten in einer Ebene parallel zur Bergachse ausbreiten, wobei die eleganten Quasten in bezaubernder Ordnung zwischen ihnen hängen und eine Harfe bilden, die gegen die Hauptwindlinien gehalten wird, wo sie am wirkungsvollsten die großen Sturmharmonien spielen. Und außerdem gibt es viele variable Bogenformen, allein oder in Gruppen, mit unzähligen Quasten, die unter den Bögen herabhängen oder über ihnen strahlen, und viele niedrige Riesen ohne besondere Form, die den Stürmen von tausend Jahren getrotzt haben. Aber ob alt oder jung, geschützt oder den wildesten Stürmen ausgesetzt, dieser Baum ist immer unbändig und extravagant malerisch und bietet dem Künstler eine reichere und vielfältigere Reihe von Formen als jeder andere Nadelbaum, den ich kenne.
NUSSKIEFER
(Pinus monophylla)
Die Nusskiefer bedeckt oder vielmehr besprenkelt die Ostflanke der Sierra, auf die sie größtenteils beschränkt ist, in gräulichen, buschartigen Flecken, vom Rand der Salbeiebenen bis zu einer Höhe von 7.000 bis 8.000 Fuß.
Ein zufriedener gedeihenderer und bescheidenerer Nadelbaum kann nicht erdacht werden. Alle Arten, die wir skizziert haben, weichen mehr oder weniger weit von der typischen Turmform ab, aber keine geht so weit wie diese. Ohne erkennbare klimatische oder Bodenbedingte Zwänge bleibt er in Bodennähe, wirft krumme, auseinandergehende Zweige wie ein Apfelbaum im Obstgarten aus und treibt selten einen einzigen Trieb höher als fünfzehn oder zwanzig Fuß über den Boden.
Die durchschnittliche Dicke des Stammes beträgt etwa 25 bis 30 Zentimeter. Die Blätter sind meist ungeteilt, wie runde Ahlen, statt wie bei anderen Kiefern in zwei, drei oder fünf getrennt zu sein. Die Zapfen sind während des Wachstums grün und sind normalerweise über den ganzen Baum verteilt, wobei sie sich deutlich vom bläulich-grauen Laub abheben. Sie sind recht klein, nur etwa 5 Zentimeter lang und versprechen keine essbaren Nüsse; aber wenn wir sie öffnen, stellen wir fest, dass etwa die Hälfte des gesamten Zapfens aus süßen, nahrhaften Samen besteht, deren Kerne fast so groß sind wie die von Haselnüssen.
Dies ist zweifellos der wichtigste Nahrungsbaum der Sierra und liefert den Mono-, Carson- und Walker-River-Indianern mehr und bessere Nüsse als alle anderen Arten zusammen. Es ist der Baum der Indianer, und viele Weiße haben sie getötet, weil sie ihn gefällt haben.
Bei seiner Entwicklung scheint die Natur darauf abgezielt zu haben, eine möglichst große fruchttragende Oberfläche zu bilden. Da die Zapfen so niedrig und zugänglich sind, können sie leicht mit Stangen abgeschlagen und die Nüsse gewonnen werden, indem man sie röstet, bis sich die Schalen öffnen. In fruchtbaren Jahreszeiten kann ein einzelner Indianer dreißig oder vierzig Scheffel davon sammeln – eine schöne, eichhörnchenartige Beschäftigung.
Von allen Nadelbäumen entlang der östlichen Basis der Sierra und auf allen vielen Berggruppen und kurzen Gebirgszügen des Großen Beckens ist diese nahrhafte kleine Kiefer der häufigste und wichtigste Baum. Fast jeder Berg ist bis zu einer Höhe von 8000 bis 9000 Fuß über dem Meeresspiegel mit dieser Art bepflanzt. Einige sind von der Basis bis zum Gipfel mit dieser einen Art bedeckt, wobei nur ein spärliches Wacholderwachstum an den unteren Hängen die Kontinuität ihrer eigentümlichen Wälder unterbricht, die zwar aus der Ferne dunkel aussehen, aber fast schattenlos sind und keine der feuchten, laubbedeckten Täler und Täler aufweisen, die für andere Kiefernwälder so charakteristisch sind. Zehntausende Morgen kommen in zusammenhängenden Gürteln vor. Tatsächlich scheint das gesamte Becken, umfassend betrachtet, ziemlich gleichmäßig in ebene Ebenen mit Salbeibüschen und Bergketten mit Nusskiefern aufgeteilt zu sein. Kein Hang ist zu rau, keiner zu trocken für diese üppigen Obstgärten des roten Mannes.
Der Wert dieser Art für Nevada kann nicht leicht überschätzt werden. Sie liefert Holzkohle und Bauholz für die Minen und versorgt die Ranches zusammen mit dem Wacholder mit Brennstoff und groben Zäunen. In fruchtbaren Jahreszeiten ist die Nussernte vielleicht größer als die kalifornische Weizenernte, die auf den Lebensmittelmärkten der Welt so großen Einfluss ausübt. Wenn die Ernte reif ist, machen die Indianer die langen Schlagstangen bereit; Taschen, Körbe, Matten und Säcke werden gesammelt; die Frauen, die bei den Siedlern zu Diensten sind, um zu waschen oder zu schuften, versammeln sich in den Familienhütten; die Männer verlassen ihre Arbeit auf der Ranch; Alt und Jung, alle steigen auf Ponys und brechen voller Freude in die Nusslande auf, wobei sie seltsam malerische Kavalkade bilden; brennende Schals und Kattunröcke wehen locker über die knotigen Ponys, auf denen normalerweise zwei Squaws reiten, mit bandagierten Zwergbabys in Körben, die sie auf den Rücken geworfen oder auf dem Sattelbogen balanciert haben; während Nusskörbe und Wasserkrüge auf jeder Seite hervorragen und die langen Schlagstangen in alle Richtungen schräg abstehen. An einem bekannten zentralen Punkt angekommen, wo es Gras und Wasser gibt, steigen die Squaws mit Körben und die Männer mit Stangen die Bergrücken zu den beladenen Bäumen hinauf, gefolgt von den Kindern. Dann beginnt das Schlagen in heiterem Tempo, die Kletten fliegen in alle Richtungen, rollen die Hänge hinunter, bleiben hier und da an Felsen und Salbeibüschen hängen und werden von den Frauen und Kindern mit natürlicher Freude gejagt und gesammelt. Rauchsäulen markieren schnell den freudigen Schauplatz ihrer Arbeit, wenn die Bratfeuer entzündet werden, und abends, in fröhlichen Kreisen versammelt und geschwätzig wie Eichelhäher, beginnen sie das erste Nussfest der Saison.
Die Nüsse sind etwa einen halben Zoll lang und einen Viertelzoll im Durchmesser, oben spitz, unten rund, von hellbrauner Farbe und wie viele andere Pinienkerne hübsch violett gesprenkelt, wie Vogeleier. Die Schalen sind dünn und können zwischen Daumen und Finger zerdrückt werden. Die Kerne sind weiß, werden beim Rösten braun und schmecken jedem Gaumen gut. Sie werden von Vögeln, Eichhörnchen, Hunden, Pferden und Menschen gegessen. Von der gesamten Ernte wird vielleicht weniger als ein Scheffel pro Tausend geerntet. Trotzdem bringen die Indianer in Zeiten des Überflusses große Mengen auf den Markt, um ihren eigenen Bedarf zu decken. Dann werden sie an fast jeder Feuerstelle im Staat gegessen und gelegentlich sogar anstelle von Gerste an Pferde verfüttert.
Zu den anderen Bäumen, die in der Sierra wachsen, aber nur einen sehr kleinen Teil des Gesamtwaldes ausmachen, können wir kurz Folgendes erwähnen:
Chamoecyparis Lawsoniana ist ein prächtiger Baum in den Küstengebirgen, aber klein in der Sierra. Man findet ihn nur weit im Norden entlang der Ufer kühler Flüsse im oberen Sacramento in Richtung Mount Shasta. Nur wenige Bäume dieser Art haben sich, soweit ich gesehen habe, bisher einen Platz in den Wäldern der Sierra erobert. Er ist offensichtlich aus dem Küstengebirge über das Gewirr der miteinander verbundenen Berge am Kopf des Sacramento Valleys gekommen.
In schattigen Tälern und an kühlen Flussufern der nördlichen Sierra finden wir auch die Eibe (Taxus brevifolia).
Der interessante Muskatnussbaum (Torreya Californica) wächst spärlich entlang der Westflanke der Gebirgskette in einer Höhe von etwa 4000 Fuß, meist in Schluchten und Canyons. Er ist ein kleiner, glänzender, immergrüner Baum mit stacheligen Blättern, der wie ein Nadelbaum aussieht, zwischen 20 und 50 Fuß hoch und 1 bis 2 Fuß im Durchmesser ist. Die Frucht ähnelt einer Reineclaude und enthält einen Samen, der etwa so groß wie eine Eichel ist und wie eine Muskatnuss aussieht, daher der gebräuchliche Name. Das Holz ist fein gemasert und hat eine schöne, cremig-gelbe Farbe wie Buchsbaum und duftet im trockenen Zustand süß, obwohl die grünen Blätter einen unangenehmen Geruch abgeben.
Betula occidentalis , die einzige Birke, ist ein kleiner, schlanker Baum, der auf die Ostflanke des Gebirges entlang der Flussufer unterhalb des Kieferngürtels beschränkt ist, insbesondere in Owen’s Valley.
Erlen, Ahorn und Nuttall-Hartriegel bilden wunderschöne Lauben über schnellen, kühlen Bächen in einer Höhe von 3.000 bis 5.000 Fuß, mehr oder weniger vermischt mit Weiden und Pappeln; und darüber in den Seebecken bildet die Espe schöne, dekorative Haine und lässt ihr Licht in den Herbstmonaten herrlich strahlen.
Die Kastanieneiche ( Quercus densiflora ) scheint wie die Chamaecyparis aus der Küstenkette rund um das obere Ende des Sacramento Valley zu stammen, aber je weiter sie sich nach Süden entlang der unteren Kante des Hauptkiefergürtels ausbreitet, desto kleiner wird sie, bis sie schließlich zu einem bloßen Chaparral-Busch verkümmert. In den Küstenbergen ist sie ein schöner, hoher, eher schlanker Baum, etwa 18 bis 23 Meter hoch, der zusammen mit dem großen Sequoia sempervirens oder Redwood wächst. Aber leider ist sie zu schade, um zu überleben, und wird jetzt schnell für die Gewinnung von Gerberillen zerstört.

Außer der gewöhnlichen Douglas-Eiche und der stattlichen Quercus Wislizeni der Vorgebirge und mehreren kleinen Arten, die dichte Chaparral-Wucher bilden, gibt es zwei Bergeichen, die zusammen mit den Kiefern bis zu einer Höhe von etwa 5.000 Fuß über dem Meeresspiegel wachsen und die Schönheit der Yosemite-Parks erheblich bereichern. Es handelt sich dabei um die Berg-Lebenseiche und die Kellogg-Eiche, die zu Ehren des bewundernswerten botanischen Pioniers Kaliforniens benannt wurde. Die Kellogg-Eiche (Quercus Kelloggii ) ist ein fester, leuchtender, schöner Baum, der eine Höhe von 60 Fuß und einen Durchmesser von 4 bis 7 Fuß erreicht und weit ausladende Äste hat. Sie wächst in sonnigen Tälern und Ebenen zwischen den immergrünen Bäumen in einer Höhe von 3.000 bis 5.000 Fuß, in noch höheren Lagen in zwergwüchsigen Sträuchern. In den von Klippen umgebenen Parks etwa 4.000 Fuß über dem Meeresspiegel ist sie so häufig und wirksam, dass man sie getrost Yosemite-Eiche nennen könnte. Die Blätter färben sich im Frühjahr üppig violett und im reifen Herbst gelb; die Eicheln werden von Indianern, Eichhörnchen und Spechten eifrig gesammelt. Die Berg-Weißeiche (Q. Chrysolepis) ist ein zäher, robuster Bergbaum, der tapfer auf den rauesten Erdbebenschuttflächen in tiefen Canyons und Yosemite-Tälern wächst und edle Ausmaße erreicht. Der Stamm ist normalerweise kurz und teilt sich in Bodennähe in große, weit ausladende Äste und diese wiederum in eine Vielzahl schlanker Zweige, von denen viele schnurartig bis zum Boden hängen, wie bei der Weißen Eiche des Tieflands ( Q. lobata). Die Spitze des Baumes ist dort, wo viel Platz ist, breit und bogig und dicht mit glänzenden Blättern bedeckt, die ein reizendes Blätterdach bilden. Das komplizierte System aus grauen, ineinander verschlungenen, gewölbten Zweigen ist von unten betrachtet außerordentlich üppig und malerisch. Kein anderer Baum, den ich kenne, wächst bei klimatischen Veränderungen aufgrund von Höhenunterschieden so regelmäßig und vollständig wie dieser. Am Fuße einer Schlucht, 4000 Fuß über dem Meeresspiegel, findet man prächtige Exemplare dieser Eiche, die fünfzig Fuß hoch sind, mit schroffen, gewölbten Stämmen von fünf bis sieben Fuß Durchmesser, und am Kopf der Schlucht, 2500 Fuß höher, einen dichten, weichen, niedrigen, strauchartigen Wuchs derselben Art, während sich den ganzen Weg die Schlucht hinauf zwischen diesen Extremen in Größe und Wuchs eine perfekte Abstufung feststellen lässt. Der größte, den ich gesehen habe, war fünfzig Fuß hoch, acht Fuß im Durchmesser und etwa fünfundsiebzig Fuß breit. Der Stamm bestand nur aus Ästen und Strebepfeilern, war grau wie Granit und ungefähr so eckig und unregelmäßig wie die Felsblöcke, auf denen er wuchs – eine Art unerschütterliche, unbeugsame Stärke.
KAPITEL IX
DAS DOUGLAS-EICHHÖRNCHEN
(Sciurus Douglasii)
Das Douglas-Hörnchen ist bei weitem die interessanteste und einflussreichste Art der kalifornischen Hörnchenfamilie. Es übertrifft alle anderen Arten hinsichtlich Charakterstärke, Anzahl und Verbreitungsgebiet und hinsichtlich des Einflusses, den es auf die Gesundheit und Verbreitung der riesigen Wälder hat, die es bewohnt.
Wohin Sie auch gehen, durch die edlen Wälder der Sierra Nevada, zwischen den riesigen Kiefern und Fichten der unteren Zonen, hinauf durch die hoch aufragenden Weißtannen bis hin zu den sturmgebeugten Dickichten der Gipfel, überall finden Sie dieses kleine Eichhörnchen als Meister der Existenz. Obwohl es nur wenige Zentimeter lang ist, ist seine feurige Kraft und Ruhelosigkeit so intensiv, dass es jeden Wald mit wildem Leben aufwühlt und sich wichtiger macht als selbst die riesigen Bären, die durch das Gewirr unter ihm schlurfen. Jeder Wind wird von seiner Stimme gereizt, fast jeder Stamm und Ast spürt den Stich seiner scharfen Füße. Wie sehr das Wachstum der Bäume durch dieses Mittel angeregt wird, ist nicht leicht zu lernen, aber seine Tätigkeit bei der Manipulation ihrer Samen ist bemerkenswerter. Die Natur hat ihn zum Meisterförster gemacht und den Großteil ihrer Nadelholzernte seinen Pfoten anvertraut. Wahrscheinlich werden über fünfzig Prozent aller in der Sierra gereiften Zapfen allein von der Douglasie abgeschnitten und verarbeitet, und von denen der großen Bäume vielleicht neunzig Prozent. durch seine Hände gehen: der größere Teil wird natürlich als Nahrung für den Winter und Frühling eingelagert, aber einige werden separat in lose abgedeckte Löcher gesteckt, wo einige der Samen keimen und zu Bäumen werden. Aber die Sierra ist nur eine der vielen Provinzen, über die er herrscht, denn sein Herrschaftsgebiet erstreckt sich über den gesamten Redwood-Gürtel der Coast Mountains und weit nach Norden über die majestätischen Wälder von Oregon, Washington und British Columbia. Ich beeile mich, diese Tatsachen zu erwähnen, um zu zeigen, auf welch solider Grundlage die Bedeutung beruht, die ich ihm zuschreibe.
Die Douglasie ist eng mit dem Eichhörnchen oder Chickaree der östlichen Wälder verwandt. Unseres ist möglicherweise ein direkter Nachkomme dieser Art, die sich westwärts über die Großen Seen und die Rocky Mountains bis zum Pazifik und von dort südwärts entlang unserer Waldgebiete verbreitete. Diese Ansicht wird durch die Tatsache nahegelegt, dass unsere Art im Allgemeinen röter und Chickaree-ähnlicher wird, je weiter man sie entlang des oben angegebenen Verlaufs zurückverfolgt. Aber unabhängig von ihrer Verwandtschaft und den evolutionären Kräften, die auf sie eingewirkt haben, ist die Douglasie heute das größere und schönere Tier.
Von der Nase bis zur Schwanzwurzel misst er etwa 20 cm; und sein Schwanz, den er so wirkungsvoll zum Ausdrücken seiner Gefühle einsetzt, ist etwa 15 cm lang. Sein Fell ist dunkelblaugrau auf dem Rücken und auf halber Höhe der Seiten, hellbraun auf dem Bauch und hat einen dunkelgrauen, fast schwarzen Streifen, der die obere und untere Farbe trennt; dieser Trennstreifen ist jedoch nicht sehr scharf abgegrenzt. Er hat lange schwarze Schnurrhaare, die ihm bei genauer Betrachtung ein ziemlich wildes Aussehen verleihen, starke Krallen, scharf wie Angelhaken, und die hellsten aller hellen Augen voller vielsagender Spekulation.
Ein Indianer vom King’s River erzählte mir, dass sie ihn „Pillillooeet“ nennen, was, schnell ausgesprochen mit starker Betonung der ersten Silbe, nicht unähnlich dem lustvollen Ausruf ist, den er ausstößt, wenn er aufgeregt ist, wenn er einen Baum hinaufklettert. Die meisten Bergsteiger in Kalifornien nennen ihn das Kiefernhörnchen, und als ich einen alten Fallensteller fragte, ob er unseren kleinen Förster kenne, antwortete er mit aufhellender Miene: „Oh ja, natürlich kenne ich ihn; jeder kennt ihn. Wenn ich im Wald jage, finde ich oft heraus, wo die Hirsche sind, indem er sie anbellt. Ich nenne sie Blitzhörnchen, weil sie so mächtig schnell und scharf sind.“
Alle echten Eichhörnchen ähneln in Sprache und Bewegungen mehr oder weniger vogelähnlich, aber das Douglas ist dies in besonderem Maße, da es alle eichhörnchentypischen Eigenschaften in enthusiastischer Konzentration besitzt. Es ist das Eichhörnchen aller Eichhörnchen und flitzt von Ast zu Ast seiner liebsten immergrünen Bäume, frisch und glänzend und unversehrt wie ein Sonnenstrahl. Geben Sie ihm Flügel, und es würde jeden Vogel im Wald überfliegen. Sein großer grauer Vetter ist ein lockereres Tier, scheinbar leicht genug, um im Wind zu schweben; doch wenn es von Ast zu Ast oder von einer Baumkrone zur anderen springt, hält es manchmal inne, um Kraft zu sammeln, so als unternehme es Anstrengungen, deren Ausgang es sich nicht immer ganz sicher ist. Aber das Douglas mit seinem dichteren Körper springt und gleitet mit verborgener Kraft, scheinbar so unabhängig von gewöhnlichen Muskeln wie ein Gebirgsbach. Es fädelt die bequasten Zweige der Kiefern ein und bewegt ihre Nadeln wie eine rauschende Brise, oder schießt in pfeilartigen Linien über Öffnungen; mal springt er in Kurven, schillert in plötzlichen Zickzacklinien geschickt von einer Seite zur anderen und wirbelt in schwindelerregenden Schleifen und Spiralen um die knotigen Stämme; er gerät ohne Gefühl der Gefahr in scheinbar unmögliche Situationen; mal auf den Fersen, mal auf dem Kopf; und doch immer anmutig und seine unbändigsten Energieausbrüche mit kleinen Punkten und Strichen vollkommener Ruhe unterbrechend. Er ist ohne Ausnahme das wildeste Tier, das ich je gesehen habe – ein feuriger, spritzender kleiner Lebensblitz, der in schnellem Sauerstoff und den besten Säften des Waldes schwelgt. Man kann sich kaum vorstellen, dass ein solches Geschöpf wie der Rest von uns von Klima und Nahrung abhängig ist. Aber schließlich muss man ihn nicht lange kennen, um zu wissen, dass er ein Mensch ist, denn er arbeitet, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Am arbeitsreichsten ist er im Altweibersommer. Dann sammelt er Kletten und Haselnüsse wie ein mühsam arbeitender Bauer und arbeitet jeden Tag stundenlang, ohne ein Wort zu sagen; Er schneidet die reifen Zapfen in aller Eile ab, als wäre er mit der Arbeit beschäftigt, und untersucht jeden Zweig in aller Regelmäßigkeit, als wolle er darauf achten, dass ihm keiner entgeht; dann steigt er herab und verstaut sie unter Baumstämmen und Baumstümpfen, in Erwartung der stechenden Hungertage des Winters. Er selbst kommt sich vor wie eine Art Nadelbaumfrucht – sowohl Frucht als auch Blüte. Die harzigen Essenzen der Kiefern durchdringen jede Pore seines Körpers, und ihr Fleisch zu essen ist wie Kaugummi.
Man wird nie müde von diesem strahlenden Stück Natur – dieser tapferen kleinen Stimme, die in der Wildnis schreit –, seine vielen Werke und Wege zu beobachten und seiner eigenartigen Sprache zu lauschen. Sein musikalischer, harziger Klatsch ist so wohlschmeckend für das Ohr wie Balsam für den Gaumen; und obwohl er nicht gerade die Gabe des Singens hat, sind einige seiner Töne so süß wie die eines Hänflings – fast flötenartig in ihrer Sanftheit, während andere wie Disteln stechen und kribbeln. Er ist der Spottvogel der Eichhörnchen, der gemischtes Geschnatter und Gesang wie eine ewige Quelle hervorbringt; er bellt wie ein Hund, schreit wie ein Falke, zwitschert wie eine Amsel oder ein Spatz; während er in seiner rauhen, kühnen Lärmhaftigkeit ein echter Häher ist.
SPUR EINES DOUGLAS-EICHHÖRNCHENS, DAS EINMAL EINEN KIEFERBAUM RUNTER UND HINAUF IST, ALS ES SICH EINEM ZUSCHAUER ZEIGT.
Wenn er den Stamm eines Baumes hinabsteigt, um auf dem Boden zu landen, bewahrt er vorsichtiges Schweigen, vielleicht im Bewusstsein von Füchsen und Wildkatzen; aber wenn er sicher in den Wipfeln der Kiefern schaukelt, nimmt sein Herumtollen und sein Lärmen kein Ende; und wehe dem Grauhörnchen oder dem Streifenhörnchen, das es wagt, seinen Lieblingsbaum zu betreten! Egal, wie schlau sie die Furchen der Rinde ziehen, sie werden schnell entdeckt und mit komischer Heftigkeit die Treppe hinuntergestoßen, während ein Schwall wütender Töne aus seinen bärtigen Lippen strömt, der bemerkenswert wie ein Fluchen klingt. Manchmal versucht er sogar, Hunde und Menschen zu vertreiben, besonders wenn er sie vorher nicht gekannt hat. Wenn er einen Menschen zum ersten Mal sieht, nähert er sich immer mehr, bis er nur noch wenige Meter entfernt ist; dann stürzt er sich mit einem Wutausbruch plötzlich mit Zähnen und Augen darauf, als ob er einen auffressen wollte. Als es jedoch feststellt, dass das große, gegabelte Tier keinen Schrecken einflößt, zieht es sich vorsichtig zurück und setzt sich auf einen überhängenden Ast, um die Umgebung zu erkunden, wobei es jede Ihrer Bewegungen mit lächerlicher Feierlichkeit beobachtet. Es nimmt all seinen Mut zusammen und wagt sich wieder den Stamm hinab, schnattert und zwitschert und zuckt nervös in neugierigen Schleifen auf und ab und beäugt Sie dabei die ganze Zeit, als ob es davonschneien und Ihre Bewunderung fordern würde. Schließlich wird es ruhiger, lässt sich in bequemer Haltung auf einem waagerechten Ast mit guter Aussicht nieder und schlägt mit seinem Schwanz den Takt zu einem gleichmäßigen „Chee-up! Chee-up!“ oder, wenn es etwas weniger aufgeregt ist, „Pee-ah!“, wobei die erste Silbe scharf betont und die zweite wie der Schrei eines Falken in die Länge gezogen ist – wobei es dies zuerst langsam und nachdrücklicher wiederholt, dann allmählich schneller, bis es eine Geschwindigkeit von etwa 150 Wörtern pro Minute erreicht hat; Normalerweise sitzt er die ganze Zeit auf seinen Hinterbeinen, die Pfoten ruhen auf seiner Brust, die bei jedem Wort sichtbar pulsiert. Es ist auch bemerkenswert, dass er, obwohl er deutlich artikuliert, den Mund die meiste Zeit geschlossen hält und durch die Nase spricht. Ich habe ihn gelegentlich sogar dabei beobachtet, wie er Sequoia-Samen fraß und an einem lästigen Floh knabberte, ohne auch nur einen Moment lang mit seinem „Pipi! Pipi!“ aufzuhören oder es irgendwie durcheinander zu bringen.
Beim Erklimmen der Bäume kommen alle seine Krallen zum Einsatz, beim Abstieg wird sein Körpergewicht jedoch hauptsächlich von seinen Hinterfüßen getragen. In keinem der Fälle deuten seine Bewegungen jedoch auf Anstrengung hin, wenn Sie jedoch nahe genug stehen, können Sie die gewaltige Kraft seiner kurzen, bärenartigen Arme erkennen und seine sehnigen Fäuste bemerken, die er in der Rinde geballt hat.
Beim Auf- oder Absteigen trägt er seinen Schwanz in voller Länge in Linie mit seinem Körper ausgestreckt, sofern er ihn nicht für Gesten benötigt. Beim Laufen an waagerechten Ästen oder umgestürzten Stämmen ist er jedoch häufig nach vorne über den Rücken gefaltet und die luftige Spitze zart nach oben gebogen. Bei kühlem Wetter hält er ihn warm. Nachdem er dann seine Mahlzeit beendet hat, kann man ihn dicht auf einem ebenen Ast kauern sehen, mit ordentlich ausgebreitetem Schwanzkleid, das bis zu seinen Ohren reicht, und dessen elektrische, hervorstehende Haare wie Kiefernnadeln in der Brise zittern. Bei nassem oder sehr kaltem Wetter bleibt er jedoch in seinem Nest, und während er dort zusammengerollt ist, ist seine Bettdecke lang genug, um ihm bis um die Nase herumzureichen. Selten ist es jedoch so kalt, dass er nicht nach draußen gehen kann, um seine Vorräte zu holen, wenn er hungrig ist.
Als ich einmal von einem Sturm gebeutelt am oberen Rand der Baumgrenze auf Mount Shasta lag, das Thermometer stand fast auf Null und der Himmel war von dichtem Schneegestöber bedeckt, kam eine Douglasie mehrmals mutig aus einer der unteren Höhlen einer Zwergkiefer in der Nähe meines Lagers hervor, trotzte dem Wind, schien ihn scheinbar kaum zu spüren, hüpfte leichtfüßig über den mehligen Schnee und grub sich mit wunderbarer Präzision bis zu einigen verborgenen Samenkörner hinunter, als wäre die dicke Schneedecke für ihre Augen glasig.
Kein anderes der mir bekannten Sierra-Tiere wird besser gefüttert, nicht einmal der Hirsch, inmitten der Fülle von süßen Kräutern und Sträuchern, oder die Bergschafe oder die Allesfresserbären. Seine Nahrung besteht aus Grassamen, Beeren, Haselnüssen, Kastanien und den Nüssen und Samen aller Nadelbäume ohne Ausnahme – Kiefer, Tanne, Fichte, Libocedrus, Wacholder und Sequoia – er liebt sie alle und sie bekommen ihm alle, ob grün oder reif. Kein Zapfen ist ihm zu groß, keiner so klein, dass er ihn nicht bemerken würde. Die kleineren, wie die der Hemlocktanne, der Douglas-Fichte und der Zweiblättrigen Kiefer, schneidet er ab und frisst sie auf einem Ast des Baumes, ohne sie fallen zu lassen; er beginnt am unteren Ende des Zapfens und schneidet die Schuppen ab, um die Samen freizulegen; er nagt nicht auf gut Glück wie ein Bär, sondern dreht sie in regelmäßiger Reihenfolge im Kreis, entsprechend ihrer spiralförmigen Anordnung.
Bei dieser Tätigkeit verrät ihn ein Tropfen von Schuppen, Schalen und Samenflügeln und alle paar Minuten das Herabfallen der abgestreiften Zapfenachse, wo er sich im Baum befindet. Dann ist er natürlich bereit für einen weiteren Zapfen, und wer gut zusieht, kann ihn dabei beobachten, wie er lautlos zum Ende eines Astes gleitet und die Zapfenbüschel untersucht, bis er einen findet, der ihm gefällt. Dann beugt er sich vor, zieht die federnden Nadeln aus dem Weg, packt den Zapfen mit den Pfoten, damit er nicht herunterfällt, schneidet ihn in unglaublich kurzer Zeit ab, packt ihn mit grotesk aufgerissenem Maul und kehrt zu seinem gewählten Platz in der Nähe des Stammes zurück. Aber die enorme Größe der Zapfen der Zuckerkiefer – 38 bis 50 Zentimeter lang – und die der Jeffrey-Art der Gelbkiefer zwingen ihn, eine ganz andere Methode anzuwenden. Er schneidet sie ab, ohne zu versuchen, sie festzuhalten, geht dann nach unten und schleppt sie von der Stelle, an der sie zufällig heruntergefallen sind, nach oben auf den kahlen, anschwellenden Boden rund um den Spann des Baumes. Dort zerstört er sie auf die gleiche methodische Weise, indem er unten beginnt und den Schuppenspiralen bis nach oben folgt.
SAMEN, FLÜGEL UND SCHUPPEN DER ZUCKERKIEFER. (NAT. GRÖSSE.)
Aus einem einzigen Zapfen der Zuckerkiefer gewinnt er zwei- bis vierhundert Samen, die etwa halb so groß wie eine Haselnuss sind, so dass er in wenigen Minuten genug für eine Woche zusammenbekommt. Er scheint jedoch die der beiden Silber-Ersten allen anderen vorzuziehen; vielleicht, weil sie am leichtesten zu bekommen sind, da die Schuppen bei Reife abfallen, ohne dass man sie abschneiden muss. Beide Arten sind mit einem äußerst scharfen, aromatischen Öl gefüllt, das sein ganzes Fleisch würzt und allein schon für seine Blitzenergie ausreicht.
Sie können diesen kleinen Arbeiter leicht an seinen Spänen erkennen. Auf sonnigen Hügeln rund um die Hauptbäume liegen sie in großen Haufen – Scheffel und Körbe voll, alle frisch und sauber, und bilden die schönsten Küchenabfälle, die man sich vorstellen kann. Die braunen und gelben Schuppen und Nussschalen sind so zahlreich und so zart gezeichnet und gefärbt wie die Muscheln am Meeresufer; und die schönen roten und violetten Samenflügel, die sich unter sie mischen, lassen einen glauben, dass dort unzählige Schmetterlinge ihr Schicksal gefunden haben.
Er labt sich an allen Arten, lange bevor sie reif sind, ist aber klug genug, zu warten, bis sie reif sind, bevor er sie in seinen Scheunen sammelt. Das ist im Oktober und November, für ihn die beiden arbeitsreichsten Monate des Jahres. Alle Arten von Kletten, große und kleine, werden jetzt abgeschnitten und gleichermaßen herabgeschüttet, und der Boden ist rasch mit ihnen bedeckt. Ein ständiges Poltern und Stampfen ist anzuhalten; einige der größeren Zapfen, die zufällig auf alte Baumstämme fallen, lassen den Wald vom Geräusch widerhallen. Andere, weniger fleißige Nussfresser wissen genau, was vor sich geht, und beeilen sich, die Zapfen wegzutragen, wenn sie fallen. Aber wie beschäftigt der Ernter auch sein mag, er bemerkt die Diebe unten schnell und lässt sofort von seiner Arbeit ab, um sie zu vertreiben. Das kleine gestreifte Tamias ist ihm ein Dorn im Fleisch und stiehlt beharrlich, so sehr er es auch bestraft. Das große Grauhörnchen macht ebenfalls Ärger, obwohl das Douglas beschuldigt wurde, es bestohlen zu haben. Im Allgemeinen ist jedoch genau das Gegenteil der Fall.
Die Vorzüglichkeit der immergrünen Bäume der Sierra ist Baumschulen auf der ganzen Welt bekannt, daher besteht eine beträchtliche Nachfrage nach den Samen. Der größte Teil des Angebots wurde bisher durch Fällen der Bäume in den zugänglicheren Teilen des Waldes entlang der Reitwege, die die Bergkette durchqueren, beschafft. Sequoia-Samen brachten anfangs zwanzig bis dreißig Dollar pro Pfund ein und waren daher heiß begehrt. Einige der kleineren, fruchttragenden Bäume wurden in den nicht von der Regierung geschützten Wäldern gefällt, insbesondere in denen von Fresno und King’s River. Die meisten Sequoias sind jedoch so gigantisch, dass die Samenhändler den größten Teil ihrer Vorräte dem Douglas überlassen müssen, der bald merkt, dass er diesen Freibeutern nicht gewachsen ist. Er ist jedoch klug genug, seine Arbeit sofort einzustellen, wenn er sie bemerkt, und versäumt es nie, jede Gelegenheit zu nutzen, seine Kletten zu bergen, wenn sie zufällig an einem für ihn zugänglichen Ort gelagert werden, und der fleißige Samenhändler stellt bei seiner Rückkehr ins Lager oft fest, dass der kleine Douglas den Verderber gründlich verdorben hat. Ich kenne einen Samensammler, der, wenn er die Eichhörnchen ausraubt, als Gewissensgeld Weizen oder Gerste unter den Bäumen verstreut.
Der Mangel an spürbarem Leben, den so viele Reisende in den Wäldern der Sierra feststellen, ist zu dieser Jahreszeit nicht spürbar. Verbannen Sie alle summenden Insekten, Vögel und Vierbeiner und lassen Sie nur Sir Douglas zurück, und die einsamsten unserer sogenannten Einsamkeiten würden immer noch vor leidenschaftlichem Leben pulsieren. Aber wenn Sie ungeduldig sogar in die dicht bevölkertsten Wälder gehen würden, um ihn zu treffen, und herumlaufen und zwischen den Zweigen nach oben schauen würden, würden Sie sehr wenig von ihm sehen. Aber legen Sie sich an den Fuß eines der Bäume und er wird sofort kommen. Denn inmitten der gewöhnlichen Waldgeräusche, dem Fallen der Kletten, dem Piepsen der Wachteln, dem Schreien der Clark-Krähe und dem Rascheln der Hirsche und Bären im Chaparral, erkennt er Ihre seltsamen Schritte schnell und wird sich beeilen, Sie gründlich und genau zu inspizieren, sobald Sie still sind. Zuerst hören Sie vielleicht ein paar neugierige Fragen von ihm, aber wahrscheinlicher ist das erste Anzeichen seiner Annäherung das prickelnde Geräusch seiner Füße, wenn er den Baum über Ihnen heruntersteigt, kurz bevor er wild losrennt, um Sie zu erschrecken und jedem Eichhörnchen und Vogel in der Nachbarschaft Ihre Anwesenheit zu verkünden. Wenn Sie vollkommen reglos bleiben, wird er immer näher kommen und Ihnen wahrscheinlich ein Kribbeln in der Haut verursachen, indem er über Ihren Körper hüpft. Einmal, als ich am Fuße einer Hemlocktanne in einem der unzugänglichsten Yosemite-Berge von San Joaquin saß und mit Zeichnen beschäftigt war, kam ein tollkühner Kerl von hinten auf mich zu, ging unter meinem angewinkelten Arm hindurch und sprang auf mein Papier. Und an einem warmen Nachmittag, als ein alter Freund von mir im Schatten seiner Hütte las, sprang einer seiner Nachbarn aus Douglas vom Giebel auf seinen Kopf und lief dann mit bewundernswerter Sicherheit über seine Schulter hinunter und auf das Buch, das er in der Hand hielt.
Unser Douglas hat einen großen gesellschaftlichen Kreis; denn außer zu seinen zahlreichen Verwandten Sciurus fossor, Tamias quadrivitatus, T. Townsendii, Spermophilus Beccheyi, S. Douglasii pflegt er enge Beziehungen zu den nüssenfressenden Vögeln, besonders der Clark Crow (Picicorvus columbianus) und den zahlreichen Spechten und Eichelhähern. Die beiden Spermophilen kommen in den Niederungen und unteren Vorgebirgen erstaunlich häufig vor, sind aber im Douglas-Gebiet immer spärlicher verbreitet und wagen sich selten höher als 6.000 oder 7.000 Fuß über dem Meeresspiegel. Der graue Sciurus kommt nur wenig höher vor. Nur die kleine gestreifte Tamias ist überall mit ihm verkehrt. In den unteren und mittleren Zonen, wo sie alle zusammentreffen, leben sie einigermaßen harmonisch – eine glückliche Familie, obwohl man gelegentlich sehr amüsante Scharmützel beobachten kann. Überall dort, wo die Gletscher der Antike Waldboden verteilt haben, ist unser kleiner Held zu finden. Am häufigsten kommt er dort vor, wo tiefe Böden und mildes Klima zu einer entsprechenden Üppigkeit der Bäume geführt haben. Er folgt jedoch jeder Art von Bewuchs die geschwungenen Moränen hinauf bis zu den höchsten Gletscherquellen.
Obwohl ich natürlich nicht erwarten kann, dass alle meine Leser meine Bewunderung für dieses kleine Tier voll und ganz teilen, werden doch, so hoffe ich, nur wenige diese Skizze seines Lebens als zu lang empfinden. Ich kann hier gar nicht in Worte fassen, wie sehr er meine einsamen Wanderungen während all der Jahre aufgeheitert hat, in denen ich meine Studien in dieser herrlichen Wildnis betrieben habe; oder wie viel unverkennbare Menschlichkeit ich in ihm gefunden habe. Nehmen wir zum Beispiel Folgendes: An einem ruhigen, cremefarbenen Altweibersommermorgen, als die Nüsse reif waren, hatte ich in den oberen Kiefernwäldern des südlichen Arms des San Joaquin mein Lager aufgeschlagen, wo es ungefähr so viele Eichhörnchen zu geben schien wie die reifen Kletten. Sie nahmen ein frühes Frühstück ein, bevor sie zu ihrer regulären Erntearbeit gingen. Während ich mit meinem eigenen Frühstück beschäftigt war, hörte ich das dumpfe Fallen von zwei oder drei schweren Zapfen einer Gelbkiefer in meiner Nähe. Ich schlich mich geräuschlos bis auf etwa zwanzig Fuß an den Fuß der Kiefer heran, um sie zu beobachten. Nach wenigen Augenblicken fiel die Douglasie herunter. Die Frühstückskletten, die er abgeschnitten hatte, waren auf dem sanft abfallenden Boden in ein Büschgebüsch gerollt, aber er schien genau zu wissen, wo sie waren, denn er fand sie sofort, anscheinend ohne nach ihnen zu suchen. Sie waren mehr als doppelt so schwer wie er selbst, aber nachdem er sie in die richtige Position gebracht hatte, um mit seinen langen Sichelzähnen guten Halt zu bekommen, gelang es ihm, sie rückwärts an den Fuß des Baumes zu ziehen, von dem er sie abgeschnitten hatte. Dann setzte er sich bequem hin, hielt sie aufrecht, mit dem Boden nach oben, und vernichtete sie in aller Ruhe. Er musste ziemlich viel daran knabbern, bevor er etwas zu essen fand, da die unteren Schuppen unfruchtbar sind, aber als er sich geduldig zu den fruchtbaren hochgearbeitet hatte, fand er an der Basis jeder zwei süße Nüsse, die die Form von pariertem Schinken hatten und violett gefleckt waren wie Vogeleier. Und obwohl diese Zapfen von weichem Balsam trieften und mit Stacheln bedeckt waren und so fest zusammengefügt waren, dass ein Junge Schwierigkeiten gehabt hätte, sie mit einem Klappmesser aufzuschneiden, verzehrte er seine Mahlzeit mit gelassener Würde und Sauberkeit und machte dabei anscheinend weniger Anstrengung, als ein Mann, der weiche Speisen vom Teller isst.
Als wir mit dem Frühstück fertig waren, pfiff ich ihm eine Melodie vor, bevor er zur Arbeit ging, neugierig, wie sie auf ihn wirken würde. Er hatte mich die ganze Zeit nicht gesehen, aber als ich zu pfeifen begann, schoss er auf den Baum, der ihm am nächsten war, und kam auf einem kleinen toten Ast gegenüber von mir wieder heraus, wo er sich hinsetzte, um zuzuhören. Ich sang und pfiff mehr als ein Dutzend Melodien, und als die Musik wechselte, funkelten seine Augen, und er drehte seinen Kopf schnell von einer Seite auf die andere, zeigte aber sonst keine Reaktion. Andere Eichhörnchen, die die seltsamen Geräusche hörten, kamen von allen Seiten, auch Streifenhörnchen und Vögel. Einer der Vögel, eine hübsche, gefleckte Drossel, schien sogar noch interessierter zu sein als die Eichhörnchen. Nachdem er eine Weile auf einem der unteren, abgestorbenen Zweige einer Kiefer gelauscht hatte, kam er bis auf einen Meter an meinem Gesicht vorbeigeflogen und blieb etwa eine halbe Minute lang flatternd in der Luft hängen, wobei er sich mit schwirrenden Flügelschlägen am Leben hielt wie ein Kolibri vor einer Blüte, während ich in seine Augen blicken und sein unschuldiges Staunen sehen konnte.
Zu diesem Zeitpunkt muss mein Auftritt fast eine halbe Stunde gedauert haben. Ich sang oder pfiff „Bonnie Boon“, „Lass o’ Gowrie“, „O’er the Water to Charlie“, „Bonnie Woods o’ Cragie Lee“ usw., und alle schienen mit lebhaftem Interesse zuzuhören. Mein erster Douglas saß geduldig da und blickte mich mit seinen vielsagenden Augen an, bis ich es wagte, den „Old Hundredth“ zu singen. Dann schrie er seinen indianischen Namen Pillillooeet, drehte sich um und schoss mit lächerlicher Eile den Baum hinauf, außer Sichtweite. Dabei machten seine Stimme und sein Verhalten einen etwas profanen Eindruck, als hätte er gesagt: „Ich werde gehängt, wenn Sie mich dazu bringen, mir etwas so Feierliches und Unehrliches anzuhören.“ Dies war das Signal für die allgemeine Zerstreuung des ganzen haarigen Stammes, obwohl die Vögel bereit schienen, weitere Entwicklungen abzuwarten, da Musik von Natur aus mehr ihr Ding war.
Was an dieser großartigen alten Kirchenmelodie so abstoßend für Vögel und Eichhörnchen sein kann, kann ich mir nicht vorstellen. Ein oder zwei Jahre nach diesem High Sierra-Konzert saß ich eines schönen Tages auf einem Hügel in der Küstenkette, wo es viele Erdhörnchen gab. Sie waren sehr scheu, weil sie so oft gejagt wurden; aber nachdem ich etwa eine halbe Stunde lang still und bewegungslos gewesen war, begannen sie, sich aus ihren Löchern zu wagen und sich von den Samen der Gräser und Disteln um mich herum zu ernähren, als ob ich nicht mehr zu fürchten wäre als ein Baumstumpf. Dann kam mir der Gedanke, dass dies eine gute Gelegenheit war, herauszufinden, ob sie „Old Hundredth“ auch nicht mochten. Daher begann ich, so gut ich mich erinnern konnte, dieselben vertrauten Melodien zu pfeifen, die den Bergbewohnern der Sierra gefallen hatten. Sie hörten sofort auf zu fressen, richteten sich auf und hörten geduldig zu, bis ich zu „Old Hundredth“ kam, woraufhin jeder von ihnen mit lächerlicher Eile zu seinem Loch eilte und hineinstürmte, wobei ihre Füße einen Moment in der Luft funkelten, als sie verschwanden.
Jeder, der unseren Förster kennenlernt, wird ihn bewundern; aber er ist viel zu selbständig und kriegerisch, als dass man ihn für einen Liebling halten könnte.
Wie lange ein Douglas-Eichhörnchen leben kann, weiß ich nicht. Die Jungen scheinen aus Astlöchern zu sprießen, von Anfang an perfekt und so beständig wie ihre eigenen Bäume. Es ist in der Tat schwer zu begreifen, dass ein so verdichtetes Stück Sonnenfeuer jemals verblassen oder überhaupt sterben sollte. Es wird selten von Jägern getötet, da es zu klein ist, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, und wenn es in besiedelten Regionen verfolgt wird, wird es übermäßig scheu und hält sich dicht in den Furchen der höchsten Stämme auf, von denen viele dieselbe Farbe haben wie es selbst. Indianerjungen lauern jedoch mit grenzenloser Geduld auf sie, um sie mit Pfeilen zu erschießen. In den unteren und mittleren Zonen fallen einige Klapperschlangen zum Opfer. Gelegentlich wird es von Falken und Wildkatzen usw. verfolgt. Aber im Großen und Ganzen lebt es sicher im tiefen Schoß der Wälder, das am meisten begünstigte seiner glücklichen Sippe. Möge seine Sippe wachsen!
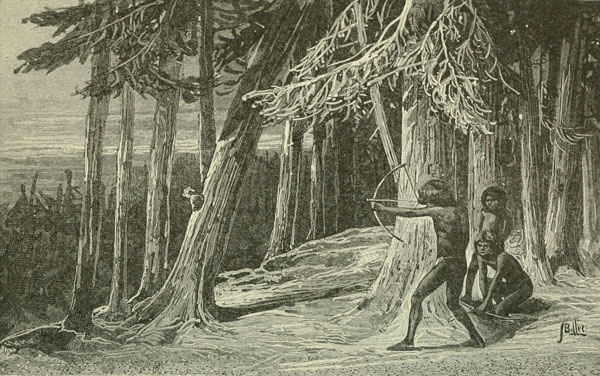
KAPITEL X
EIN STURM IN DEN WÄLDERN
Die Bergwinde werden wie Tau und Regen, Sonnenschein und Schnee wohldosiert und liebevoll auf die Wälder verteilt, damit sie ihre Kraft und Schönheit entfalten können. So begrenzt der Einflussbereich anderer Wälder auch sein mag, der der Winde ist allumfassend. Der Schnee biegt und stutzt die hochgelegenen Wälder jeden Winter, der Blitz schlägt hier und da in einen einzelnen Baum ein, während Lawinen auf einen Schlag Tausende niedermähen, so wie ein Gärtner ein Blumenbeet stutzt. Die Winde jedoch erreichen jeden Baum, befingern jedes Blatt, jeden Ast und jeden zerfurchten Stamm; keiner wird vergessen; die Bergkiefer thront mit ausgestreckten Armen auf den schroffen Strebepfeilern der eisigen Gipfel, ist der niedrigste und zurückgezogenste Bewohner der Täler; Sie suchen und finden sie alle, streicheln sie zärtlich, biegen sie in lustvoller Bewegung, stimulieren ihr Wachstum, reißen je nach Bedarf ein Blatt oder einen Ast ab oder entfernen einen ganzen Baum oder Hain, flüstern und gurren jetzt durch die Zweige wie ein schläfriges Kind, brüllen jetzt wie das Meer; die Winde segnen die Wälder, die Wälder die Winde, mit unbeschreiblicher Schönheit und Harmonie als sicherem Ergebnis.

Wenn man gesehen hat, wie sich Kiefern von sechs Fuß Durchmesser wie Gräser vor einem Gebirgssturm biegen und hin und wieder ein riesiger Baum mit einem Krachen umfällt, das die Berge erschüttert, dann ist es erstaunlich, dass es außer den niedrigsten, dicht stehenden Bäumen überhaupt jemals eine ausreichend sturmfreie Zeit gab, um sich zu etablieren, oder dass sie, wenn sie sich erst einmal etabliert hatten, nicht früher oder später umgeweht wurden. Aber wenn der Sturm vorüber ist und wir dieselben Wälder wieder ruhig erblicken, frisch und unversehrt in aufrechter Majestät, und wenn wir bedenken, wie viele Jahrhunderte Stürme sie seit ihrer ersten Pflanzung überstanden haben – Hagel, der die zarten Setzlinge zerschmettert; Blitze, die sie versengen und zerschmettern; Schnee, Winde und Lawinen, die sie zermalmen und überwältigen – während das offensichtliche Ergebnis all dieser wilden Sturmkultur die herrliche Vollkommenheit ist, die wir hier sehen; dann ist der Glaube an die Forstwirtschaft der Natur gefestigt und wir hören auf, die Gewalt ihrer zerstörerischsten Stürme oder irgendein anderes Sturmwerkzeug zu beklagen.
In den Wäldern der Sierra gibt es zwei Bäume, die nie umgeweht werden, solange sie gesund bleiben. Das sind der Wacholder und die Zwergkiefer auf den Berggipfeln. Ihre steifen, krummen Wurzeln klammern sich wie Adlerklauen an die sturmgepeitschten Felsvorsprünge, während ihre geschmeidigen, schnurartigen Äste sich nachgiebig biegen und dem Wind, wie heftig er auch sein mag, nur wenig Halt bieten. Die anderen alpinen Nadelbäume – die Nadelkiefer, die Bergkiefer, die Zweiblättrige Kiefer und die Hemlocktanne – werden aufgrund ihrer bewundernswerten Widerstandsfähigkeit und ihres dichten Wachstums durch diesen Wind nie in zerstörerischem Maße ausgedünnt. Im Allgemeinen gilt das Gleiche für die Riesen der niedrigeren Zonen. Die königliche Zuckerkiefer, die über 200 Fuß hoch aufragt, bietet Sturmwinden ein schönes Ziel, aber sie hat kein dichtes Laub, und ihre langen, waagerechten Arme schwingen im Sturm nachgiebig wie Locken grüner, fließender Algen in einem Bach; während die Weißtannen an den meisten Stellen ihre Reihen mit vereinten Kräften gut zusammenhalten. Die Gelb- oder Silberkiefer wird häufiger umgestürzt als jeder andere Baum in der Sierra, da ihre Blätter und Zweige im Verhältnis zu ihrer Höhe eine größere Masse bilden, während sie an vielen Stellen spärlich gepflanzt ist und offene Gassen hinterlässt, durch die Stürme mit voller Kraft eindringen können. Da sie außerdem entlang des unteren Teils der Bergkette verbreitet ist, der als erstes kahl blieb, als die Eisdecke am Ende des Eiswinters aufbrach, war der Boden, auf dem sie wächst, länger der postglazialen Verwitterung ausgesetzt und ist daher in einem bröckeligeren, verfaulteren Zustand als die frischeren Böden weiter oben in der Bergkette und bietet daher einen weniger sicheren Halt für die Wurzeln.
Als ich die Waldgebiete des Mount Shasta erkundete, entdeckte ich den Weg eines Hurrikans, der mit Tausenden von Kiefern dieser Art übersät war. Große und kleine Bäume waren durch schiere Kraft entwurzelt oder abgerissen worden und hinterließen eine saubere Lücke, wie sie eine Schneelawine hinterlassen hat. Doch Hurrikane, die solche Arbeit verrichten können, sind in der Sierra selten, und wenn wir die Wälder von einem Ende des Gebirges zum anderen erkundet haben, müssen wir glauben, dass sie die schönsten auf der Erde sind, wie auch immer wir die Einflüsse betrachten, die sie so gemacht haben.
Es ist immer etwas zutiefst Aufregendes, nicht nur in den Geräuschen des Windes in den Wäldern, die mehr oder weniger Einfluss auf jeden Geist ausüben, sondern auch in ihrem abwechslungsreichen, wasserähnlichen Fluss, der sich in den Bewegungen der Bäume, insbesondere der Nadelbäume, manifestiert. Bei keinem anderen Baum werden sie so umfassend und eindrucksvoll sichtbar gemacht, nicht einmal bei den stattlichen tropischen Palmen oder Baumfarnen, die auf die sanfteste Brise reagieren. Das Wogen eines Waldes aus riesigen Mammutbäumen ist unbeschreiblich eindrucksvoll und erhaben, aber die Kiefern scheinen mir die besten Interpreten des Windes zu sein. Sie sind gewaltige, wogende Goldruten, immer im Einklang, die ihr ganzes Jahrhundert lang Windmusik singen und schreiben. Von diesem edlen Baumwogen und dieser Baummusik werden Sie jedoch im rein alpinen Teil der Wälder wenig sehen oder hören. Der stämmige Wacholder, dessen Umfang manchmal mehr als seiner Höhe entspricht, ist ungefähr so starr wie die Felsen, auf denen er wächst. Die schlanken, peitschenartigen Zweige der Zwergkiefer strömen in wogenden Wellen, aber die höchsten und schlanksten sind viel zu unnachgiebig, um selbst bei den heftigsten Stürmen zu wehen. Sie zittern nur in schnellen, kurzen Schwingungen. Die Hemlocktannen und die Bergkiefern und einige der höchsten Dickichte der zweiblättrigen Arten beugen sich jedoch im Sturm mit beträchtlicher Weite und Anmut. Aber nur in den unteren und mittleren Zonen ist das Zusammentreffen von Wind und Wald in seiner ganzen Pracht zu sehen.
Einer der schönsten und aufregendsten Stürme, die ich je in der Sierra erlebt habe, ereignete sich im Dezember 1874, als ich zufällig eines der Nebentäler des Yuba River erkundete. Himmel, Boden und Bäume waren gründlich vom Regen gewaschen und wieder trocken. Der Tag war unglaublich rein, einer jener unvergleichlichen Teile des kalifornischen Winters, warm und mild und voller strahlendem weißen Sonnenschein, der nach den reinsten Einflüssen des Frühlings duftete und gleichzeitig von einem der kräftigsten Stürme belebt wurde, die man sich vorstellen kann. Anstatt wie gewöhnlich im Freien zu zelten, hielt ich zufällig im Haus eines Freundes. Aber als der Sturm zu stürmen begann, verlor ich keine Zeit und zog in den Wald, um ihn zu genießen. Denn bei solchen Gelegenheiten hat die Natur immer etwas Seltenes zu zeigen, und die Gefahr für Leib und Leben ist kaum größer, als wenn man missbilligend unter einem Dach kauert.
Es war noch früher Morgen, als ich mich ziemlich hilflos wiederfand. Herrlicher Sonnenschein ergoss sich über die Hügel, beleuchtete die Wipfel der Kiefern und setzte einen Dampf sommerlichen Duftes frei, der einen merkwürdigen Kontrast zu den wilden Tönen des Sturms bildete. Die Luft war gesprenkelt mit Kiefernquasten und hellgrünen Federbüschen, die im Sonnenlicht vorbeihuschten wie verfolgte Vögel. Aber es gab nicht die geringste Staubigkeit, nichts weniger Reines als Blätter und reifen Pollen und Flecken von verwelktem Adlerfarn und Moos. Stundenlang hörte ich Bäume umfallen, alle zwei oder drei Minuten einer; einige wurden entwurzelt, teilweise wegen des lockeren, wassergetränkten Bodens; andere brachen quer ab, wo eine durch Feuer verursachte Schwäche die Stelle bestimmt hatte. Die Bewegungen der verschiedenen Bäume boten ein entzückendes Studium. Junge Zuckerkiefern, leicht und federleicht wie Eichhörnchenschwänze, neigten sich fast bis zum Boden; während die großen alten Patriarchen, deren massive Stämme hunderten Stürmen ausgesetzt waren, feierlich über ihnen wehten, ihre langen, gewölbten Zweige im Wind dahinwehten und jede Nadel funkelte und klang und strahlte scharfe Lichtstrahlen aus wie ein Diamant. Die Douglasfichten mit ihren langen, in geraden Locken ausgebreiteten Zweigen und Nadeln in grauem, schimmerndem Glanz boten einen höchst eindrucksvollen Anblick, wie sie sich in kühnem Relief auf den Hügeln erhoben. Die Madroños in den Tälern mit ihrer roten Rinde und den großen, glänzenden, in alle Richtungen geneigten Blättern reflektierten das Sonnenlicht in pulsierenden Pailletten, wie man sie so oft auf der gekräuselten Oberfläche eines Gletschersees sieht. Aber die Silberkiefern waren jetzt die beeindruckendste Schönheit von allen. Kolossale, 200 Fuß hohe Türme schwankten wie biegsame Goldruten, sangen und verneigten sich tief wie in Anbetung, während die ganze Masse ihres langen, zitternden Laubes in einem einzigen ununterbrochenen Feuer aus weißem Sonnenfeuer entzündet war. Die Kraft des Sturms war so groß, dass der standhafteste Monarch von allen mit einer deutlich spürbaren Bewegung bis zu seinen Wurzeln zusammensackte, wenn man sich dagegen lehnte. Die Natur feierte ein großes Fest und jede Faser der starrsten Riesen erzitterte vor freudiger Erregung.
Ich trieb inmitten dieser leidenschaftlichen Musik und Bewegung weiter, durch viele Täler, von Bergrücken zu Bergrücken; oft blieb ich im Windschatten eines Felsens stehen, um Schutz zu suchen oder um zu blicken und zuzuhören. Selbst als die große Hymne ihren höchsten Ton erreicht hatte, konnte ich deutlich die verschiedenen Töne einzelner Bäume hören – Fichten, Tannen, Kiefern und blattlose Eichen – und sogar das unendlich sanfte Rascheln der verdorrten Gräser zu meinen Füßen. Jeder drückte sich auf seine eigene Weise aus – sang sein eigenes Lied und machte seine eigenen, besonderen Gesten – und offenbarte einen Reichtum an Vielfalt, wie ihn kein anderer Wald, den ich bisher gesehen habe, zu bieten hat. Die Nadelwälder Kanadas, der Carolinas und Floridas bestehen aus Bäumen, die einander ungefähr so ähnlich sind wie Grashalme und auf die gleiche Weise dicht beieinander wachsen. Nadelbäume besitzen im Allgemeinen selten einen individuellen Charakter, wie er bei Eichen und Ulmen zu beobachten ist. Aber die Wälder Kaliforniens bestehen aus einer größeren Anzahl unterschiedlicher Arten als alle anderen Wälder der Welt. Und in ihnen finden wir nicht nur eine ausgeprägte Differenzierung in spezielle Gruppen, sondern auch eine ausgeprägte Individualität in fast jedem Baum, was zu unbeschreiblich herrlichen Sturmeffekten führt.
Gegen Mittag erreichte ich nach einem langen, prickelnden Klettern durch Hasel- und Ceanothuswäldchen den Gipfel des höchsten Bergrückens in der Gegend; und dann kam mir der Gedanke, dass es eine schöne Sache wäre, auf einen der Bäume zu klettern, um eine bessere Aussicht zu haben und mein Ohr der äolischen Musik seiner obersten Nadeln näher zu bringen. Aber unter diesen Umständen war die Wahl eines Baumes eine ernste Angelegenheit. Einer, dessen Spann nicht sehr stark war, schien in Gefahr zu sein, umgeweht zu werden oder von anderen getroffen zu werden, falls sie fallen sollten; ein anderer war bis zu einer beträchtlichen Höhe über dem Boden astlos und gleichzeitig zu groß, um beim Klettern mit Armen und Beinen festgehalten zu werden; während andere für eine klare Aussicht nicht günstig gelegen waren. Nachdem ich mich vorsichtig umgesehen hatte, entschied ich mich für den größten einer Gruppe von Douglas-Fichten, die dicht beieinander wuchsen wie ein Grasbüschel, und von denen keine zu fallen schien, es sei denn, alle anderen fielen mit. Obwohl sie verhältnismäßig jung waren, waren sie etwa 100 Fuß hoch, und ihre geschmeidigen, buschigen Wipfel wiegten und wirbelten in wilder Ekstase. Da ich es gewohnt war, für botanische Studien auf Bäume zu klettern, hatte ich keine Schwierigkeiten, die Spitze dieses Baumes zu erreichen, und noch nie zuvor hatte ich eine so edle Erheiterung der Bewegung genossen. Die schlanken Wipfel flatterten und rauschten in dem leidenschaftlichen Strom, bogen und wirbelten vor und zurück, im Kreis herum und zeichneten unbeschreibliche Kombinationen aus vertikalen und horizontalen Kurven, während ich mich mit fest angespannten Muskeln festklammerte, wie ein Reisstärling an einem Schilfrohr.

Die beiden Bäume im Inneren sind Libocedrus, die beiden Bäume außen sind Gelbkiefern.
In den weitesten Ausschlägen beschrieb meine Baumkrone einen Bogen von zwanzig bis dreißig Grad, aber ich war mir ihrer Elastizität sicher, da ich andere Bäume derselben Art gesehen hatte, die noch stärker auf die Probe gestellt wurden – sie bogen sich bei starkem Schneefall fast bis zum Boden –, ohne dass auch nur eine Faser brach. Ich war also sicher und konnte den Wind in meinen Puls spüren und den aufregenden Wald von meinem herrlichen Aussichtspunkt aus genießen. Die Aussicht von hier musste bei jedem Wetter außerordentlich schön sein. Jetzt schweifte mein Blick über die kiefernbewachsenen Hügel und Täler wie über Felder mit wogendem Getreide und fühlte das Licht in Wellen und breiten, anschwellenden Wellen über die Täler von Bergrücken zu Bergrücken laufen, während das glänzende Laub von entsprechenden Luftwellen bewegt wurde. Oftmals brachen diese Wellen reflektierten Lichts plötzlich in eine Art geschlagenen Schaum auf, und wieder schienen sie sich, nachdem sie einander in regelmäßiger Reihenfolge verfolgt hatten, in konzentrischen Kurven nach vorne zu biegen und auf einem Hügel zu verschwinden, wie Meereswellen auf einem abfallenden Ufer. Die von den gebogenen Nadeln reflektierte Lichtmenge war so groß, dass ganze Haine aussahen, als seien sie mit Schnee bedeckt, während die schwarzen Schatten unter den Bäumen die Wirkung der silbrigen Pracht noch verstärkten.
Abgesehen von den Schatten war in diesem wilden Meer aus Kiefern nichts Düsteres. Im Gegenteil, obwohl es Winter war, waren die Farben bemerkenswert schön. Die Stämme der Kiefern und Libocedrus waren braun und violett, und das meiste Laub war stark gelb getönt; die Lorbeerhaine mit den nach oben gerichteten hellen Blattunterseiten bildeten graue Massen; und dann gab es viele schokoladenfarbene Spritzer von den Büscheln der Manzanita und leuchtendes Purpurrot von der Rinde der Madroños, während der Boden an den Berghängen, der hier und da durch die Öffnungen zwischen den Hainen hervorschaute, Massen von blassem Violett und Braun zeigte.
Die Geräusche des Sturms korrespondierten wunderbar mit dieser wilden Fülle von Licht und Bewegung. Der tiefe Bass der kahlen Äste und Stämme, die wie Wasserfälle dröhnten; die schnellen, angespannten Schwingungen der Kiefernnadeln, die sich bald zu einem schrillen, pfeifenden Zischen steigerten, bald zu einem seidigen Murmeln abfielen; das Rascheln der Lorbeerhaine in den Tälern und das scharfe metallische Klicken von Blatt auf Blatt – all dies konnte man bei ruhiger Aufmerksamkeit mühelos analysieren.
Die verschiedenen Gesten der Menge waren gut zu erkennen, so dass man die verschiedenen Arten aus mehreren Meilen Entfernung allein dadurch erkennen konnte, sowie an ihren Formen und Farben und der Art, wie sie das Licht reflektierten. Alle schienen stark und zufrieden, als ob sie den Sturm wirklich genossen und gleichzeitig seine enthusiastischsten Begrüßungen erwiderten. Wir hören heutzutage viel über den universellen Kampf ums Dasein, aber hier war kein Kampf im üblichen Sinne des Wortes zu sehen; kein Baum erkannte die Gefahr; keine Missbilligung; sondern eher eine unbesiegbare Freude, die ebenso weit von Jubel wie von Angst entfernt war.
Ich blieb stundenlang auf meinem hohen Sitz und schloss oft die Augen, um die Musik allein zu genießen oder mich in Ruhe an dem köstlichen Duft zu laben, der vorbeiströmte. Der Duft der Wälder war weniger ausgeprägt als der eines warmen Regens, wenn so viele balsamische Knospen und Blätter wie Tee aufgebrüht werden; aber durch das Reiben der harzigen Zweige aneinander und das unaufhörliche Reiben von Myriaden von Nadeln war der Sturm sehr belebend. Und neben dem Duft dieser lokalen Quellen gab es Spuren von Düften, die von weit her kamen. Denn dieser Wind kam zuerst vom Meer, rieb sich an seinen frischen, salzigen Wellen, strömte dann durch die Redwoods, durch üppige, farnbewachsene Schluchten und breitete sich in breiten, wellenförmigen Strömungen über viele blumenbedeckte Bergrücken der Küstenberge aus, dann über die goldenen Ebenen, die violetten Vorgebirge hinauf und in diese Kiefernwälder mit dem vielfältigen Weihrauch, den er unterwegs gesammelt hatte.
Winde sind Anzeigen für alles, was sie berühren, egal wie viel oder wenig wir in der Lage sind, sie zu lesen; sie verraten ihre Wanderungen sogar allein durch ihren Geruch. Seefahrer spüren den blumigen Duft von Landwinden weit auf See, und Seewinde tragen den Duft von Lappentang und Tang weit ins Landesinnere, wo er schnell erkannt wird, obwohl er mit dem Duft von tausend Landblumen vermischt ist. Als Beispiel dafür kann ich hier erzählen, dass ich als Junge auf dem Firth of Forth in Schottland Seeluft atmete; dann wurde ich nach Wisconsin gebracht, wo ich neunzehn Jahre blieb; Dann wanderte ich, ohne in dieser ganzen Zeit auch nur einen Atemzug Meer geatmet zu haben, ruhig und allein von der Mitte des Mississippi-Tals zum Golf von Mexiko, auf einer botanischen Exkursion, und während ich in Florida, weit von der Küste entfernt, meine Aufmerksamkeit ganz auf die herrliche tropische Vegetation um mich herum gerichtet hatte, nahm ich plötzlich eine Meeresbrise wahr, die durch die Palmettopalmen und blühenden Weinreben strich, tausend schlummernde Assoziationen weckte und freisetzte und mich in Schottland wieder zu einem Jungen machte, als wären alle dazwischenliegenden Jahre wie ausgelöscht worden.
Die meisten Menschen betrachten gern Gebirgsflüsse und behalten sie im Gedächtnis; aber nur wenige achten auf die Winde, obwohl sie weitaus schöner und erhabener sind und manchmal ungefähr so sichtbar werden wie fließendes Wasser. Wenn die Nordwinde im Winter über die geschwungenen Gipfel der High Sierra aufsteigen, wird dies manchmal durch wehende Schneefahnen von einer Meile Länge deutlich. Diese so verkörperten Teile der Winde können selbst für die schwärzeste Vorstellungskraft kaum völlig unsichtbar sein. Und wenn wir uns in einem unruhigen Wald umsehen, können wir anhand seiner Wirkung auf die Bäume etwas von dem Wind erkennen, der ihn bewegt. Dort herab strömt er in einem Schwall wasserähnlicher Wellen herab und fegt über die sich von Hügel zu Hügel biegenden Kiefern. Aus der Nähe sehen wir losgelöste Federbüsche und Blätter, die mal auf gleichmäßigen Strömungen vorbeirasen, mal in Wirbeln wirbeln oder über die Ränder der Wirbel entweichen, in großen, aufsteigenden Luftkuppeln emporschweben oder auf flammenartigen Kämmen herumwirbeln. Sanfte, tiefe Strömungen, Kaskaden, Wasserfälle und wirbelnde Wirbel singen um jeden Baum und jedes Blatt und über die gesamte abwechslungsreiche Topographie der Region mit deutlichen Formveränderungen, wie Gebirgsflüsse, die sich den Merkmalen ihrer Kanäle anpassen.
Nachdem wir die Flüsse der Sierra von ihren Quellen bis zu den Ebenen verfolgt und markiert haben, wo sie in weißen Wasserfällen aufsteigen, in kristallklaren Federn dahingleiten, grau und schaumig durch mit Felsbrocken übersäte Schluchten strömen und in langen, ruhigen Abschnitten durch die Wälder fließen – nachdem wir so ihre Sprache und Formen im Detail kennengelernt haben, können wir sie schließlich alle zusammen in einer großen Hymne singen hören und sie alle in klarer innerer Sicht begreifen, wie sie die Bergkette wie Spitze bedecken. Aber selbst dieses Schauspiel ist weit weniger erhaben und nicht ein bisschen substanzieller als das, was wir von diesen Sturmströmen der Luft in den Bergwäldern sehen können.
Wir alle reisen gemeinsam durch die Milchstraße, Bäume und Menschen; aber bis zu diesem Sturmtag, als wir im Wind schwangen, kam mir nie in den Sinn, dass Bäume Reisende im gewöhnlichen Sinne sind. Sie machen viele Reisen, allerdings keine langen, aber unsere eigenen kleinen Reisen, hin und zurück, sind kaum mehr als das Winken von Bäumen – viele von ihnen nicht so sehr.
Als der Sturm nachließ, stieg ich ab und schlenderte durch die beruhigenden Wälder. Die Sturmgeräusche verklangen, und als ich mich nach Osten wandte, sah ich die unzähligen Wälder, die still und ruhig auf den Hängen der Berge übereinander ragten wie ein andächtiges Publikum. Die untergehende Sonne erfüllte sie mit bernsteinfarbenem Licht und schien, während sie zuhörten, zu sagen: „Meinen Frieden gebe ich euch.“
Als ich die eindrucksvolle Szene betrachtete, waren alle angeblichen Verwüstungen des Sturms vergessen, und nie zuvor erschienen mir diese edlen Wälder so frisch, so fröhlich, so unsterblich.
KAPITEL XI
DIE FLUSSÜBERSCHWEMMUNGEN
Die Flüsse der Sierra werden jedes Frühjahr durch die Schneeschmelze ebenso regelmäßig über die Ufer gesetzt wie der berühmte alte Nil. Sie beginnen im Mai zu steigen und im Juni wird die Hochwassermarke erreicht. Da das Schmelzen jedoch nicht an allen Quellen, ob hoch oder niedrig, gleichzeitig schnell voranschreitet und der geschmolzene Schnee zu dieser Jahreszeit nicht durch Regen verstärkt wird, sind die Frühjahrsfluten selten sehr heftig oder zerstörerisch. Die tausend Wasserfälle und die Kaskaden in den Canyons stehen jedoch dann in voller Blüte und singen Lieder von einem Ende des Gebirges zum anderen. Natürlich schmilzt zuerst der Schnee an den unteren Nebenflüssen der Flüsse, dann der an den höheren Quellen, die am meisten der Sonne ausgesetzt sind, und etwa einen Monat später schicken die kühleren, schattigen Quellen ihre Schätze hinab, wodurch die Hauptströme fast sechs Wochen Zeit haben, ihr Wasser durch die Vorgebirge und über das Tiefland zum Meer zu leiten. Daher werden sehr heftige Frühjahrsfluten vermieden und werden es auch bleiben, solange die Schatten spendenden, zurückhaltenden Wälder bestehen. Die Flüsse der nördlichen Hälfte der Gebirgskette sind noch weniger plötzlichen Überschwemmungen ausgesetzt, da ihre oberen Quellen größtenteils vor Wetteränderungen unter dicken Lavafalten geschützt liegen, ebenso wie viele Flüsse Alaskas unter Eisfalten liegen und weiter unten in der Gebirgskette in großen Quellen ans Tageslicht kommen, während die Flüsse der hohen Sierra auf der Oberfläche von massivem Granit liegen und jedem Temperaturwechsel ausgesetzt sind. Mehr als neunzig Prozent des Wassers aus Schnee und Eis des Mount Shasta wird sofort absorbiert und unter den porösen Lavafalten des Berges abgeleitet, wo sie, murmelnd und tastend im Dunkeln, schließlich größere Spalten und tunnelartige Höhlen finden, aus denen sie gefiltert und kühl in Form großer Quellen austreten, von denen einige so groß sind, dass sie Flüsse hervorbringen, die ihre Reise unter der Sonne ohne sichtbare Zwischenphase der Kindheit antreten. So entspringt der Shasta River einer großen seeähnlichen Quelle im Shasta Valley, und etwa zwei Drittel des McCloud River strömen plötzlich in einer tosenden, 65 Meter breiten Quelle aus der Wand einer Lavaklippe.
Diese Quellflüsse des Nordens sind natürlich kürzer als die des Südens, deren Nebenflüsse bis zu den Berggipfeln reichen. Der Fall River, ein wichtiger Nebenfluss des Pitt oder Upper Sacramento, ist nur etwa zehn Meilen lang und besteht von seiner Quelle bis zu seiner Mündung in den Pitt nur aus Wasserfällen, Kaskaden und Quellen. An einem Ende entspringen üppige Quellen, bezaubernd eingehüllt in Lauben, aus den Felsen, am anderen donnert ein schneebedeckter Wasserfall von 180 Fuß Höhe, und dazwischen singt und tanzt ein Strom kristallklarer Stromschnellen. Natürlich werden solche Flüsse nur wenig vom Wetter beeinflusst. Geschützt vor Verdunstung ist ihr Wasser im Herbst fast so voll wie zur Zeit der allgemeinen Frühjahrsfluten. Während die Fluten der hohen Sierra auf weniger als den Hundertstel ihres im Frühjahr erreichten Höchstwertes schrumpfen und im Herbst zu einer Reihe stiller Tümpel zwischen den Felsen und den Vertiefungen ihrer Kanäle abflachen, die durch schwache, kriechende Wasserfäden verbunden sind, wie die trägen Sätze eines müden Schriftstellers, verbunden durch einen Nieselregen aus „unds“ und „abers“. Seltsamerweise ereignen sich die größten Überschwemmungen im Winter, wenn man annehmen würde, dass alle wilden Wasser gedämpft und in Frost und Schnee gefesselt wären. Dieselben langen, ganztägigen Stürme der sogenannten Regenzeit in Kalifornien, die den Niederungen Regen bringen, bescheren den Bergen trockenen, frostigen Schnee. Aber in seltenen Abständen dringen warme Regenfälle und warme Winde in die Berge ein und drücken die Schneegrenze von 2000 Fuß auf 8000 oder sogar noch höher zurück, und dann kommen die großen Überschwemmungen.
Normalerweise fuhr ich gegen Ende November aus der High Sierra hinunter, aber der Winter 1874 und 1875 war so warm und ruhig, dass ich im Januar versucht war, mir einen allgemeinen Überblick über die Geologie und Topographie des Feather River-Beckens zu verschaffen. Und ich hatte gerade eine hastige Erkundung der Region abgeschlossen und mich auf den Weg zu meinem Winterquartier gemacht, als einer der gewaltigsten Hochwasserstürme, die ich je erlebt hatte, über den Bergen hereinbrach. Ich befand mich damals am Rand des Hauptwaldgürtels in einer kleinen Vorgebirgsstadt namens Knoxville, an der Wasserscheide zwischen den Flüssen Feather und Yuba. Die Ursache dieser bemerkenswerten Überschwemmung war einfach ein plötzlicher und heftiger Niederschlag von warmem Wind und Regen in den Becken dieser Flüsse zu einer Zeit, als sie eine beträchtliche Menge Schnee enthielten. Der Regen war so stark und hielt so lange an, dass er allein schon ausreichte, um eine ordentliche wilde Überschwemmung zu verursachen, während der Schnee, den der warme Wind und Regen in den oberen und mittleren Regionen der Becken schmolz, ausreichte, um eine weitere Überschwemmung in gleicher Stärke wie der Regen zu verursachen. Diese beiden unterschiedlichen Flutwassermengen wurden gleichzeitig eingefangen und in einer einzigen gewaltigen Lawine über die Ebene ergossen. Die Becken des Yuba und des Feather sind wie viele andere in der Sierra hervorragend an Hochwasser dieser Art angepasst. Ihre vielen Nebenflüsse erstrecken sich weit und breit, umfassen ausgedehnte Gebiete und sind steil geneigt, während die Stämme verhältnismäßig eben sind. Während des Hochwassersturms zeigte das Thermometer in Knoxville zwischen 44 und 50 Grad an. Wenn warmer Wind und warmer Regen gleichzeitig auf den Schnee in solchen Becken fallen, werden sowohl der Regen als auch der Teil des Schnees, der durch Regen und Wind geschmolzen ist, zunächst aufgesaugt und zurückgehalten, bis die vereinte Masse zu Schlamm wird, der sich schließlich plötzlich auflöst, abrutscht und gemeinsam in das Hauptbett fließt. und da der Fluss umso schneller fließt, je tiefer er ist, überholt der überflutete Teil der Strömung oben den langsameren Teil am Fuße des Hügels darunter, und alles strömt zusammen mit einer hohen, sich überwölbenden Front vorwärts und mündet mit einer Gewalt und Plötzlichkeit auf der offenen Ebene, die zunächst völlig unerklärlich erscheint. Die Zerstörungskraft des unteren Teils dieser besonderen Flut wurde etwas verstärkt durch den Kiesabbau in den Flussbetten und durch Dämme, die nachgaben, nachdem sie die sich ansammelnden Wassermassen zunächst zurückgehalten und zurückgehalten hatten. Diese übertriebenen Bedingungen hatten jedoch keinen großen Einfluss auf das Gesamtergebnis, da die Hauptwirkung durch die oben angegebene seltene Kombination von Hochwasserfaktoren verursacht wurde. Es ist schade, dass nur wenige Menschen in ihren Häusern in den Bergen so prächtige Stürme erleben und genießen, denn sie tummeln sich in den offenen Ebenen der Ebenen,Man wird sich wahrscheinlich eher an die Brücken und Häuser erinnern, die sie mit sich tragen, als an ihre Schönheit oder die tausend Segnungen, die sie den Feldern und Gärten der Natur bringen.
Am Morgen der Flut, dem 19. Januar, waren alle Landschaften von Feather und Yuba mit fließendem Wasser bedeckt, schlammige Sturzbäche füllten jede Schlucht und jeden Graben, und der Himmel war dicht vom Regen. Die Kiefern hatten lange im Sonnenschein geschlafen; jetzt waren sie wach, brüllten und wehten im peitschenden Sturm, und die Winde, die über die Kurven von Hügel und Tal fegten, durch die Wälder strömten, auf den Gipfeln der Felsrücken wogten und gurgelten, erzeugten die wildeste Sturmmelodie.
Es war leicht zu erkennen, dass nur ein kleiner Teil des Regens in Form von Tropfen den Boden erreichte. Der Großteil wurde zu staubigem Sprühnebel aufgeschlagen, wie er kleine Wasserfälle aufspalten, wenn sie auf steile Felsen treffen. Noch nie habe ich Wasser in dichteren oder heftigeren Strömen vom Himmel kommen sehen. Der Wind jagte den Sprühnebel in erstickenden Wehen vorwärts und zwang mich immer wieder, in den Wäldchen und hinter großen Bäumen Schutz zu suchen, um auszuruhen und zu Atem zu kommen. Wo immer ich auch hinging, auf Bergrücken oder in Senken, spritzte und gurgelte das Wasser immer noch enthusiastisch um meine Knöchel und erinnerte an eine wilde Winterflut im Yosemite-Nationalpark, als hundert Wasserfälle gemeinsam dröhnend und singend herabkamen und das große Tal mit einem meeresähnlichen Tosen erfüllten.
Nachdem ich ein oder zwei Stunden durch die unteren Wälder getrieben war, machte ich mich auf den Weg zum Gipfel eines 900 Fuß hohen Hügels, um so nahe wie möglich an das Herz des Sturms zu gelangen. Um ihn zu erreichen, musste ich den Dry Creek überqueren, einen Nebenfluss des Yuba, der sich im Nordwesten am Fuß des Hügels entlangschlängelt. Er war jetzt ein reißender Fluss, so groß wie der Tuolumne bei normalem Wasserstand, seine Strömung braun vom Bergbauschlamm, der von vielen „Claims“ heruntergespült worden war, und gesprenkelt mit Schleusenkästen, Zaunlatten und Baumstämmen, die lange außerhalb seiner Reichweite gelegen hatten. Eine schmale Fußgängerbrücke spannte sich über ihn, jetzt kaum über der angeschwollenen Strömung. Hier war ich froh, verweilen zu können, zu starren und zu lauschen, während der Sturm in seiner üppigsten Stimmung war – die graue Regenflut oben, die braune Flussflut unten. Die Sprache des Flusses war kaum weniger bezaubernd als die von Wind und Regen; das erhabene Dröhnen der auf und ab gehenden, jubelnden Hauptströmung, das Rauschen und Gurgeln der Wirbel, das scharfe Aufprallen und Krachen schwerer Wellen, die sich gegen Felsen brechen, und das sanfte, flaumige Rauschen flacher Strömungen, die sich ihren Weg durch das Weidendickicht am Ufer bahnen. Und inmitten all dieser vielfältigen Geräuschkulisse hörte ich das gedämpfte Stoßen und Rumpeln von Felsbrocken auf dem Grund, die in wilder Eile gegeneinander geschoben und vorwärtsgerollt wurden, nachdem sie wahrscheinlich 100 Jahre oder länger still gelegen hatten.
Der ruhige Bach erhob sich hoch über seine Ufer und schlängelte sich von seinem Bett aus über viele dornige Sandbänke und Wiesen. Hüfttiefe Erlen und Weiden stemmten sich mit nervösen, zitternden Bewegungen gegen die Strömung, als hätten sie Angst, mitgerissen zu werden, während biegsame Äste sich vertrauensvoll bogen, leicht eintauchten und wieder aufstiegen, als würden sie spielend das wilde Wasser streicheln. Als wir die Brücke verließen und durch die sturmgepeitschten Wälder weiterfuhren, schien sich der ganze Boden zu bewegen. Kiefernquasten, Rindenflocken, Erde, Blätter und abgebrochene Äste wurden nach vorn geschwemmt, und viele Felsbrocken, die von freiliegenden Felsvorsprüngen abgewetzt worden waren, wurden nun in den wilden Strömen des Sturms zum ersten Mal abgerundet und poliert. Sie rasten durch jede Schlucht und Senke, sprangen, glitten, arbeiteten mit Willenskraft und freuten sich wie lebende Geschöpfe.
Und die Flut war nicht auf den Boden beschränkt. Jeder Baum hatte sein eigenes Wassersystem, das sich weit und breit ausbreitete wie Miniatur-Amazonas- und Mississippi-Bäche.
Gegen Mittag erreichten Wolken, Wind und Regen ihre höchste Entwicklung. Der Sturm war in voller Blüte und bot von meinem herrlichen Aussichtspunkt auf der Bergspitze aus einen der herrlichsten Anblicke, die ich je gesehen habe. So weit das Auge reichte, oben, unten, rundherum, erfüllte windgetriebener Regen die Luft wie ein gewaltiger Wasserfall. Abgelöste Wolken zogen imposant das Tal hinauf, als wären sie mit unabhängiger Bewegung ausgestattet und hätten die besondere Aufgabe, die Bergquellen wieder aufzufüllen. Mal erhoben sie sich über die Kiefernwipfel, mal sanken sie in ihre Mitte herab, streichelten ihre pfeilförmigen Spitzen und beruhigten jeden Zweig und jedes Blatt mit Sanftheit inmitten all des wilden Lärms und der wilden Bewegung. Andere, die sich in Bodennähe hielten, glitten hinter einzelne Haine und ließen sie mit bewundernswerter Deutlichkeit hervortreten; oder sie zogen vor ihnen vorbei und verdeckten nacheinander ganze Haine, wobei eine Kiefer nach der anderen in ihren grauen Rändern schmolz und wieder hervorbrach, scheinbar klarer als zuvor.
Die Formen von Stürmen werden größtenteils durch die Topographie der Regionen gemessen und bestimmt, in denen sie entstehen und über die sie ziehen. Wenn wir daher versuchen, sie von den Tälern oder von Lücken und Lichtungen des Waldes aus zu studieren, werden wir durch eine Vielzahl einzelner und scheinbar gegensätzlicher Eindrücke verwirrt. Die Unterseite des Sturms wird in unzählige Wellen und Strömungen zerlegt, die gegen die Berghänge branden wie Meereswellen gegen eine Küste, und diese wirken auf die untere Oberfläche des Sturms, erodieren riesige Höhlen und Schluchten und reißen den entstehenden Schutt in langen Zügen mit sich, wie die Moränen von Gletschern. Aber wenn wir aufsteigen, verschwinden diese partiellen, verwirrenden Effekte und die Phänomene werden einheitlich und harmonisch wahrgenommen.
Je länger ich in den Sturm hineinschaute, desto deutlicher wurde er sichtbar. Die treibenden Wolkentrümmer gaben ihm eine Art sichtbaren Körper, der viele verwirrende Phänomene erklärte und seine Bewegungen in klaren Worten offenbarte, während die Beschaffenheit der fallenden Regenmasse ihn abrundete und vervollständigte. Da Regentropfen unterschiedlich groß sind, fallen sie mit unterschiedlicher Geschwindigkeit und überholen und prallen aufeinander, wodurch Nebel und Gischt entsteht. Sie reagieren natürlich auch unterschiedlich auf die Kraft des Windes, was zu einem noch größeren Maß an Interferenz führt, und heftige Böen fegen Gischtwolken aus den Wäldern, wie sie bei einem Sturm von den Wellenkämmen gerissen werden. All diese Faktoren der Unregelmäßigkeit in Dichte, Farbe und Beschaffenheit der allgemeinen Regenmasse tragen dazu bei, sie noch deutlicher und aussagekräftiger zu machen. Man sieht es dann als eine gewaltige Flut, die über Ufer und Abhänge rauscht, die Kiefern wie Unkraut biegt, sich hierhin und dorthin windet und in riesigen Wirbeln in Mulden und Tälern wirbelt, während die Hauptströmung majestätisch über alles hinwegströmt, wie Meeresströmungen über die Landschaften, die verborgen auf dem Meeresgrund liegen.
Ich beobachtete die Gesten der Kiefern, während der Sturm auf seinem Höhepunkt war, und es war leicht zu erkennen, dass sie nicht beunruhigt waren. Mehrere große Zuckerkiefern standen in der Nähe des Dickichts, in dem ich Schutz fand, verneigten sich feierlich und warfen ihre langen Arme, als würden sie die Worte des Sturms interpretieren, während sie seine wildesten Angriffe mit leidenschaftlicher Erheiterung hinnahmen. Die Löwen fraßen. Wer Sonnenblumen während der goldenen Tage des Altweibersommers beim Sonnenbaden beobachtet hat, weiß, dass keine ihrer Gesten Dankbarkeit ausdrückt. Ihre himmlische Nahrung wird zu herzlich gegeben, zu herzlich genommen, um Raum für Dankbarkeit zu lassen. Die Kiefern nahmen die Wohltaten des Sturms offensichtlich mit derselben aufrichtigen Seele an; und als ich zwischen die knospenden Haselnusssträucher und noch tiefer zu den jungen Veilchen und Farnbüscheln auf den Felsen blickte, bemerkte ich dieselben göttlichen Methoden des Gebens und Nehmens und dieselben exquisiten Anpassungen dessen, was wie ein Ausbruch gewalttätiger und unkontrollierbarer Kraft erscheint, an die Zwecke eines schönen und zarten Lebens. Ruhe wie Schlaf überkommt die Landschaft, genau wie Menschen und Bäume, und Stürme wecken sie auf die gleiche Weise. Im trockenen Hochsommer des unteren Teils der Bergkette scheinen die verdorrten Hügel und Täler so leer und ausdruckslos zu liegen wie tote Muscheln am Strand. Sogar die höchsten Berge können manchmal langweilig und ausdruckslos erscheinen, als hätten sie auf irgendeine Weise ihre Gestalt verloren und wären auf weniger als die Hälfte ihrer tatsächlichen Größe geschrumpft. Aber wenn die Blitze in den Schluchten einschlagen und widerhallen und die Wolken herabsteigen und ihre kahlen, schneeweißen Köpfe krönen und krönen, strahlt jedes Merkmal vor Ausdruck und sie erheben sich wieder in all ihrer imposanten Majestät.
Stürme sind gute Redner und sagen alles, was sie wissen, aber ihre Stimmen aus Blitzen, Sturzbächen und stürmischem Wind sind viel seltener als die namenlosen, leisen, kleinen Stimmen, die für menschliche Ohren zu leise sind; und weil wir schlechte Zuhörer sind, können wir nicht viel von dem mitbekommen, was in Reichweite ist. Unsere besten Regengeräusche hört man meist auf Dächern und Winde in Schornsteinen; und wenn wir aus freien Stücken oder aus Zwang ins Herz eines Sturms gestoßen werden, hindert uns die Verwirrung durch die schwerfällige Ausrüstung, die nervöse Eile und die gemeine Angst daran, etwas anderes als die lautesten Äußerungen zu hören. Dennoch können wir Freude an Sturmgeräuschen finden, die wir nicht hören können, und an Sturmbewegungen, die wir nicht sehen können. Das erhabene Wirbeln der Planeten um ihre Sonnen ist so leise wie Regentropfen, die im Dunkeln zwischen den Wurzeln der Pflanzen sickern. In diesem großen Sturm, wie in jedem anderen, gab es Töne und Gesten, die inmitten dessen, was man Gewalt und Wut nennt, unbeschreiblich sanft waren, aber von allen, die nach ihnen Ausschau halten und lauschen, leicht erkannt wurden. Der Regen brachte die Farben des Waldes mit herrlicher Frische zum Vorschein, das satte Braun der Baumrinde und der abgefallenen Kletten und Blätter und toten Farne; das Grau der Steine und Flechten; das helle Purpur der anschwellenden Knospen und das warme Gelbgrün der Libellen und Moose. Die Luft war erfüllt von einem herrlichen Duft, der nicht in einzelnen Massen aufstieg und vorbeiwehte, sondern sich in der ganzen Atmosphäre verteilte. Kiefernwälder duften immer, aber am meisten im Frühling, wenn sich die jungen Quasten öffnen, und bei warmem Wetter, wenn die verschiedenen Gummi- und Balsamarten von der Sonne aufgeweicht werden. Der Wind rieb jetzt ihre unzähligen Nadeln und der warme Regen durchweichte sie. Monardella wächst hier in großen Beeten in den Lichtungen, und es gibt reichlich Lorbeer in Tälern und Manzanita an den Berghängen, und die rosige, duftende Chamoebatia bedeckt den Boden fast überall. Diese bilden zusammen mit den Harzen und Balsamen der Wälder die wichtigsten lokalen Duftquellen des Sturms. Die aufsteigenden, vom Wind gerollten und vom Regen gewaschenen Aromawolken wurden rein wie Licht und reisten als Teil des Windes mit ihm. Gegen Mitte des Nachmittags hob sich die Hauptflutwolke entlang ihrer westlichen Grenze und enthüllte einen wunderschönen Abschnitt des Sacramento Valley, der etwa zwanzig oder dreißig Meilen entfernt war, hell vom Sonnenlicht beschienen und von Regengüssen glitzernd, als ob er mit Silber gepflastert wäre. Bald darauf erschien eine zerklüftete, felsenartige Wolke mit einer steilen Oberfläche über dem Tal des Yuba, dunkel gefärbt und mit zahlreichen Furchen wie ein riesiger Lavatisch aufgeraut. Die blaue Küstenkette war zu sehen, die sich wie eine abgeschrägte Wand am Himmel erstreckte, und die düsteren, zerklüfteten Marysville Buttes erhoben sich eindrucksvoll aus der überfluteten Ebene wie Inseln aus dem Meer. Dann ließ der Regen nach und ich schlenderte durch die tropfenden Büsche und genoss die universelle Kraft und Frische, die alles Leben um mich herum beseelte.Wie sauber und unberührt und unsterblich schienen die Wälder zu sein! – die hohen Zedern in voller Blüte, beladen mit goldenem Blütenstaub und ihren glänzenden, gewaschenen Federbüschen; die Kiefern, die sich sanft wiegten und wieder zur Ruhe kamen, und die abendlichen Sonnenstrahlen, die auf die breiten Blätter der Madroños fielen, deren gelbe Zweige sich von den dunklen Dickichten der Kastanien abhoben; Lebermoose, Bärlappgewächse und Farne jubelten in herrlicher Wiedergeburt, und jedes Moos, das je gelebt hatte, schien von den Toten zurückzukehren, um jeden Stamm und jeden Stein in lebendiges Grün zu kleiden. Der dampfende Boden schien vor Leben zu pulsieren und zu kribbeln; Stechwinden, Schachbrettblumen, Steinbrech und junge Veilchen schossen empor, als wüssten sie bereits die Pracht des Sommers, und unzählige grüne und gelbe Knospen lugten und lächelten überall.
Von den Vögeln und Eichhörnchen war während des Sturms weder ein Flügel noch ein Schwanz zu sehen. Eichhörnchen mögen nasses Wetter noch weniger als Katzen, deshalb blieben sie zu Hause und schaukelten in ihren trockenen Nestern. Die Vögel versteckten sich in den Tälern, um vor dem Wind geschützt zu sein. Einige der stärksten pickten nach Eicheln und Manzanita-Beeren, aber die meisten saßen auf niedrigen Zweigen, ihre Brustfedern waren aufgeplustert, und leisteten sich gegenseitig so gut sie konnten Gesellschaft, um die harte Zeit zu überstehen.
Als ich gegen Sonnenuntergang im Dorf ankam, regten sich die guten Leute und bemitleideten mich wegen meines zerzausten Zustands, als wäre ich ein betäubter Schiffbrüchiger, den man aus dem Meer geschnappt hatte. Ich wiederum, heiß vor Aufregung und stinkend wie die Erde, bemitleidete sie, weil sie ausgetrocknet waren und um all die Pracht gebracht worden waren, mit der die Natur sie an diesem Tag umgeben hatte.
KAPITEL XII
SIERRA-GEWITTER
Das Wetter im Frühling und Sommer in der mittleren Region der Sierra ist normalerweise von Regen und leichter Schneeschicht durchzogen, die meisten davon sind viel zu offensichtlich fröhlich und lebensspendend, um als Stürme angesehen zu werden; und in der malerischen Schönheit und Klarheit der Umrisse ihrer Wolken bieten sie einen bemerkenswerten Kontrast zu den grenzenlosen, alles umfassenden Wolkenmänteln der Winterstürme. Die kleinsten und am besten individualisierten Exemplare zeigen eine reich modellierte Kumuluswolke, die sich gegen 11 Uhr morgens über den dunklen Wäldern erhebt und mit sichtbarer Bewegung geradewegs in den ruhigen, sonnigen Himmel auf eine Höhe von 12.000 bis 14.000 Fuß über dem Meer aufbläht, ihre weißen, perlmuttartigen Wölbungen werden durch graue und blassviolette Schatten in den Vertiefungen hervorgehoben und zeigen Umrisse, die so scharf definiert sind wie die der von Gletschern polierten Kuppeln. In weniger als einer Stunde ist er voll entwickelt und steht im gleißenden Sonnenschein wie ein riesiger Berg, so schön in Form und Vollendung, als ob er eine dauerhafte Ergänzung der Landschaft werden sollte. Kurz darauf kracht ein Blitz durch die frische Luft, klirrt wie Stahl auf Stahl, scharf und klar, seine überraschende Detonation löst sich in einem Regenschauer an den Klippen und Canyonwänden auf. Dann bricht ein Regenschauer herab. Die großen Tropfen sickern durch die Kiefernnadeln, plätschern und prasseln auf den Granitpflastern und strömen in einem Netzwerk grauer, sprudelnder Rinnen die Seiten der Bergrücken und Kuppeln hinab. In wenigen Minuten verwelkt die Wolke zu einem Geflecht dunkler Fäden und verschwindet, so dass der Himmel vollkommen klar und hell bleibt, jedes Staubkorn ist weggewischt und ausgewaschen. Alles ist erfrischt und belebt, ein Duftdampf steigt auf und der Sturm ist vorbei – eine Wolke, ein Blitzschlag und ein Regenguss. Das ist das Gewitter mitten im Sommer in der Sierra in seiner niedrigsten Form. Einige von ihnen nehmen jedoch viel größere Ausmaße an und nehmen eine Erhabenheit und Ausdruckskraft an, die kaum von denen im tiefsten Winter übertroffen wird, wenn sie diese plötzlichen Überschwemmungen hervorrufen, die „Wolkenbrüche“ genannt werden und lokal und zu einem beträchtlichen Teil periodisch sind, da sie wochenlang fast jeden Tag ungefähr zur gleichen Zeit auftreten, normalerweise gegen elf Uhr, und fünf Minuten bis ein oder zwei Stunden andauern. Man gewöhnt sich bald so sehr an ihren Anblick, dass der Mittagshimmel ohne sie leer und verlassen erscheint, als ob die Natur etwas vergessen hätte. Wenn sich die herrlichen Perlen- und Alabasterwolken dieser Mittagsstürme bilden, schenke ich nie etwas anderem meine Aufmerksamkeit. Kein Berg oder Gebirgszug, wie göttlich er auch in Licht gehüllt sein mag, besitzt einen bleibenderen Zauber als diese flüchtigen Berge des Himmels – schwimmende Fontänen, die Wasser für jeden Brunnen bringen, die Engel der Ströme und Seen; brütend im tiefen Azur, oder sanft über den Boden gleitend über Bergrücken und Kuppen, über Wiesen, über Wälder,über Garten und Hain; verweilt mit kühlen Schatten, erfrischt jede Blume und beruhigt schroffe Felskuppen mit einer Sanftheit der Berührung und Geste, die ganz und gar göttlich ist.

Die schönsten und imposantesten Sommerstürme erheben sich knapp über der oberen Grenze der Weißtannenzone, und alle sind so schön, dass es nicht leicht ist, einen für eine besondere Beschreibung auszuwählen. Derjenige, an den ich mich am besten erinnere, fiel am 19. Juli 1869 auf die Berge in der Nähe des Yosemite Valley, als ich in den Weißtannenwäldern kampierte. Eine Reihe von steilen Cumuli eroberte den Himmel, riesige Kuppeln und Gipfel, die sich übereinander erhoben, mit tiefen Schluchten dazwischen, die sich in langen Kurven und Ausläufern hierhin und dorthin bogen, hier und da unterbrochen von weißen, aufsteigenden Massen, die wie die Gischt von Wasserfällen aussahen. Zickzackförmige Blitze folgten einander in schneller Folge, und der Donner war so herrlich laut und gewaltig, dass es schien, als würde mit jedem Schlag ein ganzer Berg zerschmettert. Soweit ich sehen konnte, waren jedoch nur die Bäume betroffen – einige Tannen, vielleicht 200 Fuß hoch und fünf bis sechs Fuß im Durchmesser, waren von oben bis unten in lange Streifen und Splitter gespalten und in alle Himmelsrichtungen verstreut. Dann kam der Regen in einer kräftigen Flut, bedeckte den Boden und ließ ihn mit einer durchgehenden Wasserschicht glänzen, die sich wie ein transparenter Film oder eine Haut eng über die gesamte zerklüftete Anatomie der Landschaft legte.
Geologisch gesehen ist es noch nicht lange her, dass der erste Regentropfen auf die heutige Landschaft der Sierra fiel, und wie schön ist sie in den wenigen Zehntausend Jahren stürmischer Bewirtschaftung geworden, die ihr zuteilwurde! Der erste Regen fiel auf rohe, bröckelnde Moränen und pflanzenlose Felsen. Jetzt findet kaum ein Tropfen ohne schöne Spur: auf den Gipfeln, auf den glatten Gletscherpflastern, auf den Rundungen der Kuppeln, auf Moränen voller Kristalle, auf den tausend Formen yosemitischer Skulpturen mit ihrer zarten Schönheit aus balsamischer, blühender Vegetation, die sprudelt, plätschert, glitzert und prasselt. Manche fallen sanft auf Wiesen, kriechen aus dem Blickfeld, suchen und finden jede durstige Wurzel, manche durch die Spitzen der Wälder, sieben Staub durch die Nadeln und flüstern jedem von ihnen gute Laune zu; manche fallen mit dumpfen, klopfenden Geräuschen, trommeln auf die breiten Blätter von Veratrum, Cypripedium und Steinbrech. einige fallen geradewegs in duftende Blütenkronen, küssen die Lippen der Lilien, glitzern an den Seiten der Kristalle, auf glänzenden Goldkörnern; einige fallen in die Schneebrunnen, um deren wohlgehütete Vorräte anzuschwellen; einige in die Seen und Flüsse, klopfen auf die glatten, glasigen Ebenen, bilden Grübchen und Glöckchen und Gischt, waschen die Bergfenster, waschen die wandernden Winde; einige plätschern ins Herz der schneebedeckten Wasserfälle und Kaskaden, als wollten sie sich begierig dem Tanz und dem Gesang anschließen und den Schaum noch feiner schlagen. Gute Arbeit und glückliche Arbeit für die fröhlichen Bergregentropfen, jeder einzelne von ihnen ein tapferer Fall für sich, der von den Klippen und Tälern der Wolken in die Klippen und Täler der Berge stürzt; fort vom Donner des Himmels in das Donnern der tosenden Flüsse. Und wie weit müssen sie gehen und wie viele Becher müssen gefüllt werden – Kassiope-Becher, die einen halben Tropfen fassen, und Seebecken zwischen den Hügeln, die alle mit der gleichen Sorgfalt aufgefüllt werden – jeden Tropfen schickte Gottes Bote mit prachtvollem Pomp und Machtdemonstration auf die Reise – silberne neugeborene Sterne mit See und Fluss, Berg und Tal – alles, was die Landschaft bereithält – gespiegelt in ihren kristallenen Tiefen.
Kapitel XIII
Die Wasseramsel
Die Wasserfälle der Sierra werden nur von einem einzigen Vogel besucht: der Amsel oder Wasserdrossel ( Cinclus Mexicanus , SW.). Sie ist ein außergewöhnlich fröhlicher und liebenswerter kleiner Kerl, etwa so groß wie ein Rotkehlchen, gekleidet in einen einfachen wasserdichten Anzug in bläulichem Grau mit einem Hauch von Schokolade auf Kopf und Schultern. Von seiner Gestalt her ist sie etwa so glatt, rundlich und kompakt wie ein Kieselstein, der in ein Schlagloch gewirbelt wurde, wobei die fließende Kontur ihres Körpers nur durch ihre starken Füße und den Schnabel, die knackigen Flügelspitzen und den nach oben geneigten, zaunkönigartigen Schwanz unterbrochen wird. Unter all den zahllosen Wasserfällen, die ich im Laufe meiner zehnjährigen Erkundung der Sierra gesehen habe, ob auf den eisigen Gipfeln, in den warmen Vorgebirgen oder in den tiefen yosemitischen Canyons der mittleren Region, wurde keiner ohne seine Amsel gefunden. Kein Canyon ist zu kalt für diesen kleinen Vogel, keiner zu einsam, vorausgesetzt, er ist reich an fallendem Wasser. Suchen Sie irgendwo an einem klaren Fluss nach einem Wasserfall, einer Kaskade oder einem reißenden Strom, und Sie werden dort sicherlich die dazugehörige Drossel finden, die in der Gischt umherflattert, in schäumende Wirbel eintaucht und wie ein Blatt zwischen geschlagenen Schaumkronen herumwirbelt; immer kräftig und enthusiastisch, aber dennoch in sich gekehrt und Ihre Gesellschaft weder suchend noch meidend.

Wird er beim Herumtauchen im seichten Randwasser gestört, macht er sich entweder mit einem schnellen Surren auf den Weg zu einem anderen Futterplatz flussauf- oder -abwärts oder lässt sich auf einem halb unter Wasser liegenden Felsen oder Baumstumpf in der Strömung nieder und beginnt sofort, wie ein Zaunkönig zu nicken und zu hüpfen, wobei er seinen Kopf von einer Seite auf die andere dreht und viele andere seltsame, zierliche Bewegungen ausführt, die stets die Aufmerksamkeit des Beobachters fesseln.
Er ist der Liebling der Gebirgsbäche, der Kolibri der blühenden Gewässer, der felsige, wellige Hänge und Schaumkronen liebt, wie eine Biene Blumen liebt, wie eine Lerche Sonnenschein und Wiesen liebt. Unter allen Bergvögeln hat mich keiner auf meinen einsamen Wanderungen so sehr aufgeheitert – keiner so unfehlbar. Denn sowohl im Winter als auch im Sommer singt er süß, fröhlich, unabhängig von Sonnenschein und Liebe, und braucht keine andere Inspiration als den Bach, an dem er lebt. So wie das Wasser singt, muss er es auch tun, bei Hitze oder Kälte, bei Windstille oder Sturm, und seine Stimme immer in sicherer Harmonie stimmen; leise in der Dürre des Sommers und der Dürre des Winters, aber nie still.
Während der goldenen Tage des Altweibersommers, wenn der meiste Schnee geschmolzen ist und die Gebirgsbäche schwach geworden sind – eine Abfolge stiller Tümpel, die durch seichte, durchsichtige Strömungen und Streifen silbriger Spitzen miteinander verbunden sind –, ist der Gesang der Amsel am leisesten. Doch sobald die Winterwolken aufgeblüht sind und die Bergschätze wieder mit Schnee gefüllt sind, nehmen die Stimmen der Bäche und Amsel an Kraft und Fülle zu, bis zur Hochwasserzeit im Frühsommer. Dann singen die Sturzbäche ihre edelsten Hymnen, und dann ist die Hochwasserzeit der Melodie unseres Sängers. Was das Wetter betrifft, sind dunkle Tage und Sonnentage für ihn dasselbe. Die Stimmen der meisten Singvögel, so fröhlich sie auch sein mögen, leiden unter einer langen Winterfinsternis; doch die Amsel singt durch alle Jahreszeiten und jede Art von Sturm hindurch. Tatsächlich kann kein Sturm heftiger sein als die der Wasserfälle, in deren Mitte er sich so gern aufhält. Egal wie dunkel und stürmisch das Wetter ist, ob es schneit, stürmt oder bewölkt ist, er singt trotzdem und nie mit einem Anflug von Traurigkeit. Er braucht keinen Frühlingssonnenschein, um sein Lied aufzutauen, denn es friert nie. Niemals werden Sie etwas Winterliches aus seiner warmen Brust hören ; kein gepresstes Piepsen, keine schwankenden Töne zwischen Kummer und Freude; seine sanfte, flötenartige Stimme ist immer auf pure Freude eingestellt, so frei von Niedergeschlagenheit wie Hahnenschrei.
Es ist erbärmlich, an kalten Morgen kleine, vom Frost gequetschte Spatzen in den Bergwäldern zu sehen, die den Schnee aus ihren Federn schütteln und herumhüpfen, als wollten sie fröhlich sein, um dann schnell wieder in ihre Verstecke zu eilen, wo sie sich vor dem Wind schützen, ihre Brustfedern über den Zehen aufplustern und sich kalt und ohne Frühstück zwischen den Blättern niederlassen, während der Schnee weiter fällt und kein Anzeichen von Aufhellung in Sicht ist. Aber die Drossel ruft niemals auch nur einen Hauch von Mitleid hervor; nicht, weil sie stark genug ist, um durchzuhalten, sondern vielmehr, weil sie ein verzaubertes Leben zu führen scheint, das außerhalb der Reichweite aller Einflüsse liegt, die Ausdauer erforderlich machen.
An einem wilden Wintermorgen, als das Yosemite Valley von einem heftigen Schneesturm von Westen nach Osten überrollt wurde, machte ich mich auf den Weg, um zu sehen, was ich lernen und genießen könnte. Eine Art graue, dämmerungsähnliche Dunkelheit erfüllte das Tal, die riesigen Wände waren außer Sicht, alle gewöhnlichen Geräusche wurden erstickt und selbst das lauteste Dröhnen der Wasserfälle ging zeitweise im Tosen des schweren Sturms unter. Der lose Schnee lag bereits über fünf Fuß hoch auf den Wiesen, was ausgedehnte Spaziergänge ohne die Hilfe von Schneeschuhen unmöglich machte. Ich hatte jedoch keine großen Schwierigkeiten, zu einer bestimmten Kräuselung des Flusses zu gelangen, wo eine meiner Amseln lebte. Sie war zu Hause und sammelte eifrig ihr Frühstück zwischen den Kieselsteinen eines seichten Teils des Ufers, anscheinend ohne etwas Außergewöhnliches am Wetter zu bemerken. Bald flog sie zu einem Stein, gegen den die eisige Strömung schlug, und drehte dem Wind den Rücken zu, während sie so entzückend sang wie eine Lerche im Frühling.
Nachdem ich ein oder zwei Stunden mit meinem Liebling verbracht hatte, machte ich mich auf den Weg durch das Tal, bohrte und wälzte mich durch die Schneewehen, um so genau wie möglich herauszufinden, wie die anderen Vögel ihre Zeit verbrachten. Die Yosemite-Vögel sind im Winter leicht zu finden, da sie alle, mit Ausnahme der Amsel, auf die sonnige Nordseite des Tals beschränkt sind, während die Südseite ständig vom großen frostigen Schatten der Wand verdeckt wird. Und weil die Wälder des Indian Canyon aufgrund ihrer besonderen Lage am wärmsten sind, versammeln sich die Vögel dort, insbesondere bei rauem Wetter.
Ich fand die meisten Rotkehlchen auf der windgeschützten Seite der größeren Äste kauernd, wo der Schnee nicht auf sie fallen konnte, während zwei oder drei der Unternehmungslustigeren verzweifelte Versuche unternahmen, die Mistelbeeren zu erreichen, indem sie sich nervös an der Unterseite der schneebedeckten Massen festklammerten, mit dem Rücken nach unten, wie Spechte. Ab und zu lösten sie einige der losen Fransen der Schneekrone, die auf sie herabfielen und sie schreiend ins Lager zurückschickten, wo sie sich zitternd unter ihren Gefährten niederließen und leise, quengelig wie hungrige Kinder murmelten.
Einige Spatzen waren am Fuße der größeren Bäume damit beschäftigt, Samen und betäubte Insekten aufzulesen, ab und zu gesellte sich ein Rotkehlchen zu ihnen, das seiner erfolglosen Versuche, die schneebedeckten Beeren zu erbeuten, überdrüssig war. Die mutigen Spechte klammerten sich an die schneefreien Seiten der größeren Baumstämme und die überhängenden Äste der Lagerbäume, machten kurze Nächte von einer Seite des Hains zur anderen, pickten ab und zu nach den Eicheln, die sie in der Rinde gelagert hatten und schnatterten ziellos, als könnten sie nicht still sitzen, doch vertrieben sie sich offensichtlich die Zeit auf sehr langweilige Weise, wie sturmgeplagte Reisende in einem Landgasthof. Die abgehärteten Kleiber fädelten in ihrer üblichen fleißigen Art durch die offenen Furchen der Stämme und stießen ihre eigenartigen Laute aus, offensichtlich weniger beunruhigt als ihre Nachbarn. Die Blauhäher machten natürlich mehr Lärm als alle anderen Vögel zusammen; Sie kamen und gingen immer mit lautem Getöse, kreischten, als hätte jeder einen Klumpen schmelzenden Schlamms im Hals, und achteten gut darauf, die günstige Gelegenheit, die der Sturm bot, zu nutzen, um die Eichelvorräte der Spechte zu stehlen. Ich bemerkte auch einen einsamen grauen Adler, der dem Sturm auf der Spitze eines hohen Kiefernstumpfs gleich außerhalb des Haupthains trotzte. Er stand kerzengerade mit dem Rücken zum Wind, ein Schneebüschel auf seinen breiten Schultern, ein Denkmal passiver Ausdauer. So schien jeder im Schnee eingeschlossene Vogel mehr oder weniger unbehaglich, wenn nicht sogar in wahrer Not.
Der Sturm spiegelte sich in jeder Geste wider, und kein einziger Schnabel war von einem einzigen fröhlichen Ton, geschweige denn von einem Lied, erfüllt; ihr kauerndes, freudloses Ausharren bildete einen auffallenden Kontrast zu der spontanen, unbändigen Fröhlichkeit der Amsel, die ebenso wenig anders konnte, als ein süßes Lied auszustoßen wie einen süßen Rosenduft. Sie muss singen, auch wenn der Himmel einstürzt. Ich erinnere mich, wie ich während des heftigen Erdbebens im Jahr 1872 die Not eines Rotkehlchenpaares bemerkte, als die Kiefern des Tals mit seltsamen Bewegungen ihre Zweige hin und her bewegten und steile Felsvorsprünge in gewaltigen Lawinen auf die Wiesen herabdonnerten. Inmitten der Aufregung anderer Beobachtungen kam mir nicht in den Sinn, nach den Amseln Ausschau zu halten, aber ich zweifle nicht daran, dass sie die ganze Zeit hindurch sangen und das schreckliche Donnern der Felsen ebenso furchtlos betrachteten wie das Tosen der Wasserfälle.
Was man als die einzelnen Gesänge der Drossel bezeichnen kann, ist äußerst schwierig zu beschreiben, weil sie so unterschiedlich und gleichzeitig so ineinander übergehend sind. Obwohl ich meinen Liebling seit zehn Jahren kenne und ihn während der meisten Zeit fast jeden Tag singen hörte, erkenne ich immer noch Töne und Melodien, die mir neu erscheinen. Fast seine gesamte Musik ist süß und zart, sie rinnt von seiner runden Brust wie Wasser über den glatten Rand eines Teichs und bricht dann weiter in einen funkelnden Schaum melodischer Töne aus, die vor gedämpfter Begeisterung glühen, jedoch nicht viel von der starken, überschwänglichen Ekstase des Reisstärlings oder der Feldlerche zum Ausdruck bringen.
Die markantesten Melodien sind perfekte Melodiearabesken, die aus wenigen vollen, runden, weichen Tönen bestehen, die mit zarten Trillern bestickt sind, die in langen, schlanken Kadenzen verklingen und verschmelzen. Im Großen und Ganzen ist seine Musik die der verfeinerten und vergeistigten Ströme. Sie enthält die tiefen, dröhnenden Töne der Wasserfälle, das Trillern der Stromschnellen, das Gurgeln der Uferwirbel, das leise Flüstern der ebenen Wasserflächen und das süße Plätschern einzelner Tropfen, die aus den Enden der Moose sickern und in ruhige Teiche fallen.
Die Drossel singt nie im Chor mit anderen Vögeln oder ihrer Artgenossen, sondern nur mit den Flüssen. Und wie Blumen, die unter der Erdoberfläche blühen, erheben sich einige der schönsten Singblüten unserer Lieblinge nie über die Oberfläche der schwereren Musik des Wassers. Ich habe sie oft inmitten von Gischt singen sehen, wobei ihre Musik vollständig im Tosen des Wassers versank; doch an seinen Gesten und den Bewegungen seines Schnabels wusste ich, dass sie mit Sicherheit sang.
Seine Nahrung besteht, soweit ich es bemerkt habe, aus allen Arten von Wasserinsekten, die er im Sommer hauptsächlich an seichten Ufern findet. Hier watet er umher, taucht seinen Kopf unter Wasser und dreht geschickt Kieselsteine und Blätter mit seinem Schnabel um. Er begibt sich nur selten in tiefes Wasser, wo er seine Flügel zum Tauchen benutzen muss.
Er scheint besonders die Larven der Moskitos zu mögen, die in großer Zahl am Boden glatter Felskanäle zu finden sind, wo die Strömung seicht ist. Wenn er an solchen Stellen Nahrung sucht, watet er flussaufwärts, und oft wird die schnelle Strömung, während sein Kopf unter Wasser ist, entlang der glänzenden Rundungen seines Halses und seiner Schultern nach oben abgelenkt, in Form einer klaren, kristallinen Schale, die ihn wie eine Glasglocke umschließt; die Schale zerbricht und formt sich neu, wenn er seinen Kopf hebt und senkt; dabei schleicht er sich immer wieder dorthin, wo ihn die zu starke Strömung von den Füßen reißt; dann erhebt er sich geschickt wieder und sucht an flacheren Stellen erneut nach Nahrung.
Aber im Winter, wenn die Flussufer mit Schnee bedeckt sind und die Flüsse selbst fast bis zum Gefrierpunkt abgekühlt sind, so dass der Schnee, der bei stürmischem Wetter hineinfällt, nicht vollständig aufgelöst wird, sondern einen dünnen, blauen Schlamm bildet, der die Strömung undurchsichtig macht – dann sucht er die tieferen Teile der Hauptflüsse auf, wo er in das klare Wasser unter dem Schlamm tauchen kann. Oder er begibt sich zu einem offenen See oder Mühlteich, auf dessen Grund er sicher fressen kann.
Wenn er sich auf diese Weise gezwungen sieht, sich zu einem See zu begeben, stürzt er sich nicht sofort wie eine Ente hinein, sondern landet immer zunächst auf einem Felsen oder einer umgestürzten Kiefer am Ufer. Dann fliegt er dreißig oder vierzig Meter weiter, mehr oder weniger, je nach Beschaffenheit des Bodens, landet mit einem zarten Schimmer auf der Oberfläche, schwimmt umher, blickt nach unten, entscheidet sich schließlich und verschwindet mit einem kräftigen Flügelschlag. Nachdem er zwei oder drei Minuten gefressen hat, taucht er plötzlich wieder auf, schüttelt mit einer kräftigen Bewegung das Wasser von seinen Flügeln und erhebt sich abrupt in die Luft, als ob er von unten hochgestoßen würde, kehrt zu seiner Sitzstange zurück, singt ein paar Minuten und geht wieder hinaus, um erneut zu tauchen; so kommt und geht er, singt und taucht stundenlang an derselben Stelle.

Die Amsel ist normalerweise einzeln anzutreffen; selten paarweise, außer während der Brutzeit, und sehr selten zu dritt oder zu viert. Einmal beobachtete ich drei, die einen Wintermorgen in Gesellschaft auf einem kleinen Gletschersee am Upper Merced verbrachten, etwa 7500 Fuß über dem Meeresspiegel. In der Nacht hatte es einen Sturm gegeben, aber die Morgensonne schien wolkenlos, und der schattige See, der dunkel in seiner frischen Schneedecke schimmerte, lag glatt und reglos wie ein Spiegel da. Mein Lager befand sich zufällig nur wenige Fuß vom Wasserrand entfernt, gegenüber einer umgestürzten Kiefer, deren Zweige sich über den See beugten. Hier nahmen meine drei herzlich willkommenen Besucher ihren Posten ein und begannen sofort, die frostige Luft mit ihrer köstlichen Melodie zu erfüllen, die mir an diesem Morgen doppelt Freude bereitete, da ich etwas Angst vor der Gefahr gehabt hatte, mir meinen Weg durch die schneebedeckten Schluchten ins Tiefland zu bahnen.
Der als Futterplatz ausgewählte Teil des Seebodens liegt fünfzehn bis zwanzig Fuß unter der Oberfläche und ist mit einem niedrigen Algen- und anderen Wasserpflanzenwuchs bedeckt – Tatsachen, die ich zuvor festgestellt hatte, als ich mit einem Floß darübersegelte. Nachdem sie auf der glasigen Oberfläche gelandet waren, spielten sie gelegentlich ein wenig und jagten einander in kleinen Kreisen herum; dann tauchten alle drei plötzlich zusammen ab, kamen dann an Land und sangen.
Die Amsel schwimmt selten mehr als ein paar Meter an der Oberfläche, denn da sie keine Schwimmfüße hat, kommt sie ziemlich langsam voran, aber mithilfe ihrer starken, knackigen Flügel schwimmt oder vielmehr fliegt sie schnell unter der Oberfläche und legt oft beträchtliche Entfernungen zurück. Die Stärke ihrer Flügel zeigt sich in dieser Hinsicht am eindrucksvollsten, wenn sie der Kraft schwerer Stromschnellen standhält. Das Folgende kann als gutes Beispiel seiner Fähigkeit zum Fliegen unter Wasser angesehen werden. An einem stürmischen Wintermorgen, als der Merced River blau und grün vom ungeschmolzenen Schnee war, beobachtete ich eine meiner Amseln, die auf einem Ast mitten in einer schnell rauschenden Stromschnelle saß und fröhlich sang, als ob alles in Ordnung wäre; und während ich am Ufer stand und sie bewunderte, stürzte sie sich plötzlich in die schlammige Strömung und ihr Gesang brach abrupt ab. Nachdem er ein oder zwei Minuten am Grund gefressen hatte und man annehmen würde, dass er unweigerlich weit flussabwärts getrieben werden musste, tauchte er genau dort auf, wo er hinabgestiegen war, landete auf demselben Baumstumpf, ließ die Wasserperlen von seinen Federn tropfen und setzte sein unvollendetes Lied scheinbar in aller Ruhe und Gelassenheit fort, als hätte es keine Unterbrechung gegeben.
Eine Drossel gelangt in eine weiße Strömung.
Von allen Vögeln wagt sich nur die Amsel in einen weißen Wildbach. Und obwohl sie von streng terrestrischer Struktur ist, ist kein anderer Vogel so untrennbar mit dem Wasser verbunden, nicht einmal die Ente, der kühne Ozeanalbatros oder der Sturmvogel. Enten gehen nämlich an Land, sobald sie an ungestörten Orten mit der Nahrungsaufnahme fertig sind, und machen sehr oft lange Flüge über Land von See zu See oder von Feld zu Feld. Dasselbe gilt für die meisten anderen Wasservögel. Aber die Amsel, die am Rand eines Baches oder auf einem Baumstumpf oder Felsbrocken mittendrin geboren wird, verlässt diesen selten für einen einzigen Augenblick. Denn obwohl sie oft in der Luft ist, fliegt sie nie über Land, sondern schwirrt mit schnellem, wachtelartigem Schlag über dem Bach und folgt all seinen Windungen. Selbst wenn der Bach sehr klein ist, sagen wir 1,5 bis 3 Meter breit, kürzt sie ihren Flug selten dadurch ab, dass sie eine Biegung überquert, wie steil diese auch sein mag; und selbst wenn er durch eine Begegnung am Ufer gestört wird, fliegt er lieber über den Kopf des anderen hinweg, als über den Boden zu gleiten. Wenn man daher seinen Flug entlang eines gewundenen Flusses von der Seite betrachtet, erscheint er äußerst geschwungen – eine Beschreibung jeder Kurve in der Luft mit blitzartiger Geschwindigkeit.
Er folgt den vertikalen Kurven und Winkeln der steilsten Sturzbäche mit der gleichen Genauigkeit, stürzt die Abhänge der Kaskaden hinab, stürzt sich steil über schwindelerregende Wasserfälle inmitten der Gischt und steigt mit der gleichen Furchtlosigkeit und Leichtigkeit auf, wobei er selten versucht, die Steilheit des Abhangs zu verringern, indem er mit dem Aufsteigen beginnt, bevor er den Fuß des Wasserfalls erreicht. Egal, wie hoch der Wasserfall mehrere hundert Fuß hoch ist, er bleibt geradeaus, als würde er sich kopfüber in die Menge der dröhnenden Raketen stürzen, schießt dann abrupt nach oben und beginnt, nachdem er oben auf dem Abgrund gelandet ist, um sich einen Moment auszuruhen, zu fressen und zu singen. Sein Flug ist fest und ungestüm, ohne Unterbrechung der Flügelschläge – ein einheitliches Summen wie das einer beladenen Biene auf dem Weg nach Hause. Und während er so frei von einem Fall zum nächsten summt, hört man ihn häufig eine langgezogene Folge unmodulierter Töne von sich geben, die in keiner Weise mit seinem Gesang in Verbindung stehen, aber eng mit seinem Flug in anhaltender Kraft korrespondieren.
Wären die Flüge aller Amseln in der Sierra auf einer Karte nachzuzeichnen, würden sie die Fließrichtung des gesamten Systems der alten Gletscher anzeigen, etwa von der Zeit des Aufbrechens der Eisdecke bis kurz vor dem Ende des Eiswinters; denn die Ströme, denen die Amseln so strikt folgen, fließen, mit der unbedeutenden Ausnahme einiger Nebenflüsse, alle in Kanälen, die die verschwundenen Gletscher für sie aus der festen Flanke der Bergkette erodiert haben – die Ströme folgen den alten Gletschern, die Amseln folgen den Strömen. Auch bei keinem anderen Bergvogel oder Tier finden wir eine so vollständige Übereinstimmung mit den Gletscherbedingungen im Leben. Bären halten die von Gletschern angelegten Pfade häufig für die am leichtesten zu begehenden; aber sie verlassen sie oft und wechseln von Schlucht zu Schlucht. So folgen auch die meisten Vögel den Moränen bis zu einem gewissen Grad, weil die Wälder auf ihnen wachsen. Aber sie wandern weit, durchqueren die Schluchten von Hain zu Hain und ziehen äußerst winkelige und komplizierte Bahnen.
Das Nest der Amsel ist eines der außergewöhnlichsten Beispiele von Vogelarchitektur, die ich je gesehen habe. Es ist merkwürdig und neuartig im Design, absolut originell und schön und in jeder Hinsicht des Genies des kleinen Erbauers würdig. Es hat einen Durchmesser von etwa einem Fuß, ist rund und wölbig im Umriss und hat eine ordentlich gewölbte Öffnung in Bodennähe, ähnlich einem altmodischen Ziegelofen oder einer Hottentottenhütte. Es ist fast ausschließlich aus grünem und gelbem Moos gebaut, hauptsächlich aus dem schönen Hypnum mit seinen Wedeln, das die Felsen und alten Treibholzstämme in der Nähe von Wasserfällen bedeckt. Diese sind geschickt miteinander verflochten und zu einer bezaubernden kleinen Hütte zusammengefilzt und so platziert, dass viele der äußeren Moose weiter gedeihen, als wären sie nie gepflückt worden. Gelegentlich findet man ein paar feine Gräser mit seidigen Stängeln, die mit den Moosen verflochten sind, aber mit Ausnahme einer dünnen Schicht, die den Boden bedeckt, scheint ihre Anwesenheit zufällig zu sein, da sie zu einer Art gehören, die mit den Moosen wächst und wahrscheinlich mit ihnen gepflückt wurde. Als Standort für dieses merkwürdige Herrenhaus wird normalerweise ein kleines Felsplateau gewählt, das von den leichteren Partikeln der Gischt eines Wasserfalls erreicht werden kann, sodass die Wände zumindest bei Hochwasser grün bleiben und wachsen.
An Ort und Stelle betrachtet weist kein Teil des Nestes scharfe Linien auf, doch wenn man es von der Basis abnimmt, weist die Rück- und Unterseite und manchmal auch ein Teil der Oberseite scharfe Kanten auf, da sie der Oberfläche des Felsens angepasst sind, auf dem und an dem es gebaut ist. Der kleine Architekt nutzt dabei immer zufällig vorhandene kleine Spalten und Vorsprünge aus, um seinem Bauwerk durch eine Art Greifen und Schwalbenschwanzverbindung Stabilität zu verleihen.
Bei der Wahl des Bauplatzes scheint man nicht auf die Verborgenheit zu achten; obwohl das Nest groß und arglos sichtbar ist, ist es alles andere als leicht zu entdecken, vor allem, weil es sich nach vorne wölbt wie jedes andere prall gefüllte Moospolster, das in solchen Situationen natürlich wächst. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn das Nest durch reichliches Besprenkeln frisch gehalten wird. Manchmal wird die Schönheit dieser romantischen kleinen Hütten durch Steinfarne und Gräser noch verstärkt, die um die moosbedeckten Wände oder vor der Türschwelle sprießen und von Kristallperlen übersät sind.
Darüber hinaus wird zu bestimmten Tageszeiten, wenn das Sonnenlicht im erforderlichen Winkel auf die Erde fällt, die gesamte Gischt, die das Feenhaus umgibt, in leuchtende Regenbogenfarben getaucht. Und in einer so herrlichen Regenbogenatmosphäre wie dieser erhaschen einige unserer gesegneten Drosseln zum ersten Mal einen Blick auf die Welt.
Amseln scheinen so fester Bestandteil der Flüsse zu sein, in denen sie leben, dass sie kaum einen anderen Ursprung als die Flüsse selbst vermuten lassen; und man könnte fast meinen, sie kämen direkt aus dem lebendigen Wasser, wie Blumen aus dem Boden. Aus welchem Grund auch immer, ich kam nie auf die Idee, nach ihren Nestern zu suchen, bis ich mehr als ein Jahr lang die Bekanntschaft der Vögel selbst gemacht hatte, obwohl ich noch am selben Tag, an dem ich mit der Suche begann, eines fand. Auf meinem Weg von Yosemite zu den Gletschern an den Quellen der Flüsse Merced und Tuolumne schlug ich mein Lager in einem besonders wilden und romantischen Teil des Nevada-Cañons auf, wo ich auf früheren Ausflügen stets die Gesellschaft meiner Lieblinge genossen hatte, die zweifellos von den sicheren Nistplätzen in den abfallenden Felsen und dem Überfluss an Nahrung und fallendem Wasser hierher gelockt wurden. Der Fluss besteht kilometerweit oberhalb und unterhalb aus einer Abfolge kleiner Wasserfälle mit einer Höhe von drei bis zwölf Metern, die durch flache, federähnliche Kaskaden miteinander verbunden sind, die blitzschnell von Wasserfall zu Wasserfall stürzen, frei und fast ohne Kanäle, über wogende Falten aus von Gletschern poliertem Granit.
Auf der Südseite eines der Wasserfälle weist der von der Gischt umspülte Teil der Abgrundkante eine Reihe kleiner Absätze und Tafeln auf, die durch die Entwicklung von Spaltflächen im Granit und den daraus resultierenden Fall von Massen durch die Einwirkung des Wassers entstanden sind. „Hier“, sagte ich, „ist ausgerechnet der reizvollste Platz für ein Amselnest.“ Als ich dann die zerklüftete Oberfläche des Abgrunds durch die Gischt sorgfältig absuchte, bemerkte ich schließlich ein gelbliches Moospolster, das auf der Kante einer ebenen Tafel fünf oder sechs Fuß von den äußeren Falten des Wasserfalls entfernt wuchs. Aber abgesehen von der Tatsache, dass es an einer Stelle lag, an der sich jemand, der mit dem Leben der Amseln vertraut ist, ein Amselnest vorstellen würde, war auf den ersten Blick nichts an seiner Stelle sichtbar, das es von anderen Hügeln aus Felsmoos unterschied, die in Bezug auf ganzjährige Gischt ähnlich gelegen sind; und erst nachdem ich es mehrmals genau untersucht hatte, meine Schuhe und Strümpfe ausgezogen hatte und in einer Entfernung von acht bis zehn Fuß an der Felswand entlanggekrochen war, konnte ich mit Sicherheit entscheiden, ob es sich um ein Nest oder eine natürliche Wucherung handelte.
In diese Mooshütten werden drei oder vier Eier gelegt, weiß wie Schaumblasen, und die kleinen Vögel, die daraus schlüpfen, singen gern Wasserlieder, denn sie hören sie ihr ganzes Leben lang und sogar schon vor ihrer Geburt.
Ich habe oft beobachtet, wie die Jungen, die gerade aus dem Nest gekommen sind, ihre seltsamen Gesten machten und sich in jeder Hinsicht genauso zu Hause fühlten wie ihre erfahrenen Eltern, wie junge Bienen auf ihren ersten Ausflügen zu den Blumenfeldern. Keine noch so große Vertrautheit mit Menschen und ihren Gewohnheiten scheint sie im Geringsten zu verändern. Allem Anschein nach ist ihr Verhalten beim ersten Anblick eines Menschen genau dasselbe wie wenn sie ihn schon oft gesehen haben.
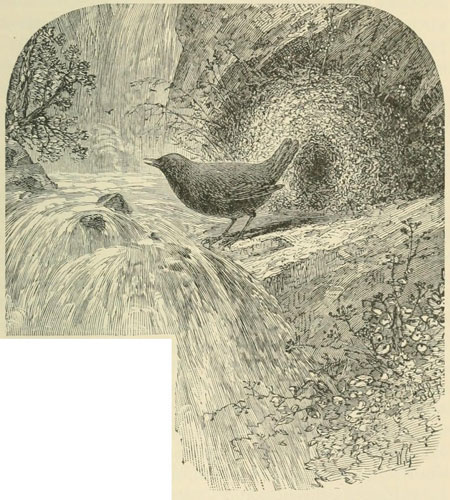
An den Unterläufen der Flüsse, an denen Mühlen gebaut sind, singen sie trotz des Lärms der Maschinen und des lärmenden Durcheinanders von Hunden, Vieh und Arbeitern. Als einmal ein Holzfäller am Flussufer arbeitete, beobachtete ich einen, der in Reichweite der umherfliegenden Späne fröhlich sang. Auch keine Art ungewohnter Störung versetzt ihn in schlechte Laune oder bringt ihn aus seiner ruhigen Selbstbeherrschung. Als ich einmal durch eine enge Schlucht flog, trieb ich einen von einer Stromschnelle zur nächsten vor mir her und störte ihn viermal schnell hintereinander, sodass er wegen der Enge des Kanals nicht gut an mir vorbeifliegen konnte. Die meisten Vögel bilden sich unter ähnlichen Umständen ein, verfolgt zu werden und werden verdächtig unruhig; aber statt nervös zu werden, tauchte er wie üblich unter und sang eine seiner ruhigsten Melodien. Aus einiger Entfernung betrachtet, scheint man in ihren Augen eine bemerkenswerte Sanftheit und Intelligenz auszudrücken; aber sie erlauben selten einen so nahen Blick, es sei denn, man trägt Kleidung von etwa der gleichen Farbe wie die Felsen und Bäume und weiß, wie man still sitzt. Einmal, als ich am Ufer eines Bergsees entlang wanderte, wo die Vögel, zumindest die in dieser Jahreszeit geborenen, noch nie einen Menschen gesehen hatten, setzte ich mich auf einen großen Stein dicht am Wasserrand, um auszuruhen, auf dem sich anscheinend die Amseln und Strandläufer niederließen, wenn sie an diesen Teil des Ufers kamen, um zu fressen, und auch einige der anderen Vögel, wenn sie herunterkamen, um sich zu waschen oder zu trinken. Ein paar Minuten später kam eine schwirrende Amsel vorbei und ließ sich auf dem Stein neben mir nieder, in Reichweite meiner Hand. Dann bemerkte sie mich plötzlich und bückte sich nervös, als wolle sie sofort losfliegen, aber als ich so bewegungslos verharrte wie der Stein, fasste sie Vertrauen und sah mir etwa eine Minute lang fest ins Gesicht, dann flog sie ruhig zum Ausfluss und begann zu singen. Als nächstes kam ein Strandläufer und blickte mich mit dem gleichen arglosen Blick an wie die Drossel. Zuletzt kam mit einem Sturzflug ein Blauhäher aus einer Tanne herunter, wahrscheinlich mit der Absicht, seine laute Kehle zu befeuchten. Doch anstatt vertrauensvoll zu sitzen, wie es meine anderen Besucher getan hatten, stürzte er sofort davon, stürzte in seiner argwöhnischen Verwirrung fast kopfüber in den See und weckte mit lautem Geschrei die Nachbarschaft.
Die Liebe zu Singvögeln mit ihren süßen menschlichen Stimmen scheint weiter verbreitet und unverbrüchlicher zu sein als die Liebe zu Blumen. Jeder liebt Blumen bis zu einem gewissen Grad, zumindest an den frischen Morgenstunden des Lebens, und wird von ihnen ebenso instinktiv angezogen wie von Kolibris und Bienen. Sogar die jungen Digger-Indianer haben so viel Liebe für die schönsten Blumen, die auf den Bergen wachsen, dass sie sie pflücken und als Haarschmuck flechten. Und ich war froh, durch die wenigen Indianer, die man dazu bringen konnte, über das Thema zu sprechen, zu erfahren, dass sie Namen für die Wildrose und die Lilie und andere auffällige Blumen haben, ob sie nun als Nahrungsmittel oder anderweitig erhältlich sind. Die meisten Menschen, ob wild oder zivilisiert, werden jedoch allen Pflanzen gegenüber apathisch, die keinen anderen offensichtlichen Nutzen haben als den der Schönheit. Aber glücklicherweise wird die erste instinktive Liebe zu Singvögeln nie ganz ausgelöscht, egal, welche Einflüsse sie auf unser Leben haben mögen. Ich habe mich oft darüber gefreut, wenn ich sah, wie ein reines, spirituelles Glühen in die Gesichter harter Geschäftsleute und alter Bergleute trat, wenn zufällig ein Singvogel in ihrer Nähe landete. Dennoch ist der kleine Bissen Fleisch, der die Brüste mancher Singvögel anschwellen lässt, allzu oft die Ursache ihres Todes. Insbesondere Lerchen und Rotkehlchen werden zu Hunderten auf den Markt gebracht. Aber glücklicherweise hat die Amsel keinen Feind, der so begierig darauf wäre, ihren kleinen Körper zu fressen, dass er ihr in die Einsamkeit der Berge folgt. Ich habe nie erlebt, dass sie auch nur von Falken gejagt worden wäre.
Ein Bekannter von mir, ein Bergsteiger aus den Vorgebirgen, hatte eine Hauskatze, ein großes, schläfriges, übergroßes Geschöpf, ungefähr so breitschultrig wie ein Luchs. Im Winter, wenn der Schnee tief lag, saß der Bergsteiger in seiner einsamen Hütte zwischen den Kiefern, rauchte seine Pfeife und vertrieb sich die langweilige Zeit. Tom war sein einziger Gefährte, teilte sein Bett und saß neben ihm auf einem Stuhl mit einem ähnlichen schläfrigen Blick wie sein Herr. Der gutmütige Junggeselle war mit seiner harten Kost aus Sodabrot und Speck zufrieden, aber Tom, das einzige Geschöpf auf der Welt, das seine Abhängigkeit von ihm anerkannte, musste mit frischem Fleisch versorgt werden. Daher machte er sich daran, Eichhörnchenfallen zu konstruieren, und watete mit seinem Gewehr durch die verschneiten Wälder, wobei er unter den wenigen Wintervögeln traurige Verwüstungen anrichtete und weder Rotkehlchen, Spatzen noch winzige Kleiber verschonte, und die Freude, Tom essen und fett werden zu sehen, war seine große Belohnung.
Als er an einem kalten Nachmittag am Flussufer jagte, bemerkte er einen kleinen Vogel mit schlichten Federn, der im seichten Wasser herumhüpfte, und hob sofort sein Gewehr. Doch gerade in diesem Moment begann der zutrauliche Sänger zu singen, und nachdem er seiner sommerlichen Melodie gelauscht hatte, wandte sich der verzauberte Jäger ab und sagte: „Gott segne dich, ich kann dich nicht erschießen, nicht einmal für Tom.“
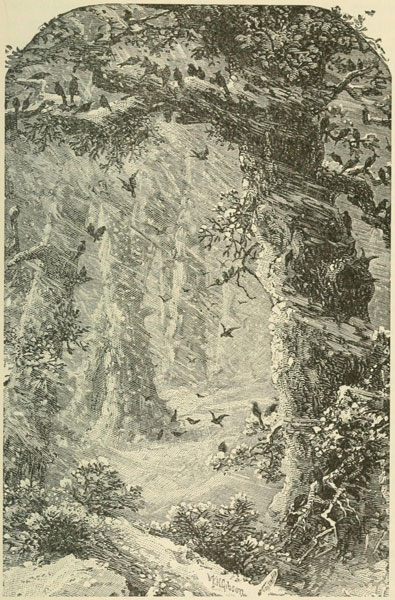
Sogar im eisigen Norden Alaskas habe ich meinen fröhlichen Sänger gefunden. Als ich an einem kalten Novembertag die Gletscher zwischen Mount Fairweather und dem Stikeen River erkundete, nachdem ich vergeblich versucht hatte, mir einen Weg durch die unzähligen Eisberge der Sum Dum Bay zu den großen Gletschern an deren Spitze zu bahnen, war ich müde und ratlos und ruhte mich in meinem Kanu aus, schließlich überzeugt, dass ich diesen Teil meiner Arbeit für ein weiteres Jahr aufgeben musste. Dann begann ich, meine Flucht aufs offene Meer zu planen, bevor das junge Eis, das sich zu bilden begann, mich einschließen würde. Während ich so mit den Eisbergen trieb, inmitten dieser düsteren Vorahnungen und all der schrecklichen Gletschertrostlosigkeit und -erhabenheit, hörte ich plötzlich das bekannte Surren der Flügel einer Amsel und als ich aufblickte, sah ich meinen kleinen Tröster direkt vom Ufer über das Eis kommen. In ein oder zwei Sekunden war er bei mir und flog dreimal um meinen Kopf herum und salutierte fröhlich, als wolle er sagen: „Kopf hoch, alter Freund; du siehst, ich bin hier und alles ist gut.“ Dann flog er zurück zum Ufer, landete auf der obersten Spitze eines gestrandeten Eisbergs und begann zu nicken und sich zu verneigen, als säße er auf einem seiner Lieblingsfelsen inmitten einer sonnigen Sierra-Kaskade.
Die Art ist entlang der gesamten Gebirgskette der Pazifikküste von Alaska bis Mexiko und im Osten bis zu den Rocky Mountains verbreitet. Dennoch ist sie bisher verhältnismäßig wenig bekannt. Audubon und Wilson sind ihr nicht begegnet. Swainson war meines Wissens der erste Naturforscher, der ein Exemplar aus Mexiko beschrieb. Kurz darauf wurden von Drummond in der Nähe der Quellen des Athabasca-Flusses zwischen dem 54. und 56. Breitengrad Exemplare beschafft; und sie wurde von fast allen der zahlreichen Forschungsexpeditionen gesammelt, die in letzter Zeit durch unsere westlichen Staaten und Territorien unternommen wurden; denn sie erregt stets auf ganz besondere Weise die Aufmerksamkeit der Naturforscher.
So ist also unser kleiner Cinclus, geliebt von jedem, der das Glück hat, ihn zu kennen. Auf starken Flügeln folgt er jeder Biegung der steilsten Ströme von einem Ende der Sierra zum anderen, fürchtet sich nicht, ihnen durch ihre dunkelsten Schluchten und kältesten Schneetunnel zu folgen, kennt jeden Wasserfall und widerhallt ihre göttliche Musik, und interpretiert während seines ganzen schönen Lebens alles, was wir in unserem Unglauben an den Äußerungen der Ströme und Stürme schrecklich finden, als nur verschiedene Ausdrücke der ewigen Liebe Gottes.
KAPITEL XIV
DAS WILDE SCHAF
(Ovis montana)
Das Wildschaf ist das stärkste Tier unter den Bergbewohnern der Sierra. Es verfügt über scharfe Augen und einen guten Geruchssinn sowie starke Gliedmaßen und lebt sicher auf den höchsten Gipfeln, springt unversehrt von Fels zu Fels, klettert schwindelerregende Abgründe hinauf und hinunter, überquert schäumende Sturzbäche und Hänge aus gefrorenem Schnee, ist den wildesten Stürmen ausgesetzt und führt dennoch ein tapferes, warmes Leben und entwickelt sich von Generation zu Generation zu perfekter Stärke und Schönheit.
Fast alle hohen Gebirgsketten der Erde werden von Wildschafen bewohnt, von denen die meisten wegen der abgelegenen und fast unzugänglichen Regionen, in denen sie leben, noch nicht vollständig erforscht sind. Verschiedene Naturforscher klassifizieren sie in fünf bis zehn verschiedene Arten oder Varietäten, von denen die bekanntesten das Burrhel des Himalaya (Ovis burrhel , Blyth), das Argali, das große Wildschaf Zentral- und Nordostasiens (O. ammon, Linn. oder Caprovis argali), das korsische Mufflon ( O. musimon , Pal.), das Mähnenschaf der Berge Nordafrikas ( Ammotragus tragelaphus) und das Rocky-Mountain-Dickhornschaf ( O. montana , Cuv.) sind. Zu dieser letztgenannten Art gehört das Wildschaf der Sierra. Sein Verbreitungsgebiet erstreckt sich laut dem verstorbenen Professor Baird vom Smithsonian Institut „von der Region des oberen Missouri und Yellowstone bis zu den Rocky Mountains und den angrenzenden Hochebenen an ihren Osthängen und südlich bis zum Rio Grande. Im Westen reicht es bis zu den Küstenketten von Washington, Oregon und Kalifornien und folgt den Hochebenen ein Stück weit bis nach Mexiko.“ [1] In der gesamten riesigen Region, die im Osten von den Wahsatch Mountains und im Westen von der Sierra begrenzt wird, gibt es über einhundert untergeordnete Ketten und Gebirgsgruppen, die sich von Norden nach Süden erstrecken und sich über die Grenzen hinaus erstrecken, mit Gipfeln, die sich 2.500 bis 3.500 Meter über dem Meeresspiegel erheben, und die nach meinen eigenen Beobachtungen wahrscheinlich alle von dieser Art bewohnt sind oder waren.
Verglichen mit dem Argali, das angesichts seiner Größe und seines enormen Verbreitungsgebiets wahrscheinlich das wichtigste aller Wildschafe ist, ist unsere Art etwa gleich groß, aber die Hörner sind weniger verdreht und weniger divergent. Die wichtigeren Merkmale sind jedoch im Wesentlichen dieselben, und einige der besten Naturforscher behaupten, dass es sich bei beiden nur um abgewandelte Formen einer Art handelt. In Übereinstimmung mit dieser Ansicht vermutet Cuvier, dass das Argali, da Zentralasien die Region zu sein scheint, in der das Schaf zuerst auftrat und von der aus es sich verbreitete, von Asien aus über diesen Kontinent verbreitet worden sein könnte, indem es die Beringstraße auf Eis überquerte. Diese Vermutung ist nicht so unbegründet, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag; denn die Straße ist nur etwa fünfzig Meilen breit, wird von drei Inseln unterbrochen und ist fast jeden Winter mit Eis verstopft. Außerdem ist das Argali in den Bergen neben der Straße am Ostkap in großer Menge vorhanden, wo es den Tschuckchi-Jägern gut bekannt ist und wo ich viele ihrer Hörner gesehen habe.
Aufgrund der extremen Variabilität der gezüchteten Schafe wird allgemein angenommen, dass die unzähligen domestizierten Rassen alle von den wenigen wilden Arten abstammen; die ganze Frage ist jedoch im Dunkeln. Darwin zufolge sind Schafe schon seit sehr langer Zeit domestiziert; die Überreste einer kleinen Rasse, die sich von allen heute bekannten unterscheidet, wurden in den berühmten Schweizer Pfahlbauten gefunden.
Verglichen mit den bekanntesten domestizierten Rassen stellen wir fest, dass unsere wilden Tiere viel größer sind und statt eines reinen Wollkleids ein dickes Oberfell wie das der Hirsche und eine Unterdecke aus feiner Wolle tragen. Das Haar ist zwar ziemlich grob, aber angenehm weich und schwammig und liegt glatt, als ob es sorgfältig mit Kamm und Bürste gepflegt worden wäre. Die vorherrschende Farbe ist während des größten Teils des Jahres bräunlich-grau, im Herbst jedoch bläulich-grau; der Bauch und ein großer, auffälliger Fleck auf dem Gesäß sind weiß; und der Schwanz, der wie der eines Hirsches sehr kurz ist, ist schwarz mit einem gelblichen Rand. Die Wolle ist weiß und wächst in schönen Spiralen unsichtbar zwischen dem glänzenden Haar herab, wie zarte Kletterpflanzen zwischen Maisstängeln.
Die Hörner des Männchens sind enorm groß und messen im Durchmesser zwischen 13 und 15 cm und in der Krümmung zwischen 75 und 90 cm. Sie sind gelblich-weiß gefärbt und quer geriffelt, wie die des Widderbocks. Ihr Querschnitt ist an der Basis etwa dreieckig und zur Spitze hin abgeflacht. Sie erheben sich kühn vom Kopf und biegen sich sanft nach hinten und außen, dann nach vorne und außen, bis sie etwa drei Viertel eines Kreises beschreiben und die abgeflachten, stumpfen Spitzen etwa 60 bis 75 cm voneinander entfernt sind. Die Hörner des Weibchens sind über ihre gesamte Länge abgeflacht, weniger gekrümmt als die des Männchens und viel kleiner, sie messen weniger als 30 cm entlang der Krümmung.
Ein Widder und ein Schaf, die ich in der Nähe der Modoc-Lavabetten nordöstlich des Mount Shasta erbeutete, hatten folgende Maße:
| RAM. | Blatt. | |||
| ft. | In. | ft. | In. | |
| Höhe an den Schultern | 3 | 6 | 3 | 0 |
| Umfang um die Schultern | 3 | 11 | 3 | 3¾ |
| Länge von der Nase bis zur Schwanzwurzel | 5 | 10¼ | 4 | 3½ |
| Länge der Ohren | 0 | 4¾ | 0 | 5 |
| Länge des Schwanzes | 0 | 4½ | 0 | 4½ |
| Länge der Hörner um die Kurve | 2 | 9 | 0 | 11½ |
| Abstand von Spitze zu Spitze der Hörner | 2 | 5½ | ||
| Umfang der Hörner an der Basis | 1 | 4 | 0 | 6 |
Die Maße eines Männchens, das Audubon in den Rocky Mountains ermittelte, weichen im Vergleich mit den obigen nur wenig ab. Das Gewicht seines Exemplars betrug 344 Pfund [2] , was vielleicht ungefähr dem Durchschnitt für ausgewachsene
Männchen entspricht. Die Weibchen sind etwa ein Drittel leichter.
Neben diesen oben erwähnten Unterschieden in Größe, Farbe, Fell usw. können wir beobachten, dass das Hausschaf im Allgemeinen ausdruckslos ist, wie ein stumpfes Bündel von etwas, das nur halb lebendig ist, während das wilde Schaf so elegant und anmutig ist wie ein Hirsch, und jede Bewegung eine bewundernswerte Stärke und Charakterstärke zeigt. Das zahme Schaf ist schüchtern, das wilde ist mutig. Das zahme Schaf ist immer mehr oder weniger zerzaust und schmutzig, während das wilde Schaf so glatt und sauber ist wie die Blumen seiner Bergweiden.
Die erste Erwähnung des Wildschafs in Amerika, die ich finden konnte, stammt von Pater Picolo, einem katholischen Missionar in Monterey, im Jahr 1797. Er beschreibt das Tier seltsamerweise als „eine Art Hirsch mit einem schafähnlichen Kopf und etwa so groß wie ein ein oder zwei Jahre altes Kalb“, und bemerkt dann natürlich gleich: „Ich habe von diesen Tieren gegessen; ihr Fleisch ist sehr zart und köstlich.“ Mackenzie hörte auf seinen Reisen in den Norden, wie die Indianer von dieser Art als „weißen Büffeln“ sprachen. Und Lewis und Clark erzählen uns, dass sie in einer Zeit großer Knappheit an den Quellflüssen des Missouri viele Wildschafe sahen, diese aber „zu scheu waren, um geschossen zu werden“.
Einige der energischeren Pah-Ute-Indianer jagen jede Saison in den zugänglicheren Teilen der High Sierra in der Nähe von Pässen wilde Schafe. Dort sind sie durch die Verfolgung äußerst vorsichtig geworden. In der rauen Wildnis der Gipfel und Canyons jedoch, wo die schäumenden Nebenflüsse des San Joaquin River und des King River entspringen, fürchten sie keinen Jäger außer dem Wolf und sind argloser und zugänglicher als ihre zahmen Verwandten.
Während ich damit beschäftigt war, die Hochregionen zu erkunden, in denen sie so gern umherstreifen, habe ich mich sehr für das Studium ihrer Gewohnheiten interessiert. In den Monaten November und Dezember und wahrscheinlich auch während eines beträchtlichen Teils des Mittwinters tummeln sie sich alle in Scharen, Männchen und Weibchen, Alt und Jung. Einmal fand ich eine ganze Herde dieser Art mit über fünfzig Tieren, die, als sie aufgeschreckt wurden, mit bewundernswerter Geschwindigkeit über ein zerklüftetes Lavabett davonsprangen, angeführt von einem majestätischen alten Widder, während die Lämmer sicher in der Mitte der Herde blieben.
Im Frühjahr und Sommer bilden die ausgewachsenen Widder getrennte Herden von drei bis zwanzig Tieren und findet man normalerweise beim Grasen an den Rändern der Gletscherwiesen oder beim Ausruhen zwischen den burgartigen Klippen der hohen Gipfel. Und ob sie nun ruhig grasen oder die wilden Klippen erklimmen, ihre edlen Formen und die Kraft und Schönheit ihrer Bewegungen versetzen den Betrachter stets in lebhafte Bewunderung.
Ihre Ruheplätze scheinen sie nach dem Gesichtspunkt der Sonneneinstrahlung und der weiten Aussicht, aber vor allem nach der Sicherheit auszuwählen. Ihre Futterplätze gehören zu den schönsten der wilden Gärten, leuchtend mit Gänseblümchen und Enzianen und Matten aus violettem Bryanthus, versteckt auf felsigen Landzungen und Canyonhängen, wo es reichlich Sonnenschein gibt, oder unten in den schattigen Gletschertälern, entlang der Ufer der Flüsse und Seen, wo der plüschige Rasen am grünsten ist. Hier schlemmen sie den ganzen Sommer, die glücklichen Wanderer, und genießen vielleicht die Schönheit ebenso wie den Geschmack der lieblichen Flora, von der sie sich ernähren.
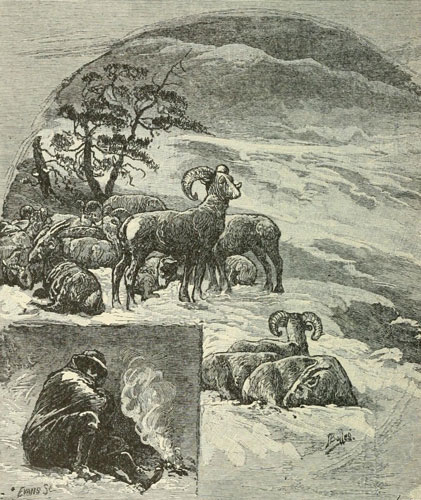
Wenn die Winterstürme einsetzen und ihre Hochlandweiden mit Schnee bedecken, sammeln sie sich wie die Vögel und ziehen in tiefer gelegene Gebiete. Normalerweise steigen sie die Ostflanke der Bergkette hinab zu den rauen, vulkanischen Hochplateaus und baumlosen Gebirgsketten des Großen Beckens, das an die Sierra angrenzt. Sie beeilen sich jedoch nie und scheinen keine Angst vor Stürmen zu haben. Viele der stärksten ziehen nur gemächlich zu den kahlen, windgepeitschten Bergrücken hinab, um sich von Büschen und trockenem Büschelgras zu ernähren, und kehren dann wieder in den Schnee zurück. Einmal war ich drei Tage lang auf dem Mount Shasta eingeschneit, etwas unterhalb der Baumgrenze. Es war eine dunkle und stürmische Zeit, die gut geeignet war, die Fähigkeiten und die Ausdauer der Bergsteiger auf die Probe zu stellen. Der schneebeladene Sturm fegte Tag und Nacht in zischenden, blendenden Fluten, und als er schließlich nachließ, fand ich eine kleine Herde wilder Schafe, die dem Sturm im Windschatten einer Zwergkieferngruppe wenige Meter über meinem Sturmnest, wo der Schnee acht oder zehn Fuß hoch war, getrotzt hatte. Ich war warm hinter einem Felsen, mit Decken, Brot und Feuer. Meine tapferen Gefährten lagen im Schnee, ohne Nahrung und nur teilweise unter dem Schutz der niedrigen Bäume, doch sie zeigten kein Anzeichen von Leiden oder Mutlosigkeit.
In den Monaten Mai und Juni bringen die Wildschafe ihre Jungen in einsamen und fast unzugänglichen Felsklippen hoch über den Nistplätzen der Adler zur Welt. Ich bin häufig auf die Lager der Schafe und Lämmer in einer Höhe von 12.000 bis 13.000 Fuß über dem Meeresspiegel gestoßen. Diese Lager sind einfach ovale Mulden, die zwischen losen, zerfallenden Felssplittern und Sand ausgegraben sind, an einem sonnigen Ort mit guter Aussicht und teilweise geschützt vor den Winden, die fast ohne Unterbrechung über diese hohen Gipfel fegen. So sieht die Wiege des kleinen Bergbewohners aus, hoch oben im Himmel; geschaukelt in Stürmen, eingehüllt in Wolken, schlafend in dünner, eisiger Luft; aber eingehüllt in sein haariges Fell und genährt von einer starken, warmen Mutter, geschützt vor den Klauen des Adlers und den Zähnen des schlauen Kojoten, wächst das hübsche Lamm schnell heran. Schon bald lernt er, an den büscheligen Felsengräsern und Blättern der weißen Spiersträucher zu knabbern; seine Hörner beginnen zu sprießen, und noch bevor der Sommer vorüber ist, ist er stark und flink und zieht mit der Herde hinaus, bewacht von derselben göttlichen Liebe, die sich auch um das hilflosere menschliche Lamm in seiner Wiege am Herdfeuer kümmert.
Nichts wird von lauten, staubigen Wanderern in der Sierra häufiger bemerkt als der Mangel an Tierleben – keine Singvögel, keine Hirsche, keine Eichhörnchen, kein Wild jeglicher Art, sagen sie. Aber wenn sie nur ruhig in die Wildnis gehen könnten, zu Fuß und allein mit natürlicher Besonnenheit, würden sie bald lernen, dass diese Berghäuser nicht ohne Bewohner sind, von denen viele, zutraulich und freundlich, nicht versuchen würden, ihre Bekanntschaft zu meiden.

Im Herbst 1873 folgte ich dem South Fork des San Joaquin durch seinen wilden Cañon bis zu seinen am weitesten entfernten Gletscherquellen. Es war die Zeit des alpinen Altweibersommers. Die Sonne schien liebevoll; die Eichhörnchen sammelten Nüsse in den Kiefern, Schmetterlinge schwirrten um die letzten Goldruten, die Weiden- und Ahorndickichte waren gelb, die Wiesen braun und die ganze sonnige, sanfte Landschaft glühte wie ein Antlitz in tiefster und süßester Ruhe. Auf meinem Weg über die von Gletschern polierten Felsen entlang des Flusses kam ich zu einem erweiterten Teil des Cañons, etwa drei Kilometer lang und eine halbe Meile breit, der einen ebenen Park bildete, der von malerischen Granitmauern wie denen des Yosemite Valley umgeben war. Durch die Mitte ergoss sich der wunderschöne Fluss, der im goldenen Licht schimmerte und glitzerte, mit gelben Hainen an seinen Ufern und Streifen brauner Wiesen; während der ganze Park von wildem Leben wimmelte, von dem selbst der lauteste und unaufmerksamste Reisende einiges hätte sehen müssen, wenn er bei mir gewesen wäre. Hirsche mit ihren geschmeidigen, gut gewachsenen Kitzen sprangen von Dickicht zu Dickicht, als ich vorwärtskam; Moorhühner erhoben sich mit lautem Flügelgewirr aus dem braunen Gras, ließen sich auf den unteren Zweigen der Kiefern und Pappeln nieder und kamen ganz nah heran, als ob sie neugierig wären, mich zu sehen. Weiter hinten zeigte sich eine breitschultrige Wildkatze, die aus einem Wäldchen kam, den Fluss auf einem Baumstamm überquerte und einen Moment anhielt, um zurückzublicken. Die vogelähnlichen Tamias hüpften überall zwischen den Kiefernnadeln und den Grasbüscheln um meine Füße herum; Kraniche wateten durch die Untiefen der Flussbiegungen, der Eisvogel klapperte von Sitzstange zu Sitzstange und die gesegnete Amsel sang inmitten der Gischt jedes Wasserfalls. Wo könnte ein einsamer Wanderer eine interessantere Familie von Bergbewohnern, erdgeborenen Gefährten und Mitsterblichen finden? Es war Nachmittag, als ich mich ihnen anschloss, und die herrliche Landschaft begann in der Dämmerung zu verblassen, bevor ich aus ihrem Zauber erwachte. Dann suchte ich mir einen Lagerplatz am Flussufer, machte mir eine Tasse Tee und legte mich auf einem glatten Platz zwischen den gelben Blättern eines Espenhains schlafen. Am nächsten Tag entdeckte ich noch großartigere Landschaften und ein großartigeres Leben. Als ich dem Fluss über riesige, anschwellende Felsvorsprünge durch eine majestätische Schlucht und an unzähligen Wasserfällen vorbei folgte, wurde die Landschaft im Allgemeinen allmählich wilder und alpiner. Die Zuckerkiefern und Weißtannen machten den robusteren Zedern und Hemlocktannen Platz. Die Schluchtwände wurden schroffer und kahler, und Enzian und arktische Gänseblümchen wuchsen in den Gärten und Wiesenstreifen entlang der Flüsse. Gegen Nachmittag kam ich in ein anderes Tal, das in all seinen Zügen auffallend wild und ursprünglich war und wahrscheinlich noch nie zuvor von einem Menschen betreten wurde. Es ist eines der kleinsten Täler des Yosemite-Typs, aber seine Wände sind erhaben,Er erhebt sich auf eine Höhe von 2000 bis 4000 Fuß über dem Fluss. Am Ende des Tals gabelt sich der Hauptcañon, wie es in allen Yosemite-Bergen der Fall ist. Die Entstehung dieses Canyons ist hauptsächlich auf die Wirkung zweier großer Gletscher zurückzuführen, deren Quellen im Osten an den Flanken der Mounts Humphrey und Emerson und einer Gruppe namenloser Gipfel weiter südlich liegen.

Der graue, von Felsbrocken durchzogene Fluss sang laut durch das Tal, doch über seinem gewaltigen Tosen hörte ich das Dröhnen eines Wasserfalls, der mich gierig weiterzog; und gerade als ich aus dem Gewirr der Wälder und Dornendickichte am Talende herauskam, kam die Hauptgabel des Flusses in Sicht, die frisch aus ihren Gletscherquellen in einer schneeweißen Kaskade zwischen 2000 Fuß hohen Granitwänden herabstürzte. Der steile Abhang, den das ruhige Wasser donnernd hinabstürzte, schien mir jedes weitere Vorankommen zu verwehren. Es dauerte jedoch nicht lange, bis ich eine krumme Naht im Fels entdeckte, über die ich an den Rand einer Terrasse klettern konnte, die den Canyon kreuzt und den Wasserfall fast in der Mitte teilt. Hier setzte ich mich hin, um Luft zu holen und einige Einträge in mein Notizbuch zu machen, wobei ich gleichzeitig meine erhöhte Position über den Bäumen ausnutzte, um über das Tal in das Herz der edlen Landschaft zurückzublicken, ohne zu wissen, welche Nachbarn in der Nähe waren.
Nachdem ich ein paar Minuten auf diese Weise verbracht hatte, blickte ich zufällig über den Wasserfall und sah dort drei Schafe, die mich ruhig beobachteten. Nie zuvor hatte das plötzliche Auftauchen eines Berges, Wasserfalls oder menschlichen Freundes meine Aufmerksamkeit stärker gefesselt. Die Begierde, alles genau zu beobachten, ließ mich vollkommen still verharren. Eifrig beobachtete ich die fließenden Wellen ihrer festen, geflochtenen Muskeln, ihre starken Beine, Ohren, Augen, Köpfe, ihre anmutigen, runden Hälse, die Farbe ihres Haars und die kühnen, nach oben geschwungenen Kurven ihrer edlen Hörner. Wenn sie sich bewegten, beobachtete ich jede Geste, während sie, in keiner Weise durch meine Aufmerksamkeit oder das stürmische Tosen des Wassers aus der Fassung gebracht, bedächtig neben den Stromschnellen zwischen den beiden Teilen des Wasserfalls herbeischritten und sich ab und zu umdrehten, um mich anzusehen. Bald kamen sie zu einem steilen, eispolierten Abhang, den sie mit einer Reihe schneller, kurzer, steifbeiniger Sprünge erklommen und ohne Kampf die Spitze erreichten. Dies war die erstaunlichste Bergsteigerleistung, die ich je erlebt hatte, und wenn ich nur die Mechanik der Sache betrachte, hätte mein Erstaunen kaum größer sein können, wenn sie Flügel gezeigt und die Flucht ergriffen hätten. „Trittsichere“ Maultiere wären auf einem solchen Boden wie lose Felsbrocken gefallen und gerollt. Oftmals war ich gezwungen, an viel niedrigeren Hängen meine Schuhe und Strümpfe auszuziehen, sie an meinen Gürtel zu binden und barfuß und mit äußerster Vorsicht zu kriechen. Kein Wunder also, dass ich den Fortschritt dieser tierischen Bergsteiger mit großer Sympathie beobachtete und mich über die grenzenlose Genügsamkeit der wilden Natur freute, die sich in ihrer Erfindung, Konstruktion und Haltung zeigte. Ein paar Minuten später erblickte ich ein Dutzend weitere in einer Gruppe am Fuße des oberen Wasserfalls. Sie standen auf derselben Seite des Flusses wie ich, nur fünfundzwanzig oder dreißig Meter entfernt, und sahen so ungetragen und perfekt aus, als wären sie an Ort und Stelle erschaffen worden. Ihren Spuren, die ich im Little Yosemite gesehen hatte, und ihrer gegenwärtigen Position nach zu urteilen, grasten sie alle zusammen unten im Tal, als ich die Schlucht heraufkam. In ihrer Eile, höher gelegenes Gelände zu erreichen, wo sie sich umsehen und die Ursache der seltsamen Störung feststellen konnten, teilten sie sich: Drei kletterten auf der einen Seite des Flusses hinauf, der Rest auf der anderen.
Die Hauptgruppe, angeführt von einem erfahrenen Häuptling, begann nun, die wilden Stromschnellen zwischen den beiden Teilen des Wasserfalls zu überqueren. Dies war eine weitere aufregende Leistung; denn unter all den vielfältigen Erfahrungen, die Bergsteiger machen, ist die Überquerung stürmischer, felsiger Sturzbäche eine der nervenaufreibendsten. Doch diese feinen Kerle gingen furchtlos an den Rand und sprangen von Felsbrocken zu Felsbrocken, wobei sie sich in leichter Haltung über der wirbelnden, verwirrenden Strömung hielten, als ob sie nichts Außergewöhnliches täten.
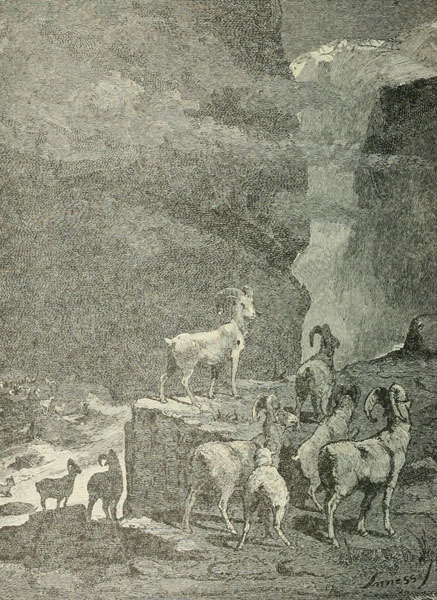
Im unmittelbaren Vordergrund dieses seltenen Bildes war eine Falte aus eispoliertem Granit zu sehen, durchzogen von einigen kräftigen Linien, in denen Felsfarne und Büschel von Bryanthus wuchsen. An den Seiten waren die grauen Canyonwände edel geformt und mit braunen Zedern und Kiefern geschmückt. In der Ferne waren hohe Gipfel zu sehen und im Mittelgrund der schneebedeckte Wasserfall, die Stimme und Seele der Landschaft. Die Büsche am Rand schlugen im Takt seiner Donnertöne. Davor standen die tapferen Schafe, deren graue Gestalten in der Gischt leicht verborgen waren, sich jedoch in gutem, kräftigem Relief vom nahen weißen Wasser abhoben. Ihre riesigen Hörner ragten wie die umgedrehten Wurzeln abgestorbener Kiefern empor, während die abendlichen Sonnenstrahlen, die den Canyon hinaufströmten, das ganze Bild in ein rosiges Purpurrot färbten und ihm einen herrlichen Glanz verliehen. Nachdem sie den Fluss überquert hatten, begannen die unerschrockenen Bergsteiger unter der Führung ihres Anführers sofort, die Canyonwand zu erklimmen. Sie wandten sich in einer langen Reihe mal nach rechts, mal nach links, hielten dabei großen Abstand voneinander und sprangen in regelmäßiger Folge von Felswand zu Felswand, erklommen mal rutschige Kuppelkurven, gingen mal gemächlich an den Rändern von Abgründen entlang und blieben manchmal stehen, um von einem flachen Felsen auf mich herabzublicken, mit schräg gehaltenen Köpfen, als ob sie neugierig wären, was ich davon hielt oder ob ich ihnen folgen würde. Nachdem sie die Spitze der Wand erreicht hatten, die an dieser Stelle zwischen 1500 und 2000 Fuß hoch ist, waren sie noch immer gegen den Himmel zu sehen, als sie verweilten und in Gruppen von zwei oder drei herabblickten.
Während des gesamten Aufstiegs machten sie keinen einzigen unbeholfenen Schritt oder eine erfolglose Anstrengung irgendeiner Art. Ich habe oft gesehen, wie zahme Schafe in den Bergen auf eine abfallende Felsfläche sprangen, sich einige Sekunden zitternd festhielten und dann verwirrt und unentschlossen zurückfielen. Aber in den schwierigsten Situationen, in denen der geringste Mangel oder die geringste Ungenauigkeit tödlich gewesen wäre, schienen diese Schafe sich immer im bequemen Vertrauen auf ihre Kraft und Geschicklichkeit zu bewegen, deren Grenzen sie nie zu kennen schienen. Darüber hinaus kletterte jedes der Herdentiere, während es der Führung des Erfahrensten folgte, dennoch mit intelligenter Unabhängigkeit als vollkommenes Individuum, das zu einem eigenständigen Leben fähig war, wann immer es sich von der kleinen Sippe zurückziehen wollte oder musste. Das Hausschaf hingegen ist nur ein Bruchteil eines Tieres, da eine ganze Herde erforderlich ist, um ein Individuum zu bilden, so wie zahlreiche Blüten erforderlich sind, um eine vollständige Sonnenblume zu bilden.
Die Hirten, die im Sommer ihre Herden auf die Bergweiden treiben und sie Tag und Nacht bewachen und dabei sehen, wie sie von Bären und Stürmen aufgeschreckt und wie vom Wind getriebene Spreu auseinandergetrieben werden, werden bis zu einem gewissen Grad in der Lage sein, die Selbständigkeit, Stärke und edle Individualität der Schafe der Natur zu würdigen.
Wie der europäische Alpensteinbock soll sich unser Bergsteiger kopfüber steile Abgründe hinabstürzen und auf seinen großen Hörnern landen. Ich kenne nur zwei Jäger, die behaupten, dieses Kunststück tatsächlich miterlebt zu haben; ich hatte nie so viel Glück. Sie beschreiben die Tat als ein Kopfstoßen. Die Hörner sind an der Basis so groß, dass sie den oberen Teil des Kopfes fast bis auf Augenhöhe bedecken, und der Schädel ist außerordentlich stark. Ich habe ein altes, gebleichtes Exemplar auf dem Mount Ritter ein Dutzend Mal mit meinem Eispickel geschlagen, ohne es zu zerbrechen. Solche Schädel würden beim wildesten Felsstoßen nicht sehr leicht brechen, aber von anderen Knochen kann man kaum erwarten, dass sie bei einer solchen Leistung zusammenhalten; und die mechanischen Schwierigkeiten bei der Kontrolle ihrer Bewegungen nach dem Aufprall auf eine unregelmäßige Oberfläche reichen an sich aus, um zu zeigen, dass diese felsenartige Fortbewegungsmethode unmöglich ist, selbst wenn alle anderen Beweise hierzu fehlen; außerdem folgen die Schafe den Widdern, wohin sie auch führen, obwohl ihre Hörner nur aus Stacheln bestehen. Ich habe bei vielen Paaren von Hörnern alter Widder erhebliche Beschädigungen festgestellt, zweifellos infolge von Kämpfen. Diese Frage interessierte mich besonders, nachdem ich die Darbietungen dieser San Joaquin-Bande auf den vergletscherten Felsen am Fuße der Wasserfälle miterlebt hatte, und sobald ich mir Exemplare besorgt und ihre Füße untersucht hatte, war alles Mysterium verschwunden. Das Geheimnis, im Zusammenhang mit außergewöhnlich starken Muskeln betrachtet, ist einfach dies: Statt sich abzunutzen und platt und hart zu werden wie die Füße zahmer Schafe und Pferde, wölbt sich der breite hintere Teil der Hufsohle zu einem weichen, gummiartigen Polster oder Kissen, das nicht nur auf glatten Felsen gut greift und hält, sondern auch in kleine Vertiefungen und auf oder gegen leichte Vorsprünge passt. Sogar die härtesten Teile der Hufkante sind verhältnismäßig weich und elastisch; Darüber hinaus ermöglichen die Zehen eine außerordentliche seitliche und vertikale Bewegung, wodurch sich der Fuß noch besser an die Unebenheiten von Felsoberflächen anpassen kann und gleichzeitig die Griffkraft erhöht wird.
Am Fuße von Sheep Rock, einem der Winterquartiere der Shasta-Herden, lebt ein Viehzüchter, der das Glück hatte, jeden Winter die Bewegungen wilder Schafe beobachten zu können. Im Laufe eines Gesprächs mit ihm über ihre Tauchgewohnheiten zeigte er auf die Vorderseite einer etwa 150 Fuß hohen Lavazunge, die nur acht oder zehn Grad von der Senkrechten abweicht. „Da“, sagte er, „ich bin einer Gruppe von diesen Kerlen bis zur Rückseite des Felsens dort drüben gefolgt und dachte, ich könnte sie alle fangen, denn ich dachte, ich hätte ein totes Tier bei mir. Ich gelangte hinter sie auf eine schmale Bank, die an der Wand nahe der Spitze entlangläuft und an einem Ende endet, wo sie nicht entkommen konnten, ohne zu fallen und getötet zu werden. Aber sie sprangen ab und landeten unversehrt, als wäre das bei ihnen ganz normal.“
„Was!“, sagte ich, „ein 45 Meter hoher Sprung! Hast du gesehen, wie sie das gemacht haben?“
„Nein“, antwortete er, „ich habe sie nicht untergehen sehen, denn ich war hinter ihnen. Aber ich habe gesehen, wie sie über die Kante gingen, und dann bin ich nach unten gegangen und habe ihre Spuren dort gefunden, wo sie auf den losen Müll am Boden aufgelaufen waren. Sie sind einfach davongesegelt und mit der rechten Seite nach oben auf den Füßen gelandet. Das ist die Art von Tier, die sie sind – besser als alles andere, was auf vier Beinen läuft.“
WILDE SCHAFE SPRINGEN ÜBER EINEN ABGRUND.
Bei einer anderen Gelegenheit zog sich eine Herde, die von Jägern verfolgt wurde, an einen anderen Teil derselben Klippe zurück, der noch höher ist. Als sie verfolgt wurden, sahen zwei Männer, die gerade hackten und dabei eine gute Sicht auf sie hatten, sie in perfekter Ordnung hintereinander hinunterspringen und ihren Fortschritt vom oberen bis zum unteren Rand des Abgrunds verfolgen. Sowohl Schafe als auch Widder machten den furchtbaren Abstieg ohne außergewöhnliche Besorgnis, blieben dicht am Felsen und kontrollierten die Geschwindigkeit ihrer halb fallenden, halb springenden Bewegungen, indem sie in kurzen Abständen aufschlugen und sich mit ihren gepolsterten Gummifüßen auf kleinen Leisten und rauen Abhängen zurückhielten, bis sie fast unten waren, dann „segelten“ sie in die freie Luft und landeten auf ihren Füßen, aber mit ihren Körpern in einer so nahezu senkrechten Position, dass es aussah, als würden sie tauchen.
Es scheint daher, dass die Methoden dieses wilden Bergsteigens klar verständlich werden, sobald wir uns mit den Felsen und der Art der Füße und Muskeln vertraut machen, die auf ihnen zum Einsatz kommen.
Die Modoc- und Pah-Ute-Indianer sind oder waren die erfolgreichsten Jäger der wilden Schafe in den Regionen, die ich selbst beobachten konnte. Ich habe in den Höhlen des Mount Shasta und den Lavabetten der Modoc-Indianer, wo die Indianer bei stürmischem Wetter Festmahle hielten, große Mengen von Köpfen und Hörnern gesehen; auch in den Canyons der Sierra gegenüber von Owen’s Valley; und die schweren Pfeilspitzen aus Obsidian, die auf einigen der höchsten Gipfel gefunden wurden, zeigen, dass dieser Krieg schon lange andauert.
In den zugänglicheren Gebieten, die sich über die Wüstenregionen im Westen von Utah und Nevada erstrecken, jagten eine beträchtliche Anzahl von Indianern in Gruppen wie Wolfsrudel, und da sie mit der Topographie ihrer Jagdgründe sowie mit den Gewohnheiten und Instinkten des Wildes bestens vertraut waren, waren sie ziemlich erfolgreich. Auf den Gipfeln fast aller Berge in Nevada, die ich besucht habe, fand ich kleine, nestartige, aus Steinen gebaute Gehege, in denen, wie ich später erfuhr, ein oder mehrere Indianer auf der Lauer lagen, während ihre Gefährten die Bergrücken darunter absuchten, da sie wussten, dass die aufgeschreckten Schafe mit Sicherheit zum Gipfel rennen würden, und wenn sie durch den Wind näher herangetrieben werden konnten, wurden sie aus kurzer Entfernung erschossen.
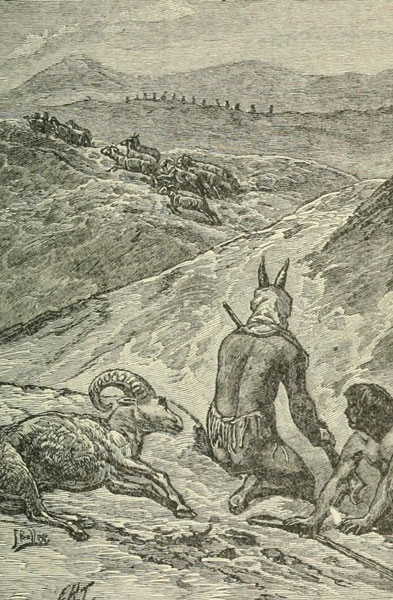
Noch größere Indianergruppen pflegten ausgedehnte Jagden auf einem von Schafen häufig besuchten Berg zu unternehmen, wie zum Beispiel Mount Grant auf der Wassuck Range westlich des Walker Lake. An einem bestimmten Ort, der günstig in Bezug auf die bekannten Schafpfade lag, bauten sie einen von hohen Mauern umgebenen Pferch mit langen Leitflügeln, die vom Tor abzweigten; und in diese Umzäunung gelang es ihnen manchmal, das edle Wild zu treiben. Natürlich waren große Mengen Indianer erforderlich, mehr, als sie normalerweise aufbringen konnten, wenn man Squaws, Kinder und alles andere mitzählte; sie waren daher gezwungen, Reihen von Scheinjägern aus Steinen entlang der Bergrücken zu bauen, die sie von den Schafen nicht überqueren lassen wollten. Und ohne die Scharfsinnigkeit des Wildes herabzusetzen, erwiesen sich diese Scheinjäger als wirksam; denn da einige lebendige Indianer aufgeregt zwischen ihnen umherliefen, konnte man sie aus kurzer Entfernung von niemandem, der nicht eingeweiht war, von Menschen unterscheiden. Der ganze Bergrücken schien dann von Jägern zu wimmeln.
Das einzige Tier, das man mit Fug und Recht als Gefährte oder Rivale der Schafe betrachten kann, ist die sogenannte Bergziege ( Aplocerus montana , Rich.), die, wie ihr Name schon sagt, mehr Antilope als Ziege ist. Auch sie ist ein tapferer und mutiger Kletterer, der furchtlos die wildesten Gipfel überquert und den schlimmsten Stürmen trotzt, aber sie ist zottig, hat kurze Beine und benimmt sich viel weniger würdevoll als die Schafe. Ihre pechschwarzen Hörner sind nur etwa fünf bis sechs Zoll lang, und das lange weiße Haar, mit dem sie bedeckt ist, verdeckt den Ausdruck ihrer Gliedmaßen. Ich habe in der Sierra noch nie ein einziges Exemplar gesehen, obwohl möglicherweise vor verhältnismäßig kurzer Zeit ein paar Herden auf dem Mount Shasta gelebt haben.
Die Gebiete dieser beiden Bergbewohner sind ziemlich unterschiedlich, und sie sehen sich nur wenig. Die Schafe sind meist auf die trockenen Berge im Landesinneren beschränkt, die Ziegen oder Gämsen auf die nassen, schneebedeckten, gletscherbedeckten Berge der Nordwestküste des Kontinents in Oregon, Washington, British Columbia und Alaska. Wahrscheinlich leben mehr als 200 von ihnen auf dem eisigen Vulkankegel des Mount Rainier. Während ich die Gletscher Alaskas erkundete, sah ich fast jeden Tag Herden dieser bewundernswerten Bergbewohner und folgte oft ihren Spuren durch das Labyrinth verwirrender Gletscherspalten, in denen sie hervorragende Führer sind.
In Kalifornien gibt es drei Hirscharten: den Schwarzwedelhirsch, den Weißwedelhirsch und den Maultierhirsch. Der erstgenannte (Cervus Columbianus) ist bei weitem der häufigste und begegnet den Schafen im Sommer gelegentlich auf hochgelegenen Gletscherwiesen und am Rand der Waldgrenze. Da er jedoch ein Waldtier ist, das Schutz sucht und seine Jungen in dichtem Dickicht aufzieht, besucht er die wilden Schafe in ihren höher gelegenen Lebensräumen selten. Die Antilope, obwohl kein Bergbewohner, wird im Winter gelegentlich von den Schafen angetroffen, wenn sie an den Rändern der Salbeiebenen und kahlen Vulkanhügel östlich der Sierra grasen. Dasselbe gilt für den Maultierhirsch, dessen Verbreitungsgebiet fast auf diese östliche Region beschränkt ist. Die Weißwedelhirschart gehört zu den Küstengebirgen.
Vielleicht ist kein wildes Tier der Welt ohne Feinde, aber die Hochlandbewohner haben als Klasse weniger Feinde als die Tieflandbewohner. Der schlaue Panther, der zwischen hohem Gras und Büschen herumhuscht und kauert, stürzt sich auf Antilopen und Hirsche, überquert aber selten die kahlen, schroffen Schwellen der Schafe. Auch die Bären können nicht als Feinde betrachtet werden; denn obwohl sie versuchen, ihre tägliche Ernährung aus Nüssen und Beeren durch eine gelegentliche Hammelmahlzeit zu variieren, jagen sie lieber zahme und hilflose Herden. Adler und Kojoten fangen zweifellos manchmal ein ungeschütztes Lamm oder ein unglückliches Tier, das in tiefem, weichem Schnee festsitzt, aber diese Fälle sind kaum mehr als Unfälle. Ebenso kommen einige in lang anhaltenden Schneestürmen um, obwohl ich während meiner gesamten Bergwanderungen nicht mehr als fünf oder sechs gefunden habe, die auf diese Weise ihr Schicksal ereilt zu haben schienen. Eine kleine Gruppe von drei Männern wurde vor einigen Jahren im Schnee im Bloody Canon entdeckt und von Bergsteigern, die zufällig im Winter die Bergkette überquerten, mit einer Axt erschlagen.
Der Mensch ist der gefährlichste aller Feinde, aber selbst vor ihm hat unser tapferer Bergbewohner in der abgelegenen Einsamkeit der High Sierra wenig zu befürchten. Die goldenen Ebenen von Sacramento und San Joaquin wimmelten vor kurzem noch von Elch- und Antilopenherden, aber da sie fruchtbar und zugänglich waren, wurden sie als Weideland für den Menschen benötigt. Das gilt auch für viele Futterplätze der Hirsche – Hügel, Täler, Wälder und Wiesen – aber es wird lange dauern, bis der Mensch den Schafen ihre Hochlandburgen wegnehmen wird. Und wenn wir bedenken, wie schnell ganze Arten edler Tiere wie Elche, Elche und Büffel an den Rand der Ausrottung gedrängt werden, werden sich alle Liebhaber der Wildnis mit mir über die felsige Sicherheit von Ovis montana freuen , dem tapfersten aller Bergbewohner der Sierra.
[1] Pacific Railroad Survey, Vol. VIII, Seite 678.
[2] Audubon und Bachmans „Quadrupeds of North America“.
Kapitel XV.
In den Vorgebirgen der Sierra
Murphy’s Camp ist eine merkwürdige alte Bergbaustadt im Calaveras County, 2400 Fuß über dem Meeresspiegel, wie ein Nest inmitten einer rauen, kiesigen und goldreichen Region gelegen. Granit, Schiefer, Lava, Kalkstein, Eisenerze, Quarzadern, goldhaltiger Kies, Überreste erloschener Feuerflüsse und erloschener Wasserflüsse werden hier in einem Umkreis von wenigen Meilen nebeneinander abgebaut und dem Studenten einladend wie ein Buch offen präsentiert, während die Menschen und die Region außerhalb des Camps Studiengruben von nie nachlassendem Interesse und Vielfalt bieten.
Als ich diesen merkwürdigen Ort entdeckte, verfolgte ich die Kanäle der alten voreiszeitlichen Flüsse, von denen die Bergleute hier und in den angrenzenden Regionen lehrreiche Abschnitte freigelegt haben. Flüsse, so die Dichter, „fließen ewig weiter“; die Flüsse der Sierra sind jedoch noch jung und haben den Weg zum Meer kaum gelernt; während mindestens eine Generation von ihnen zusammen mit den meisten Becken, die sie entwässerten, ausgestorben und verschwunden ist. Alles, was von ihnen übrig geblieben ist, um ihre Geschichte zu erzählen, ist eine Reihe unterbrochener Kanalfragmente, die größtenteils mit Kies verstopft und unter breiten, dicken Lavaschichten begraben sind. Diese sind als die „Toten Flüsse Kaliforniens“ bekannt, und der in ihnen abgelagerte Kies wird allgemein als „Blaues Blei“ bezeichnet. An einigen Stellen verlaufen die Kanäle der heutigen Flüsse in die gleiche oder fast gleiche Richtung wie die der alten Flüsse; im Allgemeinen gibt es jedoch wenig Übereinstimmung zwischen ihnen, da die gesamte Entwässerung geändert oder vielmehr neu geschaffen wurde. Viele der Hügel der alten Landschaften sind zu Senken geworden und die alten Senken sind zu Hügeln geworden. Daher kommen die fragmentarischen Kanäle mit ihrer Ladung goldhaltigen Kieses an allen möglichen, unerwarteten Stellen vor, verlaufen schräg oder sogar im rechten Winkel zum heutigen Wasserlauf über die Gipfel hoher Gebirgskämme oder weit darunter und sind eindrucksvolle Beispiele für das Ausmaß der Veränderungen, die sich seit der Vernichtung dieser alten Ströme vollzogen haben. Die letzte Vulkanperiode vor der Erneuerung der Sierra-Landschaften scheint im gesamten Gebirge fast gleichzeitig stattgefunden zu haben, wie die Eiszeit, obwohl Laven unterschiedlichen Alters an vielen Stellen gleichzeitig vorkommen, was auf zahlreiche Aktivitätsperioden in den Feuerquellen der Sierra hindeutet. Der wichtigste der alten Flusskanäle in dieser Region ist ein Abschnitt, der sich von der Südseite der Stadt unterhalb des Coyote Creek und des dahinter liegenden Gebirgskamms bis zum Cañon des Stanislaus erstreckt; aber aufgrund seiner Tiefe unter der allgemeinen Oberfläche der heutigen Täler können die dort bekannten reichen Goldkiese nicht leicht im großen Maßstab abgebaut werden. Ihr außerordentlicher Reichtum kann aus der Tatsache abgeleitet werden, dass viele Claims gewinnbringend abgebaut wurden, indem Schächte bis zu einer Tiefe von 200 Fuß oder mehr gegraben und der Schmutz mit einer Winde hochgehoben wurde. Sollte die Neigung dieses alten Kanals so groß sein, dass der Stanislaus Cañon als Deponie verfügbar wäre, könnte die große Lagerstätte mit der hydraulischen Methode abgebaut werden, und obwohl ein langer, teurer Tunnel erforderlich wäre, könnte sich das Vorhaben dennoch als profitabel erweisen, denn es stecken „Millionen darin“.
Die Bedeutung dieser alten Kiese als Goldquellen ist den Bergleuten wohlbekannt. Sogar die oberflächlichen Seifenlagerstätten der heutigen Flüsse haben einen Großteil ihres Goldes aus ihnen gewonnen. Allen Berichten zufolge waren die Seifenlagerstätten von Murphy sehr reich – „unglaublich reich“, wie man hier sagt. Die Hügel wurden abgetragen und skalpiert, jede Schlucht, jeder Graben und jedes Tal in Stücke gerissen und ausgeweidet, was eine wilde und verzweifelte Energie ausdrückt, die schwer zu verstehen ist. Dennoch ist jede Art von Anstrengung besser als Untätigkeit, und es hat etwas Erhabenes, Männer zu sehen, die todernst an irgendetwas arbeiten und ein Ziel mit gletscherartiger Energie und Beharrlichkeit verfolgen. So mancher tapfere Kerl hat ein höchst ereignisreiches Kapitel seines Lebens auf diesen Calaveras-Felsen geschrieben. Aber die meisten der Pionierbergleute schlafen jetzt, ihr wilder Tag ist vorbei, während die wenigen Überlebenden träge in den ausgewaschenen Schluchten oder verschlafenen Dörfern herumlungern wie gehetzte Bienen um die Ruinen ihres Bienenstocks. „Wir haben jetzt keine Industrie mehr„, erzählten sie mir, „und keine Menschen; jeder und alles hier ist verfallen. Wir sind nur noch ein paar Lakaien – aus dem Spiel, eine dünne Ansammlung armer, heruntergekommener Kerle, verglichen mit dem, was wir in den großen alten Goldtagen waren. Wir waren damals Riesen, und Sie können sich hier umsehen und unsere Spuren sehen.“ Aber obwohl diese zurückgebliebenen Pioniere vielleicht erschöpfter sind als die Minen und ungefähr so tot wie die toten Flüsse, sind sie doch eine seltene und interessante Gruppe von Menschen, mit viel Gold vermischt mit dem rauen, felsigen Kies ihres Charakters; und sie zeigen eine Erziehung und Intelligenz, die man in einer Umgebung wie der ihren kaum sucht. So wie das schwere, lang anhaltende Mahlen der Gletscher die Merkmale der Sierra hervorbrachte, so haben die intensiven Erfahrungen der Goldperiode die Merkmale dieser alten Bergleute hervorgebracht und eine Fülle und Vielfalt von Charakteren geformt, die bisher kaum bekannt sind. Die Skizzen von Bret Harte, Hayes und Miller haben dieses Feld keineswegs erschöpft. Es ist interessant, die Extreme zu beobachten, die in ein und demselben Charakter möglich sind: Härte und Sanftmut, Männlichkeit und Kindlichkeit, Apathie und wilder Eifer. Männer, die vor zwanzig Jahren nicht mit dem Schaufeln aufgehört hätten, um ihr Leben zu retten, spielen heute auf der Straße mit Kindern. Ihr langes, Micawber-artiges Warten nach der Erschöpfung der Seifen hat eine übertriebene Form von Senilität hervorgebracht. Ich hörte eine Gruppe muskulöser Pioniere auf der Straße eifrig darüber diskutieren, wie viel Schwanz man für einen Jungendrachen braucht; und ein Graubart machte sich an dem Spaß des Drachensteigens zu schaffen und gab freiwillig zu, dass er ein Junge sei, „immer ein Junge gewesen sei, und verdammt sei kein Mann, der innerlich kein Junge sei, wie alt er auch äußerlich sei!“ Bergwerke, Moral, Politik, die Unsterblichkeit der Seele usw. wurden unter schattigen Bäumen und in Kneipen diskutiert, wobei die Zeit für jedes Thema offenbar von der Temperatur abhing. Der Kontakt mit der Natur und die Beobachtungsgabe, die sie sich beim Goldsuchen angeeignet hatten, hatten sie alle bis zu einem gewissen Grad zu Sammlern gemacht, und wie Waldratten hatten sie alle möglichen merkwürdigen Exemplare in ihren Hütten gesammelt und verlangten nun von mir, sie zu untersuchen. Sie selbst waren die merkwürdigsten und interessantesten Exemplare. Einer von ihnen bot mir an, mir die alten Ausgrabungsstätten zu zeigen, und warnte mich vor der Abreise, dass ich ihn vielleicht nicht mögen würde, „weil“, sagte er, „die Leute sagen, ich sei exzentrisch. Ich bemerke alles und sammle Käfer und Schlangen und alles, was merkwürdig ist; deshalb mögen mich manche nicht und nennen mich exzentrisch. Ich versuche immer, Dinge herauszufinden. Nun, da ist ein Unkraut; die Indianer essen es als Grünzeug. Wie nennt man diese Fliegen mit dem langen Körper und den großen Köpfen?“ „Libellen“, schlug ich vor. „Nun, ihre Kiefer bewegen sich seitwärts, statt auf und ab, und die Kiefer der Heuschrecken bewegen sich auf die gleiche Weise, und deshalb glaube ich, dass sie zur selben Art gehören. Mir fällt so etwas immer auf und nur weil das so ist, sagen sie, ich sei exzentrisch“ usw.
Die guten Leute wollten unbedingt, dass ich keines der Wunder ihres alten Goldfeldes verpasse, und erzählten mir viel über die wunderbare Schönheit der Cave City Cave. Sie rieten mir, sie zu erkunden. Das tat ich sehr gern. Nachdem ich einen Führer gefunden hatte, der den Weg zum Eingang kannte, brach ich am nächsten Morgen von Murphy auf.
Die schönsten und ausgedehntesten Berghöhlen Kaliforniens liegen in einem Gürtel aus metamorphem Kalkstein, der sich ziemlich allgemein entlang der Westflanke der Sierra vom McCloud River im Norden bis zum Kaweah im Süden erstreckt, eine Entfernung von über 400 Meilen, in einer Höhe von 2000 bis 7000 Fuß über dem Meeresspiegel. Außer diesem regelmäßigen Höhlengürtel ist die kalifornische Landschaft abwechslungsreich gestaltet durch lange, imposante Reihen von Meereshöhlen, zerklüftet und in unterschiedlicher Architektur, die durch Jahrhunderte der Wellenbewegung in die Küstenvorsprünge und Steilküsten gegraben wurden; und durch unzählige große und kleine Lavahöhlen, die durch das ungleichmäßige Fließen und Verhärten der Lavaschichten entstanden sind, in denen sie vorkommen und die in den berühmten Modoc Lava Beds und rund um die Basis des eisigen Shasta schöne Beispiele dafür bieten. Bei diesem umfassenden Blick können wir auch die flachen, vom Wind erodierten Höhlen in geschichteten Sandsteinen entlang der Ränder der Ebenen bemerken; und die höhlenartigen Nischen in den Schiefer- und Granitsteinen der Sierra, in denen Bären und andere Bergbewohner bei plötzlichen Stürmen Schutz finden. Im Allgemeinen ist die gewaltige Hebung der Sierra, soweit sie bisher beobachtet werden konnte, ungefähr so fest und höhlenlos wie ein Felsbrocken.
Frische Schönheit öffnet einem die Augen, wo immer man sie wirklich sieht, aber die Fülle und Vollständigkeit der alltäglichen Schönheit, die uns umgibt, verhindert, dass wir sie aufnehmen und würdigen. Es ist daher gut, ab und zu kurze Ausflüge auf den Meeresgrund zwischen Lappentang und Korallen zu machen, oder hinauf in die Wolken auf Berggipfel oder in Ballons, oder sogar wie Würmer in dunkle Löcher und Höhlen unter der Erde zu kriechen, nicht nur um etwas darüber zu erfahren, was an diesen abgelegenen Orten vor sich geht, sondern auch um besser zu sehen, was die Sonne sieht, wenn wir zur alltäglichen Schönheit zurückkehren.
Unser Weg von Murphy’s zur Höhle führte über eine Reihe malerischer, mooriger Bergrücken in der Chaparral-Region zwischen den braunen Vorgebirgen und den Wäldern, eine blühende Strecke rollender Hügelwellen, die sich hier und da auf den höheren Gipfeln zu einer Art felsigem Schaum brachen und in entzückende, von Weinreben umrankte Waldmulden versanken. Der Tag war ein schönes Beispiel für einen kalifornischen Sommer, reiner Sonnenschein, die meiste Zeit nicht von einer einzigen Wolke beschattet. Als die Sonne höher stieg, begann die heiße Luft in zitternden Wellen von jedem Südhang herüberzuströmen. Die Meeresbrise, die normalerweise zu dieser Jahreszeit die Vorgebirge heraufweht und ihre Flügel kühlt, war kaum wahrnehmbar. Die Vögel versammelten sich im Schatten der Blätter oder machten kurze, träge Flüge auf der Suche nach Nahrung, alle außer dem majestätischen Bussard; mit ausgebreiteten Flügeln segelte er unermüdlich durch die warme Luft von Bergrücken zu Bergrücken und schien den glühenden Sonnenschein wie ein Schmetterling zu genießen. Auch Eichhörnchen, deren würzige Leidenschaft weder Hitze noch Kälte erlahmen ließ, sammelten Nüsse zwischen den Kiefern, und die unzähligen Heerscharen des Insektenreichs pulsierten und zitterten unermüdlich wie Sonnenstrahlen.
Diese buschige, beerenreiche Region war einst eine Hirsch- und Bärenweide, aber seit den Unruhen der Goldzeit sind diese prächtigen Tiere fast vollständig verschwunden. Hier streunten einst auch Mastodonten und Elefanten umher, deren Knochen im Flusskies und unter dicken Lavafalten begraben gefunden wurden. Gegen Mittag, als wir langsam über Ufer und Hügel ritten und uns in der nicht fieberhaften Hitze der Sonne aalten, wurden wir Zeugen des Aufkommens einer neuen Bergkette, einer Sierra aus Wolken, die voller Landschaften ist, die wahrhaft erhaben und schön sind – wenn wir nur den Verstand haben, so zu denken und Augen, um zu sehen – wie die ältere felsige Sierra darunter mit ihren Wäldern und Wasserfällen; sie erinnert uns daran, dass es, so wie es eine untere Welt der Höhlen gibt, auch eine obere Welt der Wolken gibt. Mit erstaunlicher Geschwindigkeit entwickelten sich aus bloßen Knospen riesige, wölbige Cumuli, die mit sichtbarer Bewegung zu kolossalen Bergen anschwollen und sich in langen, massiven Gebirgszügen immer höher auftürmten, Spitze um Spitze, Kuppel um Kuppel, mit vielen malerischen Tälern und schattigen Höhlen dazwischen; während sich die dunklen Tannen und Kiefern der oberen Ausläufer der Sierra mit exquisiter Klarheit der Umrisse gegen ihre perlenartigen Buckel abhoben. Diese Wolkenberge verschwanden im Azurblau ebenso schnell, wie sie sich gebildet hatten, und hinterließen keinen Schutt; aber sie waren deshalb nicht weniger real oder interessant. Die dauerhafteren Hügel, über die wir ritten, verschwanden ebenso sicher wie sie, nur nicht so schnell, ein Unterschied, der je nach dem Standpunkt, von dem aus man ihn betrachtet, groß oder klein ist.
Am Grund jedes Tals fanden wir kleine Gehöfte, umgeben von wildem Gestrüpp und Weinreben, wo auch immer der Rückgang der Hügel Flecken von Ackerland hinterlassen hatte. Diese abgeschiedenen Ebenen werden hauptsächlich von Italienern und Deutschen besiedelt, die zu unterschiedlichen Zeiten ein paar Gemüsesorten und Weinreben anbauen, während ihr Hauptgeschäft Bergbau und Prospektion ist. Trotz all der natürlichen Schönheit dieser Talhütten kann man sie kaum als Heime bezeichnen. Sie sind nur eine bessere Art von Lager, das gerne verlassen wird, wenn die erhoffte Goldernte eingefahren ist. Die besten von ihnen strahlen eine Atmosphäre tiefer Unruhe und Melancholie aus. Ihre Schönheit verdanken sie der üppigen Natur, abgesehen davon bestehen sie nur aus ein paar grob zusammengefügten Baumstämmen und Brettern ohne Decke oder Boden, einer einfachen Feuerstelle mit den entsprechenden Kochutensilien, einem Regalbett und einem Hocker. Der Boden um sie herum ist übersät mit verbeulten Prospektionspfannen, Spitzhacken, Schleusenkästen und Quarzproben von so manchem Felsvorsprung, die vom harten Leben ihrer Besitzer zeugen.
Die Fahrt von Murphy’s zur Höhle dauert kaum zwei Stunden, aber wir blieben bis weit nach Mittag zwischen Quarzvorsprüngen und Ufern aus totem Flusskies. Als wir schließlich aus einer schmalen Schlucht auftauchten, kam ein kleines Haus in Sicht, das in einem Dickicht aus Feigenbäumen am Fuße eines Kalksteinhügels stand. „Das“, sagte mein Führer und zeigte auf das Haus, „ist Cave City, und die Höhle befindet sich in diesem grauen Hügel.“ Als wir das einzige Haus dieser Ein-Haus-Stadt erreichten, wurden wir von drei betrunkenen Männern, die in die Stadt gekommen waren, um einen Saufgelage zu veranstalten, ausgelassen begrüßt. Die Hausherrin versuchte, für Ordnung zu sorgen, und teilte uns auf unsere Fragen mit, dass der Höhlenführer gerade mit einer Gruppe von Damen in der Höhle sei. „Und müssen wir warten, bis er zurückkommt?“, fragten wir. Nein, das war unnötig; wir konnten Kerzen mitnehmen und allein in die Höhle gehen, vorausgesetzt, wir riefen von Zeit zu Zeit, damit der Führer uns fand, und achteten darauf, nicht über die Felsen oder in die dunklen Tümpel zu fallen. Wir nahmen also einen Pfad vom Haus und wurden um den Fuß des Hügels herum zum Eingang der Höhle geführt, einem kleinen, unscheinbaren Torbogen, der an den Rändern mit Moos bedeckt war und die Form der Tür eines Wasseramselnests hatte, ohne nennenswerte Hinweise oder Hinweise auf die Erhabenheit der vielen Kristallkammern im Inneren. Wir zündeten unsere Kerzen an, die in der dichten Dunkelheit keine Leuchtkraft zu haben schienen, und tasteten uns so gut es ging durch schmale Gassen und Gassen von Kammer zu Kammer, um rustikale Säulen und Haufen herabgefallener Steine herum, und machten ab und zu an besonders schönen Orten Halt, um auszuruhen – märchenhaften Nischen, die mit einer bewundernswerten Vielfalt an Regalen und Tischen und runden, steilen Stühlen ausgestattet waren, die mit funkelnden Kristallen bedeckt waren. Einige der Korridore waren schlammig, und als wir durch sie stapften, hatten wir das Gefühl, uns in den Straßen eines Präriedorfs im Frühling zu befinden. Dann kamen wir zu schönen Marmortreppen, die rechts und links in obere Kammern führten, die drei oder vier Stockwerke hoch übereinander lagen und deren Böden, Decken und Wände üppig mit unzähligen kristallinen Formen verziert waren. Nachdem wir so etwa eine Meile lang allein und ziemlich verzaubert umhergewandert waren, verriet uns ein Stimmengewirr und ein Lichtschimmer die Annäherung des Führers und seiner Gruppe, von denen wir, als sie heraufkamen, einen herzlichen und natürlichen Blick erhielten, während wir halb verborgen in einer Seitennische zwischen Stalagmiten standen. Ich wagte es, die triefende, hockende Gesellschaft zu fragen, wie ihnen ihr Spaziergang gefallen hatte, denn ich wollte unbedingt erfahren, welchen Eindruck die seltsame sonnenlose Landschaft der Unterwelt auf sie gemacht hatte. „Ah, es ist schön! Es ist großartig!“, antworteten und wiederholten sie alle. „Die Brautkammer hier hinten ist einfach herrlich! Heute Morgen kamen wir vom Calaveras Big Tree Grove herunter, und die Bäume sind nichts im Vergleich dazu.“ Nach diesem merkwürdigen Vergleich eilten sie der Sonne entgegen. Der Führer versprach, uns bald am Ufer eines tiefen Teiches zu treffen.wo wir auf ihn warten sollten. Dies ist ein bezaubernder kleiner See von unbekannter Tiefe, der noch nie von einer Brise bewegt wurde, und seine ewige Ruhe regt die Fantasie noch stärker an als die silbernen Seen der Gletscher, die von Wiesen und Schnee gesäumt sind und erhabene Berge widerspiegeln.
Unser Führer, ein lustiger, ausgelassener Italiener, führte uns ins Herz des Hügels, auf und ab, rechts und links, von einer immer prächtigeren Kammer zu einer immer prächtigeren, alles glitzernd wie eine Gletscherhöhle mit eiszapfenartigen Stalaktiten und Stalagmiten, die sich zu Formen von unbeschreiblicher Schönheit zusammenfügten. Man zeigte uns einen großen Raum, der gelegentlich als Tanzsaal genutzt wurde; einen anderen, der als Kapelle genutzt wurde, mit natürlicher Kanzel und Kreuzen und Kirchenbänken, in jedem Stein Predigten, wo ein Priester die Messe gelesen hatte. Das Lesen der Messe ist im Zusammenhang mit Naturwundern nicht so weit verbreitet wie das Tanzen. Eine der ersten Ideen, die die riesigen Sequoias hervorriefen, war, einen von ihnen zu fällen und auf seinem Stumpf zu tanzen. Wir haben auch Tanz in der Gischt des Niagara gesehen; Tanz in der berühmten Bower Cave oberhalb von Coulterville; und nirgends habe ich so viel Tanz gesehen wie in Yosemite. Ein Tanz auf dem unzugänglichen Süddom würde wahrscheinlich der Errichtung eines einfachen Weges zur Spitze folgen.
Es war herrlich, hier die unendliche Bedächtigkeit der Natur und die Einfachheit ihrer Methoden bei der Erzielung solch gewaltiger Ergebnisse zu beobachten, eine solch vollkommene Ruhe gepaart mit rastloser, enthusiastischer Energie. Obwohl es kalt und blutleer wie eine Landschaft aus Polareis war, wurde im Dunkeln mit unaufhörlicher Aktivität gebaut. Die Torbögen und Decken waren überall mit herabwachsenden Kristallen behangen, wie umgekehrte Haine blattloser Setzlinge, einige von ihnen groß, andere zart verjüngt, jeder mit einem einzigen Wassertropfen gekrönt, wie die Endknospe einer Kiefer. Die einzigen wahrnehmbaren Geräusche waren das Tropfen und Plätschern von Wasser, das in Pfützen floss oder leise auf den Kristallböden plätscherte.
An einigen Stellen sind die Kristalldekorationen in anmutig fließenden Falten angeordnet, die wie steife, seidene Vorhänge tief verflochten sind. An anderen Stellen sind gerade Linien der normalen Stalaktitenformen hinsichtlich Größe und Ton in einem regelmäßig abgestuften System kombiniert, wie die Saiten einer Harfe mit entsprechenden Musiktönen; und auf diesen Steinharfen spielten wir, indem wir mit einem Stock auf die Kristallsaiten schlugen. Die köstlichen, flüssigen Töne, die sie von sich gaben, schienen absolut göttlich, wenn sie süß durch die majestätischen Hallen flüsterten und schwankten und in schwächster Kadenz verklangen – die Musik des Märchenlandes. Hier verweilten wir und schwelgten, freuten uns, so viel Musik in steinerner Stille zu finden, so viel Pracht in der Dunkelheit, so viele Villen in den Tiefen der Berge, Gebäude, die immer im Bau waren und doch nie fertiggestellt wurden, sich von Vollkommenheit zu Vollkommenheit entwickelten, Üppigkeit ohne Überfluss; jedes sichtbare oder unsichtbare Teilchen in herrlicher Bewegung, marschiert zur Sphärenmusik in einer Region, die als Wohnort ewiger Stille und des Todes gilt.
Die äußeren Kammern von Berghöhlen werden häufig von wilden Tieren als Behausung gewählt. In der Sierra scheinen sie jedoch Behausungen und Verstecke im Chaparral und unter steilen Abhängen zu bevorzugen, da ich in keiner der Höhlen jemals ihre Spuren gesehen habe. Das ist umso bemerkenswerter, da sie trotz der Dunkelheit und des sickernden Wassers nichts unangenehm Kellerartiges oder Grabesartiges an sich haben.
Als wir in die strahlende Landschaft der Sonne hinaustraten, sah alles heller aus, und wir fühlten, wie unser Glaube an die Schönheit der Natur gestärkt wurde. Wir erkannten deutlicher, dass Schönheit universell und unsterblich ist, oben und unten, an Land und im Meer, in den Bergen und auf der Ebene, bei Hitze und Kälte, bei Licht und Dunkelheit.
KAPITEL XVI
DIE BIENENWEIDE
Als Kalifornien noch wild war, war es auf seiner gesamten Länge, im Norden und im Süden, und von der schneebedeckten Sierra bis hin zum Meer ein einziger süßer Bienengarten.
Wohin auch immer eine Biene innerhalb dieser unberührten Wildnis fliegen mochte – durch die Redwood-Wälder, entlang der Flussufer, entlang der Steilküsten und Landzungen gegenüber dem Meer, über Täler und Ebenen, Parks und Wäldchen und tiefe, laubbedeckte Täler oder weit hinauf auf die kieferbewachsenen Berghänge – in jedem Klimagürtel und -abschnitt bis zur Baumgrenze blühten Bienenblumen in üppiger Fülle. Hier wuchsen sie mehr oder weniger vereinzelt in besonderen Flächen und Flecken von nicht allzu großer Größe, dort in breiten, fließenden Falten von Hunderten von Meilen Länge – Zonen pollenreicher Wälder, Zonen blühender Chaparral, Bachgewirr aus Rubus und Wildrosen, Flächen goldener Korbblütler, Veilchenbeete, Minzbeete, Bryonen- und Kleebeete und so weiter, wobei bestimmte Arten das ganze Jahr über irgendwo blühen.
Doch in den letzten Jahren haben Pflüge und Schafe diese herrlichen Weiden verwüstet, Zehntausende dieser blühenden Hektar wie ein Feuer vernichtet und viele Arten der besten Honigpflanzen auf felsige Klippen und in Zaunecken verbannt, während andererseits der Anbau bisher keinen angemessenen Ersatz, zumindest nicht in Form von Naturalien, geboten hat: nur Hektar von Luzerne auf kilometerlangen üppigsten Wildweiden, Zierrosen und Geißblatt um die Haustüren statt Kaskaden von Wildrosen in den Tälern und kleine, quadratische Obstgärten und Orangenhaine statt breiter Berggürtel aus Chaparral.
Die Great Central Plain von Kalifornien war in den Monaten März, April und Mai ein einziges glattes, durchgehendes Bett aus Honigblüten, so wunderbar üppig, dass man beim Gehen von einem Ende zum anderen, eine Entfernung von mehr als 400 Meilen, mit jedem Schritt etwa hundert Blumen zertrampeln würde. Minzen, Gilias, Nemophilas, Castilleias und unzählige Korbblütler standen so dicht beieinander, dass, wären 99 Prozent davon weg, die Ebene jedem außer den Kaliforniern immer noch als üppig blühend erschienen wäre. Die strahlenden, honigfarbenen Blütenkronen, die sich berührten und überlappten und übereinander ragten, leuchteten im lebendigen Licht wie ein Sonnenuntergangshimmel – ein Blatt aus Purpur und Gold, durch das der helle Sacramento von Norden her strömte, der San Joaquin von Süden, und ihre vielen Nebenflüsse, die im rechten Winkel von den Bergen her einströmten und die Ebene in von Bäumen gesäumte Abschnitte teilten.
Entlang der Flüsse gibt es einen Streifen Auenland, der unter das allgemeine Niveau abgesenkt ist und sich zu den Vorbergen hin verbreitert, wo prächtige Eichen mit einem Durchmesser von drei bis acht Fuß wohltuenden Schatten auf die offenen, prärieähnlichen Ebenen werfen. Und dicht am Wasserrand gab es einen schönen Dschungel tropischer Üppigkeit, bestehend aus Wildrosen- und Brombeerbüschen und einer großen Vielfalt an Kletterpflanzen, die die Äste und Stämme von Weiden und Erlen umkränzten und verflochten und sich in schweren Girlanden von Gipfel zu Gipfel schwangen. Hier schwelgten die wilden Bienen in der frischen Blüte, lange nachdem die Blumen der trockeneren Ebene verwelkt und verdorrt waren. Und im Hochsommer, wenn die „Brombeeren“ reif waren, kamen die Indianer aus den Bergen zum Fest – Männer, Frauen und Babys in langen, lauten Zügen, oft begleitet von den Bauern der Nachbarschaft, die diese wilden Früchte mit lobenswerter Wertschätzung ihres hervorragenden Geschmacks sammelten, während ihre Obstgärten voller reifer Pfirsiche, Aprikosen, Nektarinen und Feigen waren und ihre Weinberge mit Trauben beladen. Aber obwohl sich diese üppigen, struppigen Flussbetten so von der glatten, baumlosen Ebene abhoben, bildeten sie im Gesamtbild keine scharfen Trennlinien. Das Ganze erschien als eine einzige durchgehende Blütenfläche, die nur von den Bergen begrenzt wurde.
Als ich diesen zentralen Garten, die ausgedehnteste und regelmäßigste aller Bienenweiden des Staates, zum ersten Mal sah, erschien er mir wie eine einzige Fläche aus Pflanzengold, die verschwommen in der Ferne verschwand und sich deutlich wie eine neue Landkarte entlang der Hügelausläufer zu meinen Füßen abzeichnete.
Ich stieg die Osthänge der Küstenkette hinab, durch Wäldchen aus Gilias und Lupinen und um viele windige Hügel und buschbewachsene Landzungen herum, und watete schließlich mitten hinein. Der ganze Boden war nicht mit Gras und grünen Blättern bedeckt, sondern mit leuchtenden Blütenkronen, die am Fuß der Hügel etwa knöcheltief und fünf bis sechs Meilen weiter knietief oder mehr reichten. Hier wuchsen Bahia, Madia, Madaria, Burrielia, Chrysopsis, Corethrogyne, Grindelia usw. in dichten Gruppen in verschiedenen Gelbtönen, die sich wunderbar mit den Purpurtönen von Clarkia, Orthocarpus und Oenothera vermischten, deren zarte Blütenblätter die lebenswichtigen Sonnenstrahlen tranken, ohne ein funkelndes Leuchten abzugeben.
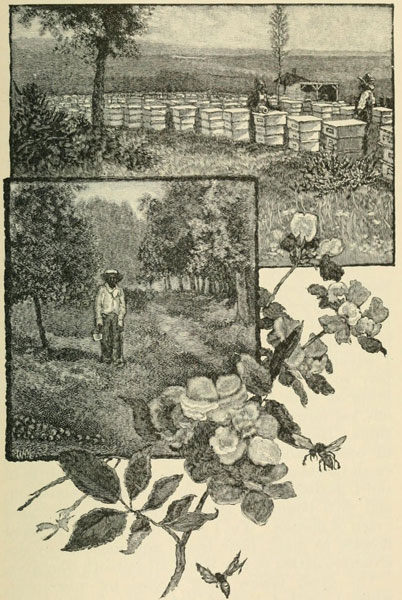
Weil auf die Regenzeit eine so lange Periode extremer Dürre folgt, besteht die Vegetation größtenteils aus einjährigen Pflanzen, die gleichzeitig austreiben und gemeinsam in etwa gleicher Höhe über dem Boden blühen. Die allgemeine Oberfläche wird nur leicht von den größeren Phacelia, Pentstemon und Gruppen von Salvia carduacea , dem König der Minzen, gekräuselt.
Egal in welche Richtung ich schlenderte, bei jedem Schritt streiften Hunderte dieser fröhlichen Sonnenpflanzen meine Füße und schlossen sich über sie, als wate ich durch flüssiges Gold. Die Luft war süß von Duft, die Lerchen sangen ihre gesegneten Lieder, erhoben sich, als ich vorwärtsging, und versanken dann außer Sichtweite im pollenbedeckten Gras, während Myriaden wilder Bienen die untere Luft mit ihrem monotonen Summen aufwirbelten – monoton, aber immer frisch und süß wie der Sonnenschein des Alltags. Hasen und Spermienfresser zeigten sich in beträchtlicher Zahl an seichten Stellen, und kleine Herden von Antilopen waren fast ständig in Sicht, die neugierig von einer kleinen Anhöhe aus blickten und dann mit unvergleichlicher Anmut der Bewegung schnell davonsprangen. Doch ich konnte keine zerquetschten Blumen entdecken, die ihre Spur markiert hätten, und auch keine zerstörerische Wirkung irgendeines wilden Fußes oder Zahns.
Die großen gelben Tage zogen ungezählt vorbei, während ich nach Norden trieb und die zahllosen Lebensformen beobachtete, die sich um mich drängten und sich bei Einbruch der Nacht fast überall niederließen. Und was für herrliche botanische Beete ich hatte! Oftmals fand ich beim Aufwachen mehrere neue Arten, die sich über mich beugten und mir direkt ins Gesicht schauten, sodass ich schon vor dem Aufstehen mit meinen Studien beginnen konnte.
Etwa am ersten Mai wandte ich mich nach Osten und überquerte den San Joaquin River zwischen der Mündung des Tuolumne und des Merced. Als ich die Ausläufer der Sierra erreichte, war die Vegetation größtenteils verwildert und so trocken wie Heu.
Alle Jahreszeiten der großen Ebene sind warm oder gemäßigt, und Bienenblüten fehlen nie ganz; aber der große Frühling – die jährliche Wiederauferstehung – wird von den Regenfällen bestimmt, die normalerweise etwa Mitte November oder Anfang Dezember einsetzen. Dann entfalten die Samen, die sechs Monate lang trocken und frisch auf dem Boden gelegen haben, als wären sie in Scheunen gesammelt worden, sofort ihr kostbares Leben. Das allgemeine Braun und Violett des Bodens und die tote Vegetation des Vorjahres weichen dem Grün von Moosen und Lebermoosen und Myriaden junger Blätter. Dann beginnt eine Art nach der anderen zu blühen und überzieht das Grün allmählich mit Gelb und Violett, was bis Mai anhält.
Die „Regenzeit“ ist keineswegs eine düstere, feuchte Zeit mit ständiger Bewölkung und Regen. Vielleicht nirgendwo sonst in Nordamerika, vielleicht auf der Welt, sind die Monate Dezember, Januar, Februar und März so voll von mildem, pflanzenbaulichem Sonnenschein. Wenn ich meine Aufzeichnungen über den Winter und Frühling 1868-69 betrachte, die ich jeden Tag im Freien verbrachte, in diesem Teil der Ebene zwischen den Flüssen Tuolumne und Merced, stelle ich fest, dass der erste Regen der Saison am 18. Dezember fiel. Der Januar hatte nur sechs Regentage – das heißt Tage, an denen es regnete: drei Februar, fünf März, drei April und drei Mai, womit die sogenannte Regenzeit, die ungefähr durchschnittlich war, abgeschlossen war. Die gewöhnlichen Regenstürme dieser Region sind selten sehr kalt oder heftig. Die Winde, die bei beständigem Wetter aus Nordwesten kommen, drehen in die entgegengesetzte Richtung, der Himmel füllt sich allmählich und gleichmäßig mit einer einzigen Wolke, aus der der Regen bei einer Temperatur von etwa 45 bis 50 Grad stetig fällt, oft tagelang hintereinander.
Mehr als 75 Prozent des gesamten Regens dieser Saison kamen aus Nordwesten, die Küste entlang über Südostalaska, British Columbia, Washington und Oregon, obwohl die lokalen Winde dieser kreisförmigen Stürme aus Südosten wehen. Ein prächtiger lokaler Sturm aus Nordwesten fiel am 21. März. Eine massive, rundbrauige Wolke schwoll an und donnerte in imposanter Majestät über die Blumenebene, ihre steile Front leuchtete weiß und violett im vollen Sonnenlicht, während warmer Regen wie ein Wasserfall aus seinen üppigen Fontänen strömte, Blumen und Bienen niederschlug und die trockenen Wasserläufe so plötzlich überschwemmte, wie die in Nevada von den sogenannten „Wolkenbrüchen“ überschwemmt werden. Aber in weniger als einer halben Stunde war keine Spur der schweren, bergartigen Wolkenstruktur mehr am Himmel zu sehen, und die Bienen flogen los, als hätte man ihnen nichts Erfrischenderes schicken können.
Ende Januar blühten vier Pflanzenarten, und fünf oder sechs Moosarten hatten bereits ihre Hauben angepasst und standen in voller Blüte; aber die Blüten waren noch nicht zahlreich genug, um das allgemeine Grün der jungen Blätter stark zu beeinflussen. Veilchen kamen in der ersten Februarwoche zum Vorschein, und gegen Ende dieses Monats waren die wärmeren Teile der Ebene bereits von Myriaden von Blüten der Strahlenkorbblütler golden gefärbt.
Es war Frühling in Hülle und Fülle. Der Sonnenschein wurde wärmer und intensiver, jeden Tag blühten neue Pflanzen; die Luft wurde melodischer vom Summen der Flügel und süßer vom Duft der sich öffnenden Blumen. Ameisen und Erdhörnchen bereiteten sich auf ihre Sommerarbeit vor, rieben ihre tauben Glieder und sonnten sich auf den Hülsenhaufen vor ihren Türen, und Spinnen waren eifrig damit beschäftigt, ihre alten Netze zu flicken oder neue zu weben.
Im März hatte sich die Vegetation in Bezug auf Tiefe und Farbe mehr als verdoppelt: Claytonia, Calandrinia, eine große weiße Gilia und zwei Nemophila blühten zusammen mit einer Vielzahl gelber Korbblütler, die mittlerweile hoch genug sind, um sich im Wind zu biegen und schwankende Schattenwellen zu werfen.
Im April erreichte die Pflanzenwelt insgesamt ihren Höhepunkt und die Ebene war auf ihrer gesamten abwechslungsreichen Oberfläche mit einem dichten, pelzigen Plüsch aus violetten und goldenen Blütenkronen bedeckt. Bis zum Ende dieses Monats waren die Samen der meisten Arten gereift, aber die zahlreichen kronenartigen Hüllblätter und Wirbel aus Spreuschuppen der Korbblütler schienen noch unverdorben in Blüte zu stehen. Im Mai fanden die Bienen nur wenige tiefliegende Liliengewächse und Gallertgewächse in Blüte.
Juni, Juli, August und September sind die Jahreszeiten der Ruhe und des Schlafs – ein Winter voller trockener Hitze –, auf den im Oktober eine zweite Blütenpracht in der trockensten Zeit des Jahres folgt. Dann, nachdem die geschrumpfte Masse aus Blättern und Stängeln der abgestorbenen Vegetation zerfällt und unter unseren Füßen zu Staub zerfällt, als wäre sie im Ofen gebacken worden, erscheint plötzlich Hemizonia virgata , eine schlanke, unauffällige kleine Pflanze, 15 bis 90 cm hoch, in kilometerweiten Flecken, wie eine Wiederauferstehung der Aprilblüte. Ich habe über 3000 Blüten mit einem Durchmesser von 14 mm an einer einzigen Pflanze gezählt. Sowohl ihre Blätter als auch ihre Stängel sind so schlank, dass sie aus einer Entfernung von wenigen Metern inmitten dieser auffälligen Vielzahl von Blüten fast unsichtbar sind. Die Strahlen- und die Scheibenblüten sind beide gelb, die Staubblätter violett, und die Beschaffenheit der Strahlen ist kräftig und samtig, wie die Blütenblätter von Gartenstiefmütterchen. Der vorherrschende Wind dreht alle Köpfe nach Südosten, so dass wir in Richtung Nordwesten blicken und die Blumen uns direkt anschauen. Meiner Meinung nach ist diese kleine Pflanze, die letzte der prächtigen Schar der Korbblütler, die die Ebene verschönern, die interessanteste von allen. Sie blüht bis November und verbindet sich mit zwei oder drei Arten drahtiger Wollmispeln, die die Blütenkette um Dezember herum bis zu den Frühlingsblumen im Januar fortsetzen. Obwohl die Hauptblüte- und Honigsaison also nur etwa drei Monate dauert, wird der Blütenkreis, so schmal er auch in einigen der heißen, regenlosen Monate sein mag, nie ganz unterbrochen.
Wie lange die verschiedenen Arten wilder Bienen in diesem Honiggarten gelebt haben, weiß niemand; wahrscheinlich seit der Großteil der heutigen Flora gegen Ende der Eiszeit das Land eroberte. Die ersten braunen Honigbienen, die nach Kalifornien gebracht wurden, sollen im März 1853 in San Francisco eingetroffen sein. Ein Imker namens Shelton kaufte von jemandem in Aspinwall, der sie aus New York mitgebracht hatte, eine Partie mit zwölf Schwärmen. Als sie in San Francisco ankamen, enthielten alle Stöcke lebende Bienen, aber schließlich schrumpfte ihre Zahl auf einen einzigen Stock, der nach San José gebracht wurde. Die kleinen Einwanderer gediehen und vermehrten sich auf den fruchtbaren Weiden des Santa Clara Valley und schickten in der ersten Saison drei Schwärme ins Land. Der Besitzer kam kurz darauf ums Leben und bei der Regelung seines Nachlasses wurden zwei der Schwärme für 105 bzw. 110 Dollar versteigert. Von Zeit zu Zeit wurden auch andere Bienen über den Isthmus importiert, und obwohl man sich große Mühe gab, den Erfolg zu gewährleisten, starb etwa die Hälfte der Bienen auf dem Weg. 1859 wurden vier Bienenschwärme sicher über die Ebenen gebracht. Die Bienenstöcke wurden im hinteren Teil eines Wagens untergebracht, der nachmittags angehalten wurde, damit die Bienen fliegen und an den blumenreichsten Orten, die erreichbar waren, Nahrung suchen konnten, bis die Bienenstöcke bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen wurden.
Im Jahr 1855, zwei Jahre nach der Zeit der ersten Ankömmlinge aus New York, wurde ein einzelner Schwarm aus San José herübergebracht und in der Great Central Plain freigelassen. Die Bienenzucht hat hier jedoch nie viel Aufmerksamkeit erlangt, trotz der außerordentlichen Fülle an Honigblüten und des hohen Honigpreises in den ersten Jahren. Hier und da findet man ein paar Bienenstöcke bei Siedlern, die zufällig etwas über das Geschäft gelernt haben, bevor sie in den Staat kamen. Aber Schaf-, Rinder-, Getreide- und Obstanbau sind die Haupterwerbszweige, da sie weniger Geschick und Sorgfalt erfordern, während die Gewinne bisher höher waren. Im Jahr 1856 wurde Honig hier für eineinhalb bis zwei Dollar pro Pfund verkauft. Zwölf Jahre später war der Preis auf zwölfeinhalb Cent gefallen. 1868 saß ich mit einer Gruppe ausgehungerter Schafscherer auf einer Ranch am San Joaquin zum Abendessen, wo fünfzehn oder zwanzig Bienenstöcke gehalten wurden, und unser Gastgeber riet uns, die große Pfanne Honig, die er auf den Tisch gestellt hatte, nicht zu schonen, da dies das billigste Produkt war, das er anbieten konnte. Auf all meinen Spaziergängen bin ich jedoch im Central Valley nie auf eine richtige Bienenfarm gestoßen, wie sie in den südlichen Bezirken des Staates so häufig und so geschickt geführt wird. Die paar Pfund Honig und Wachs, die produziert werden, werden zu Hause verbraucht und zählen kaum zu den gröberen Produkten des Bauernhofs. Die Schwärme, die ihren sorglosen Besitzern entkommen, haben eine mühsame, verwirrende Zeit, um geeignete Behausungen zu finden. Die meisten von ihnen machen sich auf den Weg zu den Ausläufern der Berge oder zu den Bäumen, die die Flussufer säumen, wo sich vielleicht ein hohler Baumstamm oder Baumstamm befindet. Ein Freund von mir stieß bei seiner Jagd am San Joaquin auf eine alte Waschbärfalle, die in hohem Gras nahe dem Flussufer versteckt war. Darauf setzte er sich, um sich auszuruhen. Kurz darauf wurde seine Aufmerksamkeit von einem Schwarm wütender Bienen erregt, die aufgeregt um seinen Kopf herumschwirrten. Er entdeckte, dass er auf ihrem Bienenstock saß, der mehr als 200 Pfund Honig enthielt. Im breiten, sumpfigen Delta der Flüsse Sacramento und San Joaquin bauen die kleinen Wanderer ihre Waben bekanntlich in einem Bündel Binsen oder steifem, drahtigem Gras, das nur wenig vor der Witterung geschützt ist und jedes Frühjahr Gefahr läuft, von Überschwemmungen weggeschwemmt zu werden. Sie haben jedoch den Vorteil, dass sie über riesige, frische Weideflächen verfügen, auf die nur sie selbst Zugriff haben.
Der gegenwärtige Zustand des Grand Central Garden unterscheidet sich sehr von dem, den wir skizziert haben. Vor etwa zwanzig Jahren, als die Goldlagerstätten ziemlich erschöpft waren, wandte sich die Aufmerksamkeit der Glückssucher – nicht der Wohnungssucher – größtenteils von den Minen ab und den fruchtbaren Ebenen zu, und viele begannen mit Experimenten in einer Art rastloser, wilder Landwirtschaft. Eine Ladung Holz wurde an einen Ort in der freien Wildnis gebracht, wo man leicht Wasser finden konnte, und eine einfache Blockhütte gebaut. Dann wurde ein Pflug und ein Dutzend Mustang-Ponys im Wert von zehn oder fünfzehn Dollar pro Stück beschafft, und mit diesen Hunderten von Morgen wurde so leicht gepflügt, als ob das Land jahrelang bebaut worden wäre, da zähe, mehrjährige Wurzeln fast völlig fehlten. So wurde eine Ranch gegründet, und aus diesen kahlen Holzhütten als Zentren der Verwüstung verschwand die wilde Flora in immer größeren Kreisen. Die größten Vernichter sind jedoch die Hirten mit ihren Herden von Heuschrecken mit Hufen, die wie ein Feuer über den Boden fegen und jeden Pfahl, der dem Pflug entgeht, so vollständig niedertrampeln, als wäre die ganze Ebene ein Bauerngarten ohne Zaun. Aber trotz dieser Vernichter können hier tausend Bienenschwärme für jeden Bienenweideplatz sein, der jetzt Honig sammelt. Der größere Teil ist noch immer jede Saison mit einem unterdrückten Wachstum von Bienenblüten bedeckt, denn die meisten Arten sind einjährig und viele von ihnen werden von Schafen oder Rindern nicht gemocht, während die Schnelligkeit ihres Wachstums es ihnen ermöglicht, ihre Samen zu entwickeln und reifen zu lassen, bevor ein Fuß Zeit hat, sie zu zerquetschen. Der Boden bleibt daher süß und die Rasse wird fortgeführt, wenn auch nur als andeutender Schatten der Pracht ihrer Wildheit.
Die Zeit wird zweifellos kommen, wenn das gesamte Gebiet dieses edlen Tals wie ein Garten bestellt wird, wenn das fruchtbare Wasser der Berge, das jetzt ins Meer fließt, auf jeden Morgen verteilt wird und blühende Städte, Reichtum, Kunst usw. entstehen lässt. Dann, so nehme ich an, wird es nur noch wenige geben, selbst unter den Botanikern, die die verschwundene Urflora beklagen. In der Zwischenzeit ist die reine Verwüstung, die mutwillige Zerstörung der Unschuldigen, ein trauriger Anblick, und die Sonne kann man wohl bemitleiden, wenn sie gezwungen ist, zuzusehen.
Die Bienenweiden der Küstengebirge bestehen länger und sind vielfältiger als die der großen Ebenen, was auf die Unterschiede in Boden und Klima, Feuchtigkeit und Schatten usw. zurückzuführen ist. Einige der Berge sind über 4000 Fuß hoch und in den Waldgebieten gibt es kleine Bäche, Quellen, Sümpfe usw. in großer Menge und Vielfalt, während offene, sonnendurchflutete Parks und von Hügeln umgebene Täler in unterschiedlichen Höhenlagen, jedes mit seinem eigenen besonderen Klima und seiner eigenen Ausrichtung, die erforderlichen Bedingungen für die Entwicklung sehr unterschiedlicher Pflanzenarten und -familien bieten.
Neben der Ebene gibt es zunächst eine Reihe sanfter Hügel, bepflanzt mit einer üppigen und auffälligen Vegetation, die sich nur wenig von der der Ebene selbst unterscheidet – als ob der Rand der Ebene angehoben und in fließende Falten gebogen worden wäre, mit all seinen Blumen an ihrem Platz, nur etwas abgeschwächt in ihrer Üppigkeit, und ein paar neuen Arten, wie die Berglupinen, Minzen und Gilias. Die Farben kommen gut zur Geltung, wenn man sie so auf die Hänge hält; Flecken von Rot, Lila, Blau, Gelb und Weiß vermischen sich an den Rändern, und das Ganze erscheint aus einiger Entfernung wie eine in Abschnitte eingefärbte Karte.
Darüber liegt der Park und die Chaparral-Region mit weit auseinander gepflanzten, meist immergrünen Eichen und blühenden Sträuchern von drei bis zehn Fuß Höhe; Manzanita und Ceanothus verschiedener Arten, gemischt mit Rhamnus, Cercis, Pickeringia, Kirsche, Felsenbirne und Adenostoma in zotteligen, ineinander verwachsenen Dickichten und vielen Arten von Hosackia, Klee, Monardella, Castilleia usw. in den Lichtungen.
Die Hauptketten verlaufen in etwa parallel zu ihren Achsen verlaufenden Ausläufern, die ebene Täler umschließen, von denen viele recht ausgedehnt sind und in ihrer freien Natur eine große Fülle sonnenliebender Bienenblumen aufweisen. Diese sind jedoch durch die Kultivierung zum großen Teil bereits für die Bienen verloren gegangen.
Näher an der Küste liegen die riesigen Redwood-Wälder, die sich von der Grenze zu Oregon bis nach Santa Cruz erstrecken. Unter dem kühlen, tiefen Schatten dieser majestätischen Bäume ist der Boden von Farnen bedeckt, hauptsächlich Woodwardien und Aspidien, und nur wenigen blühenden Pflanzen – Sauerklee, Trientalis, Erythronium, Schachbrettblumen, Stechwinden und andere Schattenliebhaber. Doch entlang des gesamten Redwood-Gürtels gibt es sonnige Lichtungen auf den nach Süden gerichteten Berghängen, wo die riesigen Bäume zurückstehen und den Boden den kleinen Sonnenblumen und den Bienen überlassen. Rund um die hohen Redwood-Mauern dieser kleinen Bienengebiete steht normalerweise ein Saum aus Kastanieneichen, Lorbeer und Madroño, wobei letztere überaus schöne Bäume und bei den Bienen sehr beliebt sind. Die Stämme der größten Exemplare sind sieben bis acht Fuß dick und etwa fünfzehn Fuß hoch; die Rinde ist rot und schokoladenfarben, die Blätter schlicht, groß und glänzend wie die der Magnolia grandiflora , während die Blüten gelblich-weiß und urnenförmig sind und in wohl proportionierten Rispen stehen, die fünf bis zehn Zoll lang sind. In voller Blüte scheint ein einzelner Baum manchmal von einem ganzen Bienenstock auf einmal besucht zu werden, und das tiefe Summen einer solchen Menge lässt den Zuhörer vermuten, dass hier mehr als die gewöhnliche Arbeit der Honiggewinnung vor sich gehen muss.
Wie vollkommen bezaubernd und sorgenvernichtend sind diese abgeschiedenen Wälder – weite Ausblicke auf das Meer – Sonnenschein, der in einem zitternden, sich verändernden Mosaik auf den blühenden Boden fällt und strömt, während sich die Lichtwege in der belaubten Wand mit der wehenden Brise öffnen und schließen – glänzende Blätter und Blumen, Vögel und Bienen, die sich in Frühlingsharmonie vermischen und beruhigender Duft aus tausend tausend Quellen strömt! In diesen milden, sich auflösenden Tagen, wenn man die tiefen Herzschläge der Natur spürt, die Felsen und Bäume und alles andere gleichermaßen erzittern lassen, werden alltägliche Geschäfte und Freunde glücklich vergessen, und selbst die natürliche Honigarbeit der Bienen und die Fürsorge der Vögel für ihre Jungen und der Mütter für ihre Kinder scheinen etwas fehl am Platz.
Weiter nördlich, in Humboldt und den angrenzenden Countys, sind ganze Hügel mit Rhododendren bedeckt, die im Frühling eine herrliche Melodie der Bienenblüte erzeugen. Und die Westliche Azalee, kaum weniger blühend, wächst in riesigen Dickichten von drei bis acht Fuß Höhe an den Rändern von Hainen und Wäldern bis nach San Luis Obispo im Süden, normalerweise begleitet von Manzanita; während die Täler mit ihrer unterschiedlichen Feuchtigkeit und Schatten eine reiche Vielfalt der kleineren Honigblumen hervorbringen, wie Mentha, Lycopus, Micromeria, Audibertia, Trichosema und andere Minzenarten; mit Vaccinium, Walderdbeere, Geranie, Calais und Goldrute; und in den kühlen Tälern entlang der Flussufer, wo der Schatten der Bäume nicht zu tief ist, bilden Spiraea, Hartriegel, Heteromeles und Calycanthus und viele Rubus-Arten ineinander verschlungene Knäuel, von denen einige Teile monatelang weiter blühen.
Obwohl die Küstenregion als erste von Weißen erobert und besiedelt wurde, hat sie aus Bienensicht weniger gelitten als die anderen Hauptgebiete, hauptsächlich zweifellos wegen der Unebenheit der Oberfläche und weil sie Eigentum ist und geschützt wird, anstatt den Herden der wandernden „Schafzüchter“ ausgesetzt zu sein. Diese Bemerkungen gelten insbesondere für die Nordhälfte der Küste. Weiter südlich gibt es weniger Feuchtigkeit, weniger Waldschatten und die Honigflora ist weniger vielfältig.
Die Sierra-Region ist die größte der drei Hauptregionen der Bienengebiete des Staates und weist aufgrund ihres allmählichen Anstiegs von der Ebene der Central Plain zu den Alpengipfeln die regelmäßigste Unterteilung auf. Die Vorgebirgsregion ist von Ende Mai bis zum Einsetzen der Winterregen ungefähr so trocken und sonnig wie die Ebene. Es gibt keine schattigen Wälder, keine feuchten Täler, die denen in den Coast Mountains auf gleicher Höhe ähneln. Die sozialen Compositae der Ebene bilden mit einigen zusätzlichen Arten den Großteil des krautigen Teils der Vegetation bis zu einer Höhe von 1500 Fuß oder mehr, hier und da leicht beschattet von Eichen und Sabine-Kiefern und unterbrochen von Flecken von Ceanothus und Rosskastanien. Darüber und direkt unterhalb der Waldregion befindet sich ein dunkler, heideartiger Gürtel aus Chaparral, der fast ausschließlich aus Adenostoma fasciculata besteht , einem Strauch aus der Familie der Rosengewächse, der zwischen 1,5 und 2,4 Meter hoch ist, kleine, runde Blätter in Bündeln hat und eine Vielzahl kleiner weißer Blüten in Rispen an den Enden der oberen Zweige trägt. Wo er überhaupt vorkommt, bedeckt er normalerweise den gesamten Boden mit einem dichten, undurchdringlichen Wuchs, der kilometerweit kaum unterbrochen ist.
In der Waldregion, bis zu einer Höhe von etwa 9000 Fuß über dem Meeresspiegel, gibt es zerklüftete Flecken von Manzanita und fünf oder sechs Arten von Ceanothus, die als Hirschbürste oder Kalifornischer Flieder bezeichnet werden. Dies sind die wichtigsten Honigbüsche der Sierra. Chamaebatia foliolosa , ein kleiner, etwa einen Fuß hoher Strauch mit Blüten wie die Erdbeere, bildet schöne Teppiche unter den Kiefern und scheint bei den Bienen beliebt zu sein; während die Kiefern selbst unbegrenzte Mengen an Pollen und Honigtau liefern. Die Ernte eines einzigen Baumes, dessen Pollen zur richtigen Jahreszeit reift, würde für den Bedarf eines ganzen Bienenstocks ausreichen. Entlang der Bäche wächst üppiges Wachstum von Lilien, Rittersporn, Pedicularis, Castilleias und Klee. Die Alpenregion umfasst blühende Gletscherwiesen und zahllose kleine Gärten an allen möglichen Orten voller Potentilla verschiedener Arten, Spraguea, Ivesia, Weidenröschen und Goldruten, mit Beeten aus Bryanthus und der bezaubernden Cassiope, die mit süßen Glocken bedeckt ist. Sogar die Berggipfel sind mit Blumen gesegnet – Zwergphlox, Polemonium, Ribes, Hulsea usw. Ich habe wilde Bienen und Schmetterlinge gesehen, die in einer Höhe von 13.000 Fuß über dem Meer Nahrung suchten. Viele jedoch, die diese gefährlichen Höhen erklimmen, kommen nie wieder herunter. Einige kommen zweifellos in Stürmen um, und ich habe Tausende tot oder betäubt auf der Oberfläche der Gletscher liegen sehen, zu denen sie vielleicht vom weißen Glanz angezogen wurden und die sie für blühende Beete hielten.
Aus Schwärmen, die ihren Besitzern im Tiefland entkamen, ist die Honigbiene heute im Allgemeinen in der gesamten Sierra verbreitet, bis zu einer Höhe von 8000 Fuß über dem Meeresspiegel. In dieser Höhe gedeihen sie ohne Pflege, obwohl der Schnee jeden Winter tief ist. Sogar noch höher wurden mehrere Bienenbäume gefällt, die über 200 Pfund Honig enthielten.
Die zerstörerische Wirkung der Schafe war auf den Bergweiden nicht so stark wie auf denen der großen Ebene, aber an vielen Orten war sie aufgrund der bröckeligeren Beschaffenheit des Bodens und seiner Hanglage umfassender. Das schräge Graben und Abharken der Hufe auf den steileren Moränenhängen hat von Jahr zu Jahr viele der zarten Pflanzen entwurzelt und vergraben, ohne ihnen Zeit zu geben, ihre Samen reifen zu lassen. Auch die Sträucher sind stark befallen, insbesondere die verschiedenen Arten von Ceanothus. Glücklicherweise fressen weder Schafe noch Rinder Manzanita, Spiraea oder Adenostoma; und diese schönen Honigbüsche sind zu steif und hoch oder wachsen an Orten, die zu rau und unzugänglich sind, als dass man sie mit Füßen treten könnte. Auch die Canyonwände und Schluchten, die einen so großen Teil der Fläche des Gebirges ausmachen, sind zwar für Schafe unzugänglich, aber dennoch dicht mit Honigsträuchern gesäumt und enthalten Tausende von lieblichen Bienengärten, die in schmalen Seitencanons und von Lawinenschutt umgebenen Nischen und auf den Gipfeln flacher, vorspringender Landzungen verborgen liegen, wo nur Bienen auf die Idee kommen würden, nach ihnen zu suchen.
Andererseits wird ein großer Teil der Holzpflanzen, die den Füßen und Zähnen der Schafe entgehen, von den Schafhirten durch Lauffeuer vernichtet. Diese werden im trockenen Herbst überall gelegt, um die alten, umgestürzten Stämme und das Unterholz abzubrennen, um die Weiden zu verbessern und den Herden freiere Wege zu verschaffen. Diese zerstörerischen Schaffeuer ziehen fast durch den gesamten Waldgürtel der Gebirgskette, von einem Ende zum anderen, und vernichten nicht nur das Unterholz, sondern auch die jungen Bäume und Setzlinge, von denen die Beständigkeit der Wälder abhängt. Damit wird eine lange Reihe von Übeln in Gang gesetzt, die sicherlich weit über Bienen und Imker hinausreichen werden.
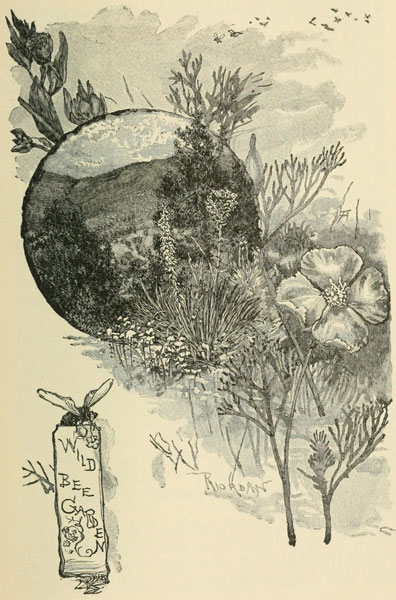
Der Pflug hat die Waldregion noch nicht in nennenswertem Umfang erfasst und auch in den Vorgebirgen hat er noch nicht viel erreicht. Tausende von Bienenfarmen könnten entlang des Randes der Ebene und bis zu einer Höhe von 4000 Fuß errichtet werden, wo immer Wasser verfügbar ist. Das Klima in dieser Höhe ermöglicht den Bau dauerhafter Behausungen, und wenn man die Bienenstöcke auf höher gelegene Weiden verlagert, wenn die Blütezeit der unteren vorbei ist, könnte man den jährlichen Honigertrag fast verdoppeln. Die Weiden in den Vorgebirgen sind, wie wir gesehen haben, Ende Mai verdorrt, die Weiden des Chaparral-Gürtels und der tiefer gelegenen Wälder stehen im Juni in voller Blüte, die der höheren und alpinen Regionen im Juli, August und September. In Schottland werden die Bienen nach der Blütezeit der Tieflandbienen in Karren in die Highlands gebracht und auf den Heidehügeln freigelassen. Auch in Frankreich und Polen werden sie auf die gleiche Weise von Weide zu Weide zwischen Obstgärten und Feldern transportiert und in Lastkähnen die Flüsse entlang, um den Honig der herrlichen Vegetation an den Ufern zu sammeln. In Ägypten werden sie weit den Nil hinaufgebracht und langsam wieder nach Hause getrieben, wobei sie unterwegs die Honigernte der verschiedenen Felder einsammeln und ihre Bewegungen den Jahreszeiten entsprechend planen. Würden in Kalifornien ähnliche Methoden angewandt, würde die Erntezeit fast das ganze Jahr dauern.
Die durchschnittliche Höhe der nördlichen Hälfte der Sierra ist, wie wir gesehen haben, erheblich geringer als die der südlichen Hälfte, und kleine Bäche mit den von ihnen abhängigen Ufer- und Wiesengärten sind weniger zahlreich. Um die Quellgewässer der Flüsse Yuba, Feather und Pitt herum sind die ausgedehnten Lavahochebenen spärlich mit Kiefern bepflanzt, durch die das Sonnenlicht den Boden ohne große Unterbrechung erreicht. Hier gedeiht ein verstreutes, büscheliges Gewächs von Goldapplopappus, Linosyris, Bahia, Wyetheia, Arnika, Artemisia und ähnlichen Pflanzen; mit Manzanita, Kirsche, Pflaume und Dorn in zerklüfteten Flecken auf den kühleren Berghängen. An den äußersten Enden der Great Central Plain winden sich die Sierra und die Küstenkette und sind in einem Labyrinth aus Bergen und Tälern miteinander verbunden. Überall vermischen sich die Pflanzenarten und bilden im Norden mit seinem gemäßigten Klima und den reichlichen Niederschlägen ein wahres Paradies für Bienen. Seltsamerweise wurde dort jedoch bisher kaum eine einzige richtige Bienenfarm errichtet.
Von allen höher gelegenen Blumenfeldern der Sierra ist Shasta das honigreichste und übertrifft an Ruhm vielleicht noch die berühmten Honighügel von Hybla und den herzhaften Hymettus. Betrachtet man diesen edlen Berg aus der Sicht der Bienen, der von seinen vielen Klimazonen umgeben ist und sich von der heißen Ebene in das frostige Azurblau erstreckt, so sind die ersten 5000 Fuß vom Gipfel aus meist schneebedeckt und daher ungefähr so honiglos wie das Meer. Die Basis dieser arktischen Region ist von einem Gürtel aus bröckelnder Lava umgeben, der etwa 1000 Fuß vertikal breit ist und im Sommer meist schneefrei ist. Wunderschöne Flechten beleben die Felswände mit ihren leuchtenden Farben und in einigen der wärmeren Winkel gibt es ein paar Büschel von Alpengänseblümchen, Goldlack und Bartfaden; aber obwohl diese im Spätsommer üppig blühen, ist die Zone als Ganzes fast so honiglos wie der eisige Gipfel, und ihre Unterkante kann als Honiggrenze betrachtet werden. Unmittelbar darunter kommt die Waldzone, bedeckt mit einem üppigen Nadelbaumbestand, hauptsächlich Weißtannen, reich an Pollen und Honigtau, und abwechslungsreich mit zahllosen Gartenlichtungen, von denen viele weniger als hundert Meter breit sind. Als nächstes kommt in geordneter Folge die große Bienenzone. Ihre Fläche übertrifft die des eisigen Gipfels und der beiden anderen Zonen zusammen bei weitem, denn sie erstreckt sich majestätisch um den gesamten Berg, mit einer Breite von sechs oder sieben Meilen und einem Umfang von fast hundert Meilen.
Shasta ist, wie wir bereits gesehen haben, ein Feuerberg, der durch eine Reihe von Eruptionen von Asche und geschmolzener Lava entstanden ist, die über die Ränder seiner verschiedenen Krater floss und nach außen und oben wuchs wie der Stamm eines knorrigen, exogenen Baumes. Dann folgte ein seltsamer Kontrast. Der Eiswinter brach an und belud den abkühlenden Berg mit Eis, das langsam in alle Richtungen nach außen floss und in Form eines riesigen kegelförmigen Gletschers vom Gipfel ausstrahlte – ein herabkriechender Eismantel auf einer Quelle aus schwelender Feuer, der jahrhundertelang mit unaufhörlicher Aktivität seine braunen, kieseligen Laven zermalmte und zermahlte und so den gesamten Berg zerstörte und umgestaltete. Als sich die Eiszeit schließlich ihrem Ende näherte, schmolz der Eismantel allmählich um den Fuß herum ab, und als er zurückwich und in seinen gegenwärtigen fragmentarischen Zustand zerbrach, lagerten sich unregelmäßige Ringe und Haufen von Moränenmaterial an seinen Flanken ab. Die Gletschererosion der meisten Shasta-Laven erzeugt Geröll, das aus groben, halbeckigen Felsbrocken mittlerer Größe und porösem Kies und Sand besteht, der der Transportkraft des fließenden Wassers frei nachgibt. Gewaltige Fluten aus den großen Eis- und Schneequellen arbeiteten mit enormer Energie auf dieses vorbereitete Gletschergeröll ein, sortierten es und spülten riesige Mengen von den höheren Hängen herab und formten es in glatten, deltaartigen Betten um die Basis herum neu; und diese miteinander verbundenen Flutbetten bilden heute die Haupthonigzone des alten Vulkans.
So hat Mutter Natur durch scheinbar antagonistische und zerstörerische Kräfte ihre wohltätigen Pläne verwirklicht - mal eine Flut aus Feuer, mal eine Flut aus Eis, mal eine Flut aus Wasser; und schließlich ein Ausbruch organischen Lebens, eine Milchstraße aus schneeweißen Blütenblättern und Flügeln, die den zerklüfteten Berg wie eine Wolke umgürtet, als hätten sich die belebenden Sonnenstrahlen, die auf seine Flanken treffen, in Schaum aus Pflanzenblüten und Bienen aufgelöst, so wie Meereswellen an einer felsigen Küste brechen und aufblühen.
In dieser blühenden Wildnis schweifen und schwelgen die Bienen, erfreuen sich an der Fülle der Sonne, klettern eifrig durch Brombeer- und Heidelbeerbüsche, läuten die unzähligen Glocken der Manzanita, summen bald hoch oben zwischen pollenbedeckten Weiden und Tannen, bald auf dem aschigen Boden zwischen Gilias und Butterblumen und tauchen bald tief in schneebedeckte Kirsch- und Kreuzdornbänke ein. Sie betrachten die Lilien und rollen sich in sie hinein, und wie Lilien mühen sie sich nicht, denn sie werden von der Kraft der Sonne angetrieben, wie Wasserräder von der Kraft des Wassers; und wenn die eine viel Wasser mit hohem Druck hat, die andere viel Sonnenschein, summen und zittern sie gleichermaßen. Wenn man an sonnigen Sommertagen durch das Bienenland von Shasta schlendert, kann man die Tageszeit leicht allein aus der relativen Energie der Bienenbewegungen ableiten – schläfrig und gemäßigt in der Kühle des Morgens, energischer mit der aufgehenden Sonne und am helllichten Mittag in wilder Ekstase schaudernd und zitternd, um dann allmählich wieder in die Stille der Nacht abzusinken. Auf meinen Exkursionen zwischen den Gletschern treffe ich gelegentlich Bienen, die hungrig sind, wie Bergsteiger, die sich zu weit hinauswagen und zu lange über der Brotgrenze bleiben; dann hängen sie herab und verwelken wie Herbstblätter. Die Shasta-Bienen werden vielleicht besser gefüttert als alle anderen in der Sierra. Ihre Feldarbeit ist ein einziges Festmahl; aber wie berauschend der Sonnenschein oder wie reichlich das Blumenangebot auch sein mag, sie sind immer köstliche Fresser. Kolibris und Kolibris setzen selten einen Fuß auf eine Blume, sondern balancieren auf den Flügeln davor und strecken sich nach vorne, als würden sie durch Strohhalme saugen. Doch Bienen, so zierlich sie auch sind, umarmen ihre Lieblingsblumen mit tiefer Herzlichkeit und drücken ihre stumpfen, pollenbedeckten Gesichter an sie wie Babys an die Brust ihrer Mutter. Und liebevoll, mit ewiger Liebe, umarmt Mutter Natur ihre kleinen Bienenbabys und säugt sie in Scharen auf einmal an ihrer warmen Shasta-Brust.
Neben der gewöhnlichen Honigbiene gibt es hier viele andere Arten – schöne, moosbedeckte, kräftige Kerle, die vor dem Aufkommen der heimischen Arten Tausende sonniger Jahreszeiten auf den Bergen ernährt wurden. Dazu gehören Hummeln, Mauerbienen, Holzbienen und Blattschneiderbienen. Auch Schmetterlinge und Motten jeder Größe und Art; einige haben breite Flügel wie Fledermäuse, flattern langsam und segeln in leichten Kurven; andere ähneln kleinen, fliegenden Veilchen, schwingen sich locker in kurzen, krummen Flügen dicht an den Blüten herum und schlemmen Tag und Nacht in Luxus. Auch viele Rehe leben gern in den buschigen Teilen der Bienenweiden.
Auch Bären durchstreifen die liebliche Wildnis. Ihre stumpfen, zottigen Formen harmonieren gut mit den Bäumen und dem Gewirr der Büsche und auch mit den Bienen, trotz der unterschiedlichen Größen. Sie lieben alle guten Dinge und genießen sie in vollen Zügen, ohne viel Unterscheidungsvermögen zu haben – Blüten und Blätter ebenso wie Beeren und die Bienen selbst ebenso wie ihren Honig. Obwohl die kalifornischen Bären bisher wenig Erfahrung mit Honigbienen haben, gelingt es ihnen oft, an deren reichliche Vorräte zu gelangen, und es erscheint fraglich, ob die Bienen selbst Honig mit so großer Begeisterung genießen. Mit ihren kräftigen Zähnen und Klauen können sie fast jeden bequem erreichbaren Bienenstock zernagen und aufreißen. Die meisten Honigbienen sind jedoch auf der Suche nach einem Heim klug genug, sich, wenn möglich, eine Höhle in einem lebenden Baum in beträchtlicher Höhe über dem Boden auszusuchen; dann sind sie ziemlich sicher, denn obwohl die kleineren Schwarz- und Braunbären gut klettern können, sind sie nicht in der Lage, in starke Bienenstöcke einzubrechen, da sie sich anstrengen müssen, um nicht zu fallen, und gleichzeitig die Stiche der kämpfenden Bienen ertragen müssen, ohne ihre Pfoten frei zu haben, um sie abzureiben. Aber wehe den schwarzen Hummeln, die in ihren moosigen Nestern im Boden entdeckt werden! Mit ein paar Schlägen ihrer riesigen Pfoten decken die Bären das gesamte Nest auf, und bevor Zeit für ein allgemeines Summen bleibt, sind Bienen, alt und jung, Larven, Honig, Stiche, Nest und alles mit einem einzigen, hinreißenden Bissen verschlungen.
Nicht zuletzt sind es die Stürme, die für die überragende Süße der Shasta-Flora verantwortlich sind – Stürme, die streng lokal sind, auf dem Berg gezüchtet und geboren werden. Die magische Schnelligkeit, mit der sie auf dem Berggipfel heranwachsen und ihre Wohltat in Form von Regen und Schnee spenden, versetzt den unerfahrenen Tieflandbewohner immer wieder in Erstaunen. Oft kann man an ruhigen, strahlenden Tagen, wenn die Bienen noch unterwegs sind, hoch oben im reinen Äther eine Gewitterwolke sehen, deren Perlenhöcker anschwellen und die still wie eine Pflanze wächst. Dann ist ein klarer, dröhnender Donner zu hören, gefolgt von einem Windstoß, der wie das Tosen des Ozeans über die sich windenden Wälder rauscht und Regentropfen, Schneeblumen, Honigblumen und Bienen in wilder Sturmharmonie vermischt.
Noch eindrucksvoller sind die warmen, belebenden Frühlingstage auf den Bergweiden. Man scheint das Blut der Pflanzen zu hören und zu fühlen, das unter dem lebensspendenden Sonnenschein pulsiert. Das Pflanzenwachstum geht vor unseren Augen weiter, und jeder Baum im Wald, jeder Busch und jede Blume erscheinen als Bienenstock ruheloser Betriebsamkeit. Die Tiefen des Himmels sind gesprenkelt mit singenden Flügeln in allen Schattierungen und Farben; Wolken aus leuchtenden Schmetterlingsflügeln tanzen und wirbeln in exquisitem Rhythmus, goldgebänderte Faltenfliegen, Libellen, Schmetterlinge, schnarrende Zikaden und fröhliche, rasselnde Heuschrecken, die das Licht geradezu emaillieren.
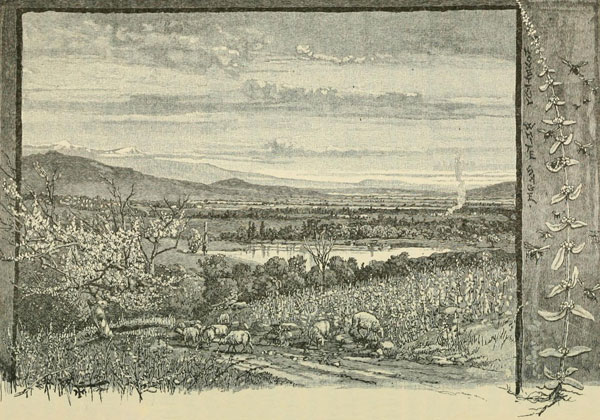
An hellen, frischen Morgen kann man im Schatten der höheren Berge oft einen beeindruckenden optischen Effekt beobachten, während die Sonnenstrahlen über uns hinwegströmen. Dann leuchtet jedes Insekt, egal welche Farbe es hat, weiß im Licht. Hautflügler mit hauchdünnen Flügeln, Motten, pechschwarze Käfer, sie alle verwandeln sich in reines, spirituelles Weiß, wie Schneeflocken.
In Südkalifornien, wo der Bienenzucht in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit gewidmet wurde, sind die Weiden nicht üppiger oder hinsichtlich der Zahl der Honigpflanzen und ihrer Verteilung über Berge und Ebenen vorteilhafter abwechslungsreich als in vielen anderen Teilen des Staates, wo die Industrieströme in anderen Kanälen fließen. Der berühmte Weiße Salbei (Audibertia) aus der Familie der Minzen blüht hier in all seiner Pracht, blüht im Mai und liefert große Mengen klaren, hellen Honigs, der auf jedem Markt, den er bisher erreicht hat, sehr geschätzt wird. Diese Art wächst hauptsächlich in den Tälern und niedrigen Hügeln. Der Schwarze Salbei in den Bergen ist Teil eines dichten, dornigen Chaparrals, der hauptsächlich aus Adenostoma, Ceanothus, Manzanita und Kirsche besteht – er unterscheidet sich nicht sehr von dem im südlichen Teil der Sierra, ist aber dichter und zusammenhängender sowie höher und blüht länger. Gärten am Flussufer, ein so reizvolles Merkmal der Sierra und der Coast Mountains, sind in Südkalifornien weniger zahlreich, aber sie sind, wo immer sie zu finden sind, außerordentlich reich an Honigblumen – Steinklee, Akelei, Collinsia, Eisenkraut, Zauschneria, Wildrose, Geißblatt, Pfeifenstrauch und Lilien, die in Üppigkeit aus den warmen, feuchten Tälern emporwachsen. Wilder Buchweizen vieler Arten wächst gegen Ende des Sommers in Hülle und Fülle in den trockenen, sandigen Tälern und an den unteren Hängen der Berge und ist zu dieser Zeit die Hauptnahrungsquelle der Bienen, hier und da noch verstärkt durch Orangenhaine, Luzernefelder und kleine Hausgärten.
Die wichtigsten Honigmonate sind in der Regel April, Mai, Juni, Juli und August, während in den anderen Monaten die Blütenpracht normalerweise hoch genug ist, um den Bienen ausreichend Ertrag zu bringen.
Laut Herrn JT Gordon, dem Präsidenten der Imkervereinigung des Los Angeles County, waren die ersten Bienen, die in das County eingeführt wurden, ein einzelner Stock, der in San Francisco 150 Dollar kostete und im September 1854 ankam. [1] Im April des folgenden Jahres schickte dieser Stock zwei Schwärme hinaus, die für 100 Dollar pro Stück verkauft wurden. Von diesem kleinen Anfang an vermehrten sich die Bienen allmählich auf etwa 3000 Schwärme im Jahr 1873. Im Jahr 1876 schätzte man, dass es im County zwischen 15.000 und 20.000 Stöcke gab, die einen jährlichen Ertrag von etwa 100 Pfund pro Stock lieferten – in einigen Ausnahmefällen sogar einen viel höheren Ertrag.
Im San Diego County gab es zu Beginn der Saison 1878 etwa 24.000 Bienenstöcke, und die Lieferungen aus dem einzigen Hafen von San Diego für das gleiche Jahr vom 17. Juli bis 10. November betrugen 1071 Fässer, 15.544 Kisten und fast 90 Tonnen. Die größten Bienenfarmen haben etwa tausend Bienenstöcke und werden sorgfältig und geschickt geführt, wobei jedes wissenschaftliche Gerät von Bedeutung zum Einsatz kommt. Es gibt jedoch nur wenige Imker, die halb so viele Bienenstöcke besitzen oder die sich voll und ganz dem Geschäft widmen. Der Orangenanbau überschattet derzeit alle anderen Geschäfte.
Viele der sogenannten Bienenfarmen in den Bezirken Los Angeles und San Diego sind noch immer die primitivsten Pioniere, die man sich vorstellen kann. Ein Mann, der sonst erfolglos geblieben ist, hört die interessante Geschichte über die Gewinne und Annehmlichkeiten der Bienenhaltung und beschließt, es selbst zu versuchen. Er kauft ein paar Kolonien oder erwirbt sie auf Aktien von einer überfüllten Farm, bringt sie an den Fuß einer Schlucht, wo das Weideland frisch ist, besiedelt das Land, mit oder ohne Erlaubnis des Eigentümers, stellt seine Bienenstöcke auf, baut sich eine Blockhütte, die kaum größer als ein Bienenstock ist, und wartet auf sein Glück.
Bienen leiden in den Trockenjahren, die gelegentlich im Süden und in der Mitte des Staates vorkommen, sehr unter Hunger. Wenn der Niederschlag nur drei oder vier Zoll beträgt, statt zwölf bis zwanzig Zoll wie in normalen Jahreszeiten, sterben Tausende von Schafen und Rindern, und das gleiche gilt für dieses kleine, geflügelte Vieh, wenn es nicht sorgfältig gefüttert oder auf andere Weiden gebracht wird. Das Jahr 1877 wird lange als außergewöhnlich regenlos und quälend in Erinnerung bleiben. Kaum eine Blume blühte in den trockenen Tälern abseits der Flussufer, und kein einziges Getreidefeld, das vom Regen abhängig war, wurde abgeerntet. Die Saat keimte nur, wuchs ein Stück weit und verdorrte. Pferde, Rinder und Schafe wurden von Tag zu Tag magerer und knabberten an Büschen und Unkraut entlang der seichten Ufer der Flüsse, von denen viele zum ersten Mal seit der Besiedlung des Landes völlig ausgetrocknet waren.
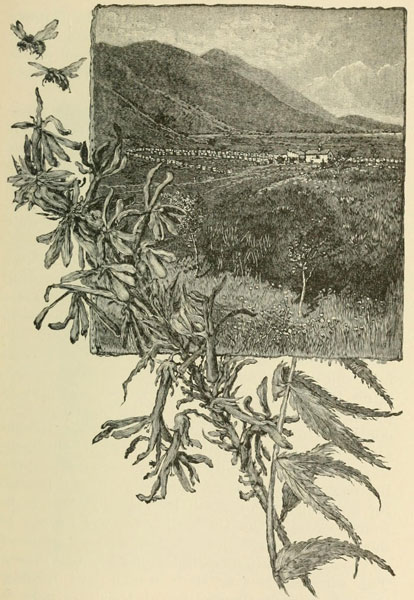
Während einer Reise, die ich im Sommer jenes Jahres durch die Landkreise Monterey, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura und Los Angeles unternahm, waren die beklagenswerten Auswirkungen der Dürre überall sichtbar – blattlose Felder, totes und sterbendes Vieh, tote Bienen und halbtote Menschen mit staubigen, traurigen Gesichtern. Sogar die Vögel und Eichhörnchen litten, obwohl ihr Leiden weniger schmerzhaft sichtbar war als das des armen Viehs. Dieses verhungerte eines nach dem anderen langsam und sicher an den Ufern der heißen, trägen Flüsse, während Tausende von entsprechend fetten Bussarden über ihnen dahinsegelten oder vollgestopft am Boden unter den Bäumen standen und voller Zuversicht auf frische Kadaver warteten. Die Wachteln, die die harten Zeiten klugerweise in Betracht zogen, gaben jeden Gedanken an eine Paarung auf. Sie waren zu arm, um zu heiraten, und blieben daher das ganze Jahr über in Herden, ohne zu versuchen, Junge aufzuziehen. Die Erdhörnchen, obwohl eine außergewöhnlich fleißige und unternehmungslustige Rasse, wie jeder Bauer weiß, hatten es schwer, zu überleben; außer in den Bäumen, deren wuchernde dunkelgrüne Laubmassen einen auffallenden Kontrast zu der aschgrauen Kahlheit des Bodens unter ihnen bildeten, waren keine frischen Blätter oder Samen zu finden. Die Eichhörnchen verließen ihre gewohnten Futterplätze und begaben sich zu den belaubten Eichen, um die Eichelvorräte der vorausschauenden Spechte auszunagen, aber diese behielten ihre Bewegungen wachsam im Auge. Ich bemerkte vier Spechte, die sich gegen ein Eichhörnchen verbündeten und den armen Kerl aus einer Eiche vertrieben, die sie für sich beanspruchten. Es wich dem knorrigen Stamm von einer Seite auf die andere aus, so flink es in seinem ausgehungerten Zustand konnte, nur um überall einen spitzen Schnabel zu finden. Aber das Schicksal der Bienen schien in diesem Jahr das traurigste von allen zu sein. In verschiedenen Teilen der Landkreise Los Angeles und San Diego starben die Hälfte bis drei Viertel der Kolonien an Hunger. Allein in diesen beiden Landkreisen gingen nicht weniger als 18.000 Kolonien zugrunde, während die Sterberate in den angrenzenden Landkreisen kaum geringer war.
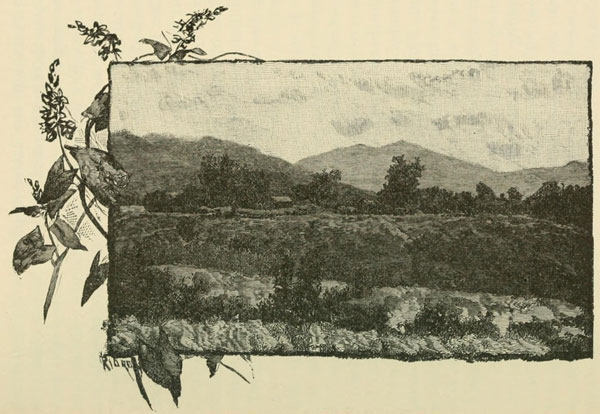
Sogar die Kolonien, die den Bergen am nächsten waren, litten dieses Jahr, denn die kleinere Vegetation in den Vorgebirgen war von der Dürre fast ebenso stark betroffen wie die in den Tälern und Ebenen, und selbst das robuste, tief verwurzelte Chaparral, die sicherste Abhängigkeit der Bienen, blühte spärlich, während ein Großteil davon unerreichbar war. Jeder Schwarm hätte jedoch gerettet werden können, wenn man sie sofort mit Nahrung versorgt hätte, als ihre eigenen Vorräte zu schwinden begannen und bevor sie geschwächt und entmutigt wurden; oder indem man Straßen in die Berge zurückgebaut und sie ins Herz des blühenden Chaparrals gebracht hätte. Die Santa Lucia-, San Rafael-, San Gabriel-, San Jacinto- und San Bernardino-Bergketten sind bisher, abgesehen von den Wildbienen, fast unberührt. Eine Vorstellung von ihren Ressourcen und den Vorteilen und Nachteilen, die sie den Bienenhaltern bieten, kann man sich vielleicht bei einer Exkursion in die San Gabriel-Bergkette machen, die ich Anfang August des „Trockenjahres“ unternahm. Diese Bergkette, die die meisten der charakteristischen Merkmale der anderen gerade erwähnten Bergketten aufweist, überblickt von Norden her die Weinberge und Orangenhaine von Los Angeles und ist im üblichen Sinne des Wortes unzugänglicher als jede andere, die ich je zu durchdringen versuchte. Die Hänge sind außergewöhnlich steil und für den Fuß unsicher und mit 1,5 bis 3 Meter hohen Dornbüschen bedeckt. Mit Ausnahme kleiner Stellen, die auf den ersten Blick nicht zu erkennen sind, ist die gesamte Oberfläche mit Dornbüschen bedeckt, die sich in dichtem Heckenwuchs anmutig in jede Schlucht und Senke hinabziehen und sich in zotteliger, unbändiger Üppigkeit über jeden Grat und Gipfel wölben und die Hälfte des Jahres mehr Honig pro Acker bieten als das dichteste Kleefeld. Aber vom offenen, von trockenem Sonnenschein geschlagenen San Gabriel Valley aus schien alles, was man von der Bergkette sah, einen abschreckenden Anblick zu bieten. Vom Fuß bis zum Gipfel wirkte alles grau, öde und still, und das herrliche Chaparral sah aus wie trockenes Moos, das über die stumpfen, runzeligen Kämme und Mulden kriecht.
Als ich von Pasadena aufbrach, erreichte ich gegen Sonnenuntergang den Fuß der Bergkette, und da ich von meinem Marsch durch das schattenlose Tal müde und erhitzt war, beschloss ich, für die Nacht mein Lager aufzuschlagen. Nachdem ich mich einige Augenblicke ausgeruht hatte, suchte ich zwischen den Schwemmblöcken des Eaton Creek nach einem Lagerplatz, als ich auf einen seltsamen, finster aussehenden Mann traf, der Brennholz hackte. Er schien überrascht, mich zu sehen, also setzte ich mich mit ihm auf den Virginia-Eichenstamm, den er gerade fällte, und beeilte mich, ihm den Grund für mein Erscheinen in seiner Einsamkeit zu nennen, indem ich erklärte, dass ich unbedingt etwas über die Berge herausfinden wollte und am nächsten Morgen den Eaton Creek hinaufgehen wollte. Dann lud er mich freundlich ein, mit ihm zu zelten, und führte mich zu seiner kleinen Hütte am Fuße der Berge, wo eine kleine Quelle aus einem mit wilden Rosenbüschen überwucherten Ufer sprudelt. Nach dem Abendessen, als es dunkel geworden war, erklärte er, dass er keine Kerzen mehr hätte; also saßen wir im Dunkeln, während er mir in einer Mischung aus Spanisch und Englisch einen Überblick über sein Leben gab. Er war in Mexiko geboren, sein Vater war Ire, seine Mutter Spanierin. Er war Bergmann, Viehzüchter, Goldsucher, Jäger usw. gewesen, war immer auf Wanderschaft gewesen und hatte sein Leben vergeudet; aber jetzt wollte er sich niederlassen. Sein vergangenes Leben, sagte er, sei „bedeutungslos“, aber die Zukunft sei vielversprechend. Er wollte „Geld verdienen und eine Spanierin heiraten“. Die Leute schürfen hier nach Wasser wie nach Gold. Er hatte einen Tunnel in einen Bergsporn hinter seiner Hütte gegraben. „Meine Aussichten sind gut“, sagte er, „und wenn ich zufällig auf eine gute, starke Strömung stoße, bin ich bald 5.000 oder 10.000 Dollar wert.“ Denn die Ebene da draußen“, womit er einen kleinen, unregelmäßigen Fleck mit Geröll von zwei oder drei Morgen meinte, der während einer Hochwassersaison vom Eaton Creek abgelagert worden war, „ist groß genug für einen schönen Orangenhain, und der Wall hinter der Hütte reicht für einen Weinberg, und nachdem ich meine eigenen Bäume und Reben gegossen habe, bleibt mir noch etwas Wasser, das ich an meine Nachbarn unter mir im Tal verkaufen kann. Und dann“, fuhr er fort, „kann ich Bienen halten und damit auch noch Geld verdienen, denn die Berge hier oben sind im Sommer voller Honig, und einer meiner Nachbarn hier unten sagt, er würde mir zunächst eine ganze Menge Bienenstöcke gegen Anteile überlassen. Sie sehen, ich habe eine gute Sache; mir geht es jetzt gut.“ All dieser voraussichtliche Reichtum im versunkenen, mit Geröll verstopften Flutbett eines Gebirgsbachs! Wenn man die Bienen einmal außen vor lässt, würden die meisten Glücksritter genauso gut daran denken, sich auf dem Gipfel des Mount Shasta niederzulassen. Am nächsten Morgen wünschte ich meinem hoffnungsvollen Entertainer viel Glück und brach zu meinem zottigen Ausflug auf.

Etwa eine halbe Stunde Fußmarsch oberhalb der Hütte kam ich zu „The Fall“, der in allen Siedlungen des Tals als der schönste Wasserfall bekannt ist, der bisher in den San Gabriel Mountains entdeckt wurde. Er ist ein bezauberndes kleines Ding mit einer tiefen, süßen Stimme, die wie ein Vogel singt, wenn er aus einer Kerbe in einem kurzen Felsvorsprung etwa 10 bis 12 Meter in einen runden, spiegelglatten Teich stürzt. Die Felswand dahinter und auf beiden Seiten ist glatt mit Moos bedeckt und geprägt, vor dem das weiße Wasser in prachtvollem Relief wie ein silbernes Instrument in einem Samtgehäuse hervorsticht. Hierher kommen die Jungs und Mädchen aus San Gabriel, um Farne zu sammeln und ihre heißen Feiertage im kühlen Wasser zu verbringen, froh, ihren alltäglichen Palmengärten und Orangenhainen zu entkommen. Das zarte Frauenhaargewächs wächst auf zerklüfteten Felsen in Reichweite der Gischt, während breitblättrige Ahornbäume und Platanen weichen, milden Schatten auf eine üppige Fülle von Bienenblumen werfen, die zwischen den Felsbrocken vor dem Teich wachsen – der Herbst, die Blumen, die Bienen, die farnbewachsenen Felsen und der Schatten des Laubes bilden ein bezauberndes kleines Gedicht der Wildheit, das letzte einer Reihe, die sich über die blumenbedeckten Hänge des Mount San Antonio bis hinab zu den schroffen, schaumbedeckten Hügeln des Hauptbergs Eaton Canon erstreckt.
Vom Fuß des Wasserfalls aus folgte ich dem Grat, der den westlichen Rand des Eaton-Beckens bildet, bis zum Gipfel eines der Hauptberge, der etwa 5000 Fuß über dem Meeresspiegel liegt. Dann wandte ich mich nach Osten und durchquerte die Mitte des Beckens, bahnte mir einen Weg über seine vielen untergeordneten Grate und über seinen östlichen Rand und musste mich fast überall mit dem blühendsten und undurchdringlichsten Bewuchs von Honigbüschen herumschlagen, den ich seit Beginn meiner Bergsteigerkarriere jemals gesehen hatte. Der größte Teil des Shasta-Chaparrals ist fast bis zum Boden belaubt; hier sind die Hauptstämme drei oder vier Fuß lang kahl und mit toten Zweigen durchsetzt, wodurch ein steifer Spanielwald entsteht , durch den selbst die Bären nur mit Mühe hindurchkommen. Ich war gezwungen, meilenweit auf allen Vieren zu kriechen, und als ich den Bärenspuren folgte, fand ich oft Haarbüschel an den Büschen, durch die sie sich hindurchgezwängt hatten.
Etwa 100 Fuß über dem Wasserfall war der Aufstieg nur durch zähe Bärlapppolster möglich, die am Felsen klebten. Darüber verwittert der Grat einige hundert Meter lang zu einer dünnen Messerklinge und trägt von dort bis zum Gipfel des Gebirges eine borstige Mähne aus Chaparral. Hier und da gibt es an felsigen Stellen kleine Öffnungen, von denen aus man eine schöne Aussicht über das kultivierte Tal bis zum Meer hat. Diese, wie ich an den Wegen fand, sind beliebte Aussichts- und Ruheplätze für die wilden Tiere – Bären, Wölfe, Füchse, Wildkatzen usw. –, die hier im Überfluss vorhanden sind und die bei der Einrichtung von Bienenfarmen berücksichtigt werden müssen. In den tiefsten Dickichten fand ich Waldrattendörfer – Gruppen von Hütten, vier bis sechs Fuß hoch, aus Stöcken und Blättern in groben, sich verjüngenden Stapeln gebaut, wie Bisamrattenhütten. Ich bemerkte auch ziemlich viele Bienen, die meisten davon wild. Die zahmen Honigbienen wirkten träge und flügelmüde, als wären sie den ganzen Weg aus dem blumenlosen Tal heraufgekommen.
Nachdem ich den Gipfel erreicht hatte, hatte ich nur Zeit, einen flüchtigen Blick auf das Becken zu werfen, das jetzt im Gold des Sonnenuntergangs leuchtete, bevor ich auf der Suche nach Wasser in einen der Nebenschluchten hinabeilte. Als ich aus einem besonders langweiligen Chaparral-Gebiet auftauchte, fand ich mich frei und aufrecht in einem wunderschönen parkähnlichen Wald aus Virginia-Eichen wieder, dessen Boden mit Aspidien und Dornröschen bepflanzt war, während das glänzende Laubwerk einen dichten Baldachin über mir bildete und die grauen Trennstämme frei ließ, sodass die Schönheit ihrer ineinander verschlungenen Bögen zu sehen war. Der Boden der Schlucht war dort, wo ich sie zuerst erreichte, trocken, aber ein Büschel scharlachroter Mimulus deutete auf Wasser in nicht allzu großer Entfernung hin, und bald entdeckte ich etwa einen Eimer voll davon in einer Felshöhle. Dieser war jedoch voller toter Bienen, Wespen, Käfer und Blätter, gut eingeweicht und geköchelt, und musste daher gekocht und durch frische Holzkohle gefiltert werden, bevor er verfügbar gemacht werden konnte. Als ich dem ausgetrockneten Kanal etwa eine Meile weiter bis zu seiner Kreuzung mit einem größeren Nebenfluss folgte, entdeckte ich schließlich eine Menge Felstümpel, klar wie Kristall, randvoll und durch glitzernde Bäche miteinander verbunden, die gerade stark genug waren, um hörbar zu singen. Blumen in voller Blüte zierten ihre Ränder, drei Meter hohe Lilien, Rittersporn, Akelei und üppige Farne, die sich in üppiger Fülle neigten und über alles wölbten, während eine edle alte Virginia-Eiche ihre schroffen Arme über alles ausbreitete. Hier schlug ich mein Lager auf und machte mein Bett auf glatten Pflastersteinen.

Am nächsten Tag kam ich im Bett eines Nebenflusses, der auf den Mount San Antonio mündet, an etwa fünfzehn oder zwanzig Gärten vorbei, die dem ähnelten, in dem ich geschlafen hatte – in jedem von ihnen standen Lilien in voller Blüte. Mein drittes Lager wurde in der Nähe der Mitte des Beckens aufgeschlagen, am Kopf eines langen Systems von Kaskaden von zehn bis 200 Fuß Höhe, die in dichter Folge in einer felsigen, unzugänglichen Schlucht aufeinander folgten und einen Gesamtabstieg von fast 1700 Fuß bildeten. Oberhalb der Kaskaden fließt der Hauptstrom durch eine Reihe offener, sonniger Ebenen, von denen die größten etwa einen Morgen groß sind, wo die wilden Bienen und ihre Gefährten sich an einem prächtigen Bestand von Zauschneria, Buntkelchgewächsen und Monardella gütlich taten; und Grauhörnchen waren damit beschäftigt, die Kletten der Douglas-Fichte zu ernten, der einzigen Nadelbaumart, die ich im Becken sah.
Die östlichen Hänge des Beckens ähneln in jeder Hinsicht denen, die wir beschrieben haben, und dasselbe kann man von anderen Teilen der Bergkette sagen. Vom höchsten Gipfel aus, so weit das Auge reichte, war die Landschaft eine einzige weite Bienenweide, eine hügelige Wildnis voller Honigblüten, kaum unterbrochen von Waldstücken oder den felsigen Ausläufern von Hügeln und Bergrücken.
Hinter der San Bernardino Range liegt das wilde „Beifußland“, das im Osten durch den Colorado River begrenzt wird und sich in nördlicher Richtung bis nach Nevada und entlang des östlichen Fußes der Sierra jenseits des Mono Lake erstreckt.
Der größte Teil dieser riesigen Region, einschließlich Owen’s Valley, Death Valley und der Mohave-Senke, deren Fläche fast ein Fünftel der des gesamten Staates beträgt, wird normalerweise als Wüste angesehen, nicht weil es an Boden mangelt, sondern weil es an Regen mangelt und Flüsse für die Bewässerung fehlen. In den Augen einer Biene ist jedoch nur sehr wenig davon Wüste.
Wenn man sich jetzt alle verfügbaren Weideflächen Kaliforniens ansieht, scheint es, dass die Bienenzucht noch in den Kinderschuhen steckt. Selbst in den geschäftstüchtigeren südlichen Bezirken, wo so energische Anfänge gemacht wurden, ist bisher weniger als ein Zehntel der Honigressourcen erschlossen; in der Great Plain, den Coast Ranges, der Sierra Nevada und der nördlichen Region um Mount Shasta kann man kaum von einer Existenz der Bienenzucht sprechen. Wo die Grenzen ihrer Entwicklung in Zukunft liegen werden, angesichts der Vorteile billigerer Transportmöglichkeiten und der Erfindung allgemein besserer Methoden, ist nicht leicht zu erraten. Ebenso wenig können wir den Einfluss auf die Bieneninteressen abschätzen, den die Zerstörung der Wälder, die jetzt schnell vor Feuer und Axt fallen, wahrscheinlich haben wird. Was das Übel der Schafe betrifft, so kann es kaum noch größer werden als heute. Kurz gesagt, trotz der bereits eingetretenen weitverbreiteten Verschlechterung und Zerstörung aller Art ist Kalifornien mit seinem unvergleichlichen Klima und seiner Flora meines Wissens noch immer das beste Bienenland der Welt.
[1] Im Jahr 1855 wurden im Los Angeles County 15 Stöcke italienischer Bienen eingeführt, und im Jahr 1876 war ihre Zahl auf 500 angestiegen. Die ihnen zugeschriebene deutliche Überlegenheit gegenüber den gewöhnlichen Arten erregt heute beträchtliche Aufmerksamkeit.


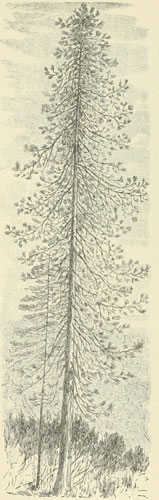
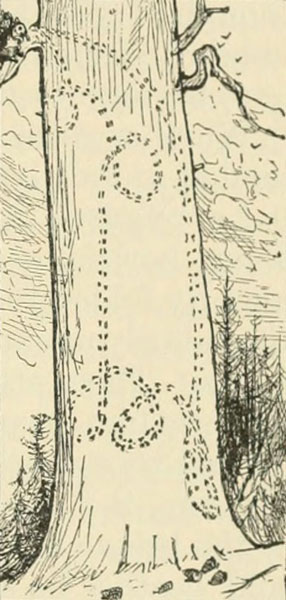
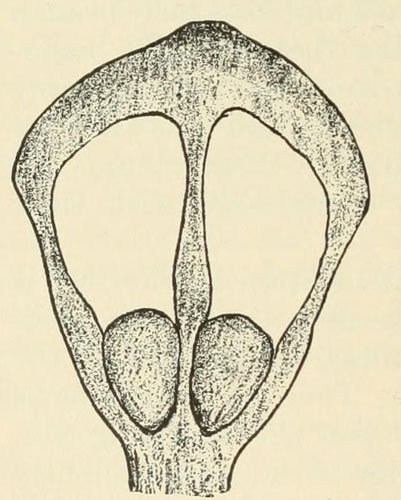



 Index
Index Themen
Themen Hierarchisch
Hierarchisch Länder
Länder Karten
Karten Suche
Suche